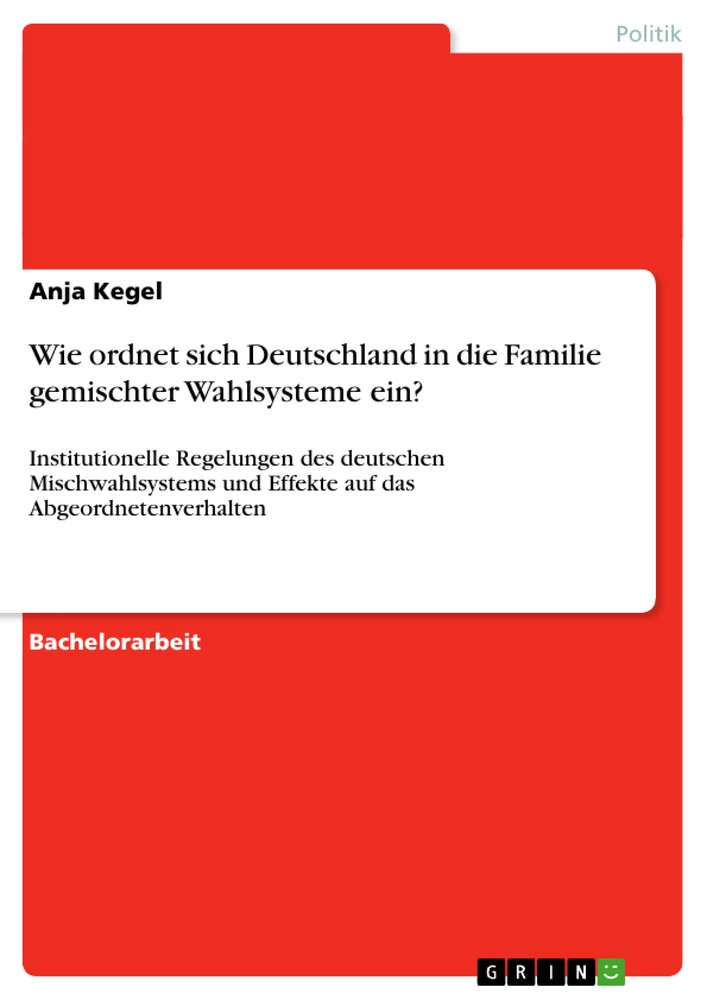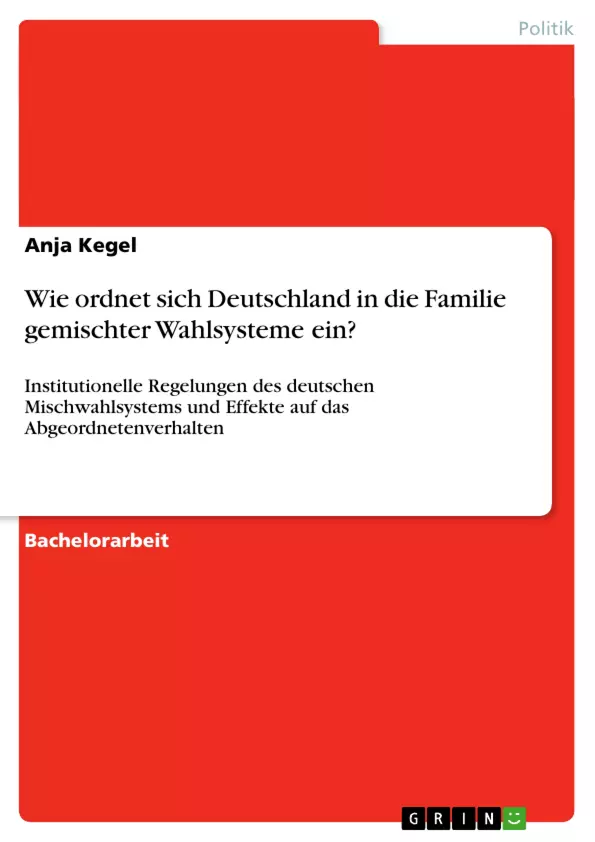Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema Wahlsysteme konzentriert sich seit einigen Jahren auf die Gruppe der Mischwahlsysteme, welche Elemente der Mehrheits- und der Verhältniswahl miteinander verbinden (vgl. Manow/Zittel 2008: 141).
In dieser Diskussion geht es einmal um Frage, in welchem Ausmaß Anreize von Wahlregeln wirken, wobei von Kritikern argumentiert wird, dass in parlamentarischen Demokratien das Vorhandensein sowie das Ausüben von Kohäsion und Fraktionsdisziplin einen stärkeren Ef-fekt auf politische Vertreter hat als mögliche Effekte von Wahlsystemen (vgl. Manow/Zittel 2008: 141). Im Gegensatz dazu befürworten andere Autoren den Aspekt, dass von Mischwahlsystemen eigenständige Effekte ausgehen (Manow/Zittel 2008: 141).
In der aktuelleren Diskussion um Mischwahlsysteme wird nun die Frage diskutiert, inwieweit die beiden kombinierten Anreizsysteme tatsächlich getrennte Anreizwirkungen auf die Wahl-kreis- und Listenkandidaten ausüben oder ob es sich eher um Kontaminationseffekte handelt (vgl. Zittel 2008: 192). Bawn und Thies (2003) gehen davon aus, dass ein Kontaminationsef-fekt, der auf beiden Wahlebenen Anreize zur Individualisierung setzt, vor allem in denjenigen Mischwahlsystemen auftritt, in denen die Möglichkeit zur Doppelkandidatur besteht – z.B. im deutschen Mischwahlsystem (vgl. Zittel 2008: 193). Sie erwarten, dass Abgeordnete, die auf beiden Wahlebenen kandidiert haben, in jedem Fall einen Wahlkreisbezug ausbilden, unabhängig davon, wie sie letztendlich gewählt worden sind (vgl. Manow/Zittel 2008: 143).
Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion gibt es verschiedene Arbeiten, die sich in Ansätzen mit den Effekten beschäftigen, die sich auf das Handeln von Abgeordneten auswirken. Bislang wurden die relevanten sowie aktuellen empirischen Befunde, die Aussagen über die Effekte auf das Verhalten von Abgeordneten am Beispiel des deutschen Mischwahlsystems aufweisen, nicht zusammengetragen. Aus diesem Grund versuche ich der Frage nachzugehen, wie sich einerseits Deutschland in die Familie der gemischten Wahlsysteme einordnet und andererseits welche institutionellen Regelungen und die daraus resultierenden Effekte Einfluss auf das Abgeordnetenverhalten haben. Ich möchte in meiner Bachelorarbeit insbesondere auf die Verhaltensunterschiede zwischen Direkt- und Listenmandataren eingehen, daher gilt mein Interesse vordergründig den Personalisierungs- und Wahlkreisorientierungseffekten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einführung in die Problematik
- 2. Eine Typologie gemischter Wahlsysteme mit Augenmerk auf die Inputdimension
- 2.1,,Mixed-member electoral systems" - die Typologie von Shugart und Wattenberg
- 2.2 Was ist unter dem Konzept der elektoralen Effizienz nach Shugart (2001) zu verstehen und welche Rolle spielen hierbei Mischwahlsysteme?
- 2.3 Was fehlt nach Kaiser (2002) der Typologie von Shugart und Wattenberg?
- 2.4 Welche Effekte werden auf das Abgeordnetenverhalten im Allgemeinen erwartet?
- 3. Die typologische Einordnung des deutschen Mischwahlsystems und die Input-Dimension
- 3.1 Die Kandidaturform - der Wahlkreis- und der Listenabgeordnete
- 3.1.1 Die Wahlkreiskandidatur
- 3.1.2 Die Listenkandidatur
- 3.1.3 Die Option der Doppelkandidatur
- 3.2 Der Modus der Stimmabgabe – die Erst- und die Zweitstimme
- 3.2.1 Die Rolle der Erststimme
- 3.2.2 Die Rolle der Zweitstimme
- 3.2.3 Die Option des Stimmensplitting
- 3.3 Fazit Warum werden Verhaltensunterschiede zwischen Direkt- und Listenmandataren erwartet und welche können erwartet werden?
- 3.1 Die Kandidaturform - der Wahlkreis- und der Listenabgeordnete
- 4. Personalisierungs- und Wahlkreisorientierungseffekte in der Empirie
- 4.1 Fünf ausgewählte empirische Analysen
- 4.2 Welche Aussagen lassen sich anhand dieser fünf Studien in Hinblick auf die Verhaltensunterschiede zwischen Direkt- und Listenmandataren treffen?
- 5. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der typologischen Einordnung des deutschen Mischwahlsystems und untersucht die Auswirkungen der institutionellen Regelungen auf das Abgeordnetenverhalten. Der Fokus liegt dabei auf den Verhaltensunterschieden zwischen Direkt- und Listenmandataren, insbesondere auf Personalisierungs- und Wahlkreisorientierungseffekten.
- Typologische Einordnung des deutschen Mischwahlsystems
- Analyse der Inputdimension in gemischten Wahlsystemen
- Untersuchung der Effekte auf das Abgeordnetenverhalten
- Personalisierungstendenzen im deutschen Wahlsystem
- Wahlkreisorientierung von Abgeordneten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der Mischwahlsysteme und beleuchtet die wissenschaftliche Diskussion um deren Effekte auf das Abgeordnetenverhalten. Dabei werden verschiedene Ansätze und Argumente vorgestellt, die die Bedeutung von Wahlsystemen für die politische Repräsentation und das Verhalten von Abgeordneten beleuchten.
Im zweiten Kapitel wird eine Typologie gemischter Wahlsysteme mit Augenmerk auf die Inputdimension vorgestellt. Die Typologie von Shugart und Wattenberg (2005) wird kritisch betrachtet und durch die Einbeziehung der Inputdimension nach Kaiser (2002) erweitert. Die Inputdimension umfasst die Wahlbewerbungs- und Stimmgebungsverfahren und beinhaltet wichtige Anreize für das Verhalten von Abgeordneten.
Das dritte Kapitel widmet sich der typologischen Einordnung des deutschen Mischwahlsystems unter Berücksichtigung der Inputdimension. Es werden die Kandidaturform, der Modus der Stimmabgabe und die Option des Stimmensplitting analysiert. Die Arbeit untersucht, welche Verhaltensunterschiede zwischen Direkt- und Listenmandataren erwartet werden können und welche Anreize durch die institutionellen Regelungen des deutschen Wahlsystems entstehen.
Das vierte Kapitel befasst sich mit empirischen Analysen, die Erkenntnisse über die Personalisierungs- und Wahlkreisorientierungseffekte des deutschen Mischwahlsystems liefern. Es werden fünf ausgewählte Studien vorgestellt, die Aussagen über Verhaltensunterschiede zwischen Direkt- und Listenmandataren treffen lassen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Mischwahlsysteme, Wahlsysteme, Abgeordnetenverhalten, Personalisierung, Wahlkreisorientierung, Direktmandat, Listenmandat, Deutschland, Inputdimension, Typologie, Wahlbewerbungsverfahren, Stimmgebungsverfahren, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert das deutsche Mischwahlsystem?
Das deutsche System kombiniert Elemente der Mehrheitswahl (Erststimme für Direktkandidaten) mit der Verhältniswahl (Zweitstimme für Landeslisten der Parteien), um eine personalisierte Verhältniswahl zu ermöglichen.
Was ist ein Kontaminationseffekt im Wahlsystem?
Ein Kontaminationseffekt tritt auf, wenn die Anreize der beiden Wahlebenen (Wahlkreis und Liste) sich gegenseitig beeinflussen. Beispielsweise könnten Listenabgeordnete sich wie Wahlkreisabgeordnete verhalten, um ihre Wiederwahlchancen zu erhöhen.
Verhalten sich Direktmandatare anders als Listenmandatare?
Theoretisch wird erwartet, dass Direktmandatare eine stärkere Wahlkreisorientierung zeigen. Die Arbeit untersucht empirisch, ob diese Unterschiede tatsächlich bestehen oder ob die Fraktionsdisziplin diese Effekte überlagert.
Was bedeutet Personalisierung im Wahlsystem?
Personalisierung meint, dass Wähler nicht nur Parteien, sondern gezielt einzelne Personen wählen können. Im deutschen System geschieht dies vor allem durch die Erststimme im Wahlkreis.
Welche Rolle spielt die Doppelkandidatur?
In Deutschland können Kandidaten sowohl im Wahlkreis als auch auf der Liste antreten. Dies sichert Spitzenpolitiker ab, kann aber dazu führen, dass auch Listenabgeordnete einen starken Fokus auf ihren Wahlkreis legen.
- Quote paper
- Anja Kegel (Author), 2009, Wie ordnet sich Deutschland in die Familie gemischter Wahlsysteme ein? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140804