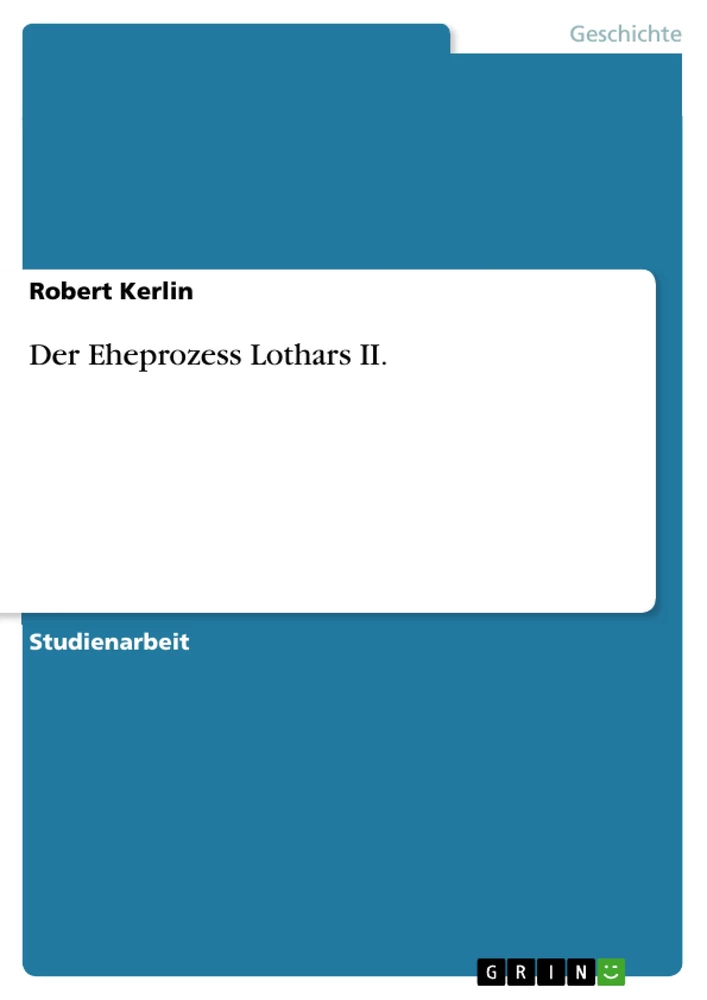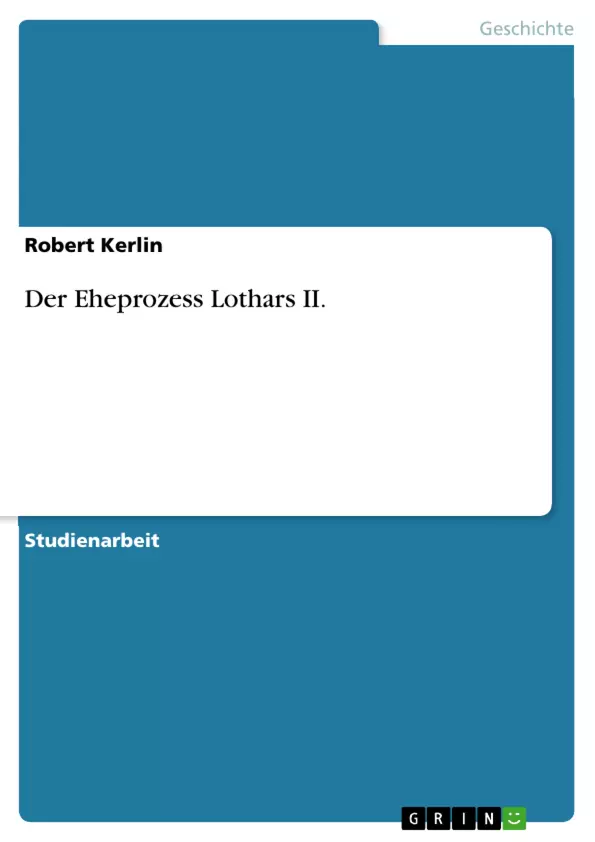„Anno dominicae incarnationis DCCCLVI. Lotharius rex Thietbirgam reginam sibi in matrimonium iunxit; ex qua coniunctione maxima ruina non illi solum, sed etiam omni regno eius accidit, sicut in subsequntibus luce clarius apparebit.”
Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 856 nahm König Lothar die Königin Thietbirga zur Ehe, aus dieser Verbindung entsprang nicht nur für ihn, sondern auch für sein ganzes Reich großes Unheil, wie sich im folgenden sonnenklar zeigen wird.
„[...]Lotharius rex, cogentibus suis, uxorem quam abiecerat recipit, nec tamen ad torum admittit, sed custodiae tradit.“
König Lothar nahm auf Drängen der Seinigen die Gemahlin, welche er verstoßen hatte, wieder auf; er behandelte sie aber nicht wie seine Gemahlin, sondern ließ sie in Gewahrsam halten.
Die vorangegangen Quellenzitate zeigen einen Überblick über die Darstellungsweise einiger Ereignisse des „lothringischen Ehestreites“ oder des Eheprozesses Lothars II. Zudem enthalten sie bereits einige wichtige Informationen über die Ereignisse , die hoffentlich neugierig genug gemacht haben, um die vorliegende Arbeit vollständig zu lesen und dadurch einen Einblick in die Situation des Frankenreichs Mitte des 9. Jahrhunderts, aber auch einen Einblick in familiäre Strukturen der Karolinger, sowie des weltlichen und kirchlichen Eherechtes der genannten Zeit zu gewinnen und außerdem von der Emanzipation eines Papstes zu lesen, deren Entwicklung schließlich im Investiturstreit des 11. Jahrhunderts gipfeln sollte.
Die Arbeit hat das Ziel zu zeigen, was während des Ehestreites geschah, wer die einzelnen Protagonisten waren und warum Lothar II. letztendlich gescheitert ist mit dem Versuch ,zu Gunsten einer anderen Frau und deren Sohn von ihm, eine gültige Muntehe trennen bzw. für ungültig erklären zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschehnisse chronologisch geordnet
- Die wichtigsten Protagonisten
- Lothar II. und seine Familie.
- Die Päpste Nikolaus I. und Hadrian II.
- Theutberga und Waldrada
- Zu den vorgebrachten Argumenten
- Inzest und Ehebruch
- Unfruchtbarkeit
- Votum
- bereits bestehende Ehe mit Waldrada.
- Zusammenfassung
- Quellen-und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit hat das Ziel zu zeigen, was während des Ehestreites geschah, wer die einzelnen Protagonisten waren und warum Lothar II. letztendlich gescheitert ist mit dem Versuch, zu Gunsten einer anderen Frau und deren Sohn von ihm, eine gültige Muntehe trennen bzw. für ungültig erklären zu lassen.
- Der Eheprozess Lothars II. als Spiegelbild der politischen und familiären Strukturen des fränkischen Reiches im 9. Jahrhundert
- Die Rolle von Kirche und Staat in der Ehescheidungspraxis des Früh- und Hochmittelalters
- Die Bedeutung des Papstes als Schlichter und Richter in Ehekonflikten
- Die unterschiedlichen Argumente und Motive der Protagonisten im Ehestreit
- Die Folgen des Ehestreites für Lothar II. und sein Königreich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen kurzen Überblick über den Ehestreit Lothars II. und stellt die wichtigsten Quellen für die Arbeit vor. Kapitel 2 bietet eine chronologische Darstellung der Ereignisse des Ehestreites. Kapitel 3 stellt die wichtigsten Protagonisten des Ehestreites vor, darunter Lothar II. und seine Familie, die Päpste Nikolaus I. und Hadrian II. sowie Theutberga und Waldrada. Kapitel 4 untersucht die von den Parteien vorgebrachten Argumente für die Scheidung, darunter Inzest, Ehebruch, Unfruchtbarkeit und die bereits bestehende Ehe mit Waldrada.
Schlüsselwörter
Lothar II., Theutberga, Waldrada, Eheprozess, Scheidung, Kirche, Staat, Papst, fränkisches Reich, Karolinger, 9. Jahrhundert, Eherecht, Inzest, Ehebruch, Unfruchtbarkeit, Friedelehe, Muntehe
- Arbeit zitieren
- Robert Kerlin (Autor:in), 2005, Der Eheprozess Lothars II., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140827