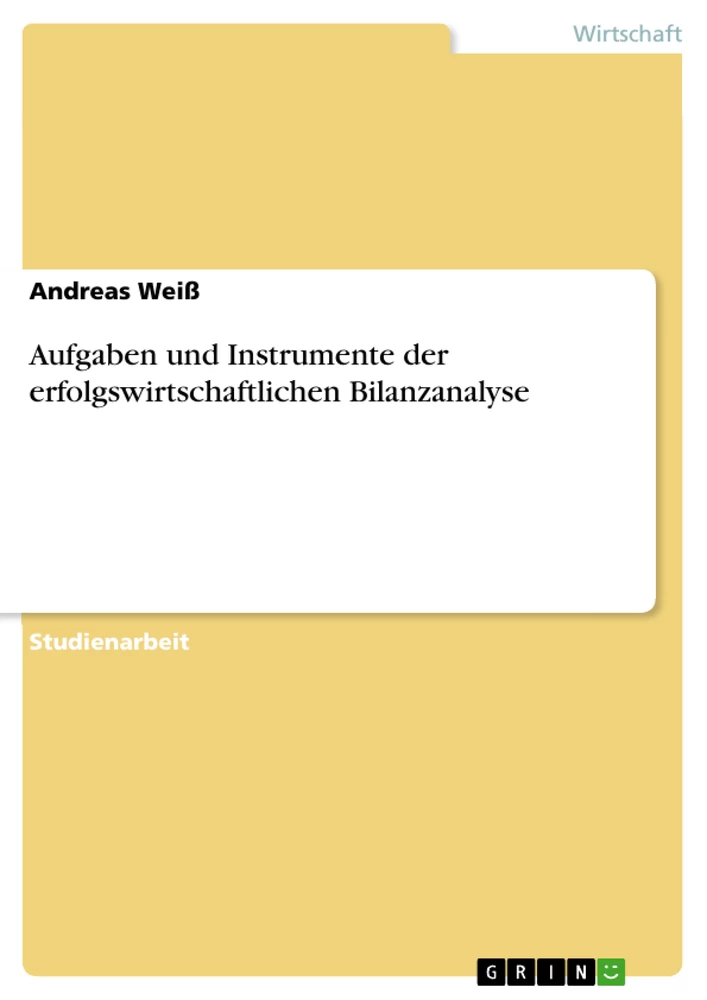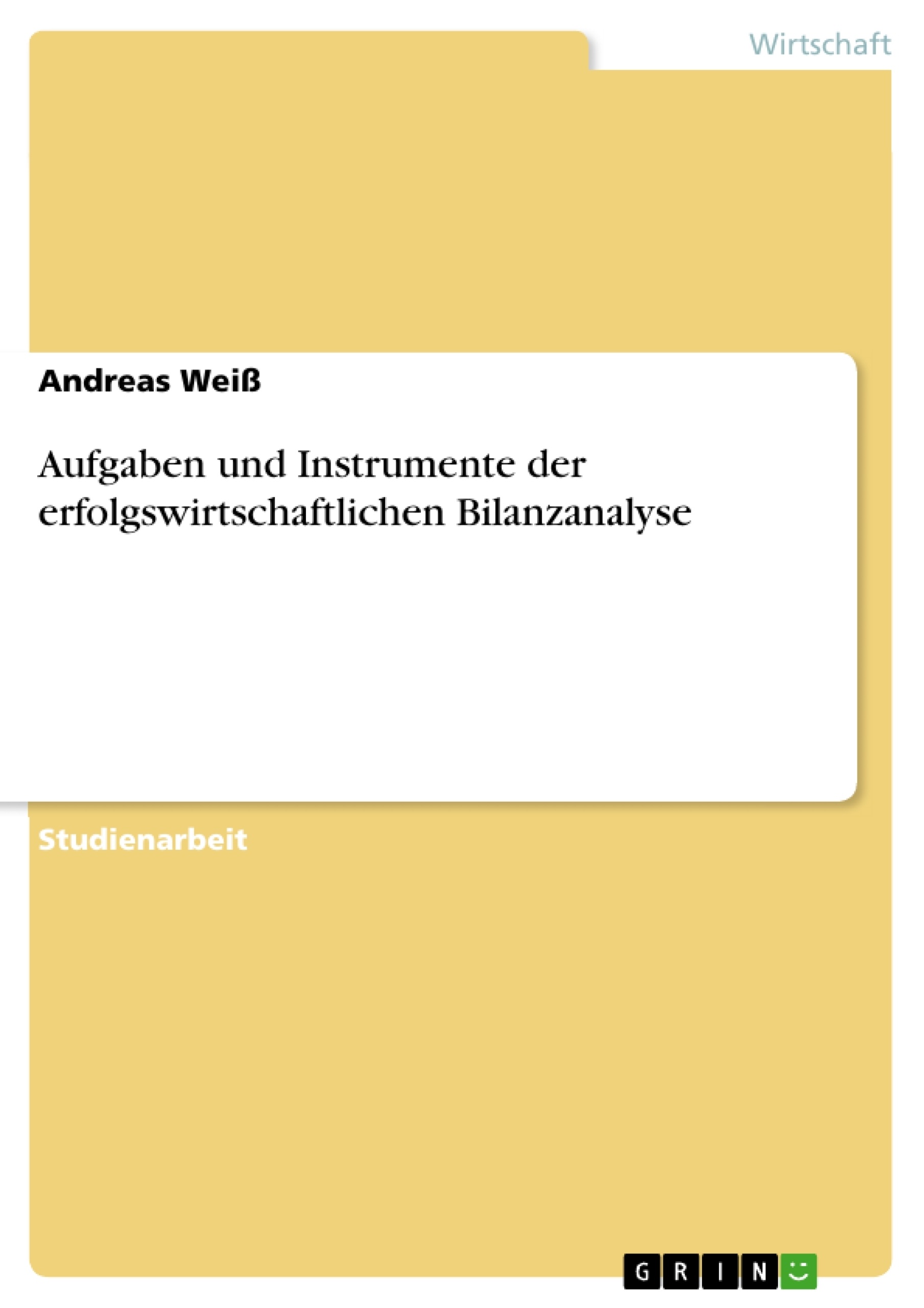Die Bilanzanalyse dient der Informationsgewinnung für diese Interessentengruppen (interne und externe Bilanzanalyse) in Bezug auf die wirtschaftliche Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Es wird zwischen der finanzwirtschaftlichen Bilanzanalyse und der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse unterschieden. Die Erfolgsanalyse verfolgt dabei verschiedene Ziele. Eines ist die der Ertragskraft eines Unternehmens zu ermitteln und versucht diese in die Zukunft zu prognostizieren. Unter der Ertragskraft versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens gegenwärtig und auch zukünftig Gewinne zu erzielen. Besonderen Interesse liegt dabei auf der nachhaltigen (=auf Dauer) Ertragskraft des Unternehmens. Sie ist besonders für die Anteilseigner des Unternehmens und die Investoren und Geber langfristigen Fremdkapitals interessant. Die Anteilseigner sind an der Ertragskraft interessiert, da sich diese auf die Gewinnausschüttung und bei börsennotierten Aktiengesellschaften auch auf die Kursentwicklung niederschlägt. Für die Investoren und Fremdkapitalgeber stellt die Ertragskraft die Fähigkeit eines Unternehmens dar, pünktlich und sicher Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten und die Sicherheit des Kreditengagements.
Eine weitere Aufgabe der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse ist die Feststellung Gewinns der im betriebswirtschaftlichen Sinn erzielt wurde. „Der Gewinnbegriff im betriebswirtschaftlichen Sinn wird bestimmt durch den Geldbetrag, der einem Unternehmen in einem Geschäftsjahr bei Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Sicherung des künftigen (gleich bleibenden) Einkommens maximal entzogen werden kann“. Bei der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse dient die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) als Grundlage. Der ausgewiesene Erfolg im Jahresabschluss spiegelt aber nicht den Gewinn im betriebswirtschaftlichen Sinn, sondern den Erfolg, der der durch vorgegebenen bilanzpolitischen Wahlrechte und Spielräume aufgrund von Gesetzen (insbesondere durch das Handelsgesetzbuch (HGB)) und durch die Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) ermittelt wurde. Der ausge-wiesene Erfolg in der GuV und der tatsächlichen Erfolg im betriebswirtschaftlichen Sinn fallen hier auseinander. Die Erfolgsanalyse verfolgt das Ziel das tatsächliche Ergebnis eines Unternehmens zu ermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ziele und Aufgaben der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse
- 2. Die Ergebnisanalyse
- 2.1 Betragsmäßige Ergebnisanalyse
- 2.1.1 Ergebnis nach DVFA
- 2.1.2 Der Cash Flow
- 2.1.3 Ein Vergleich von Börsenwert und Bilanzwert
- 2.2 Die Erfolgsquellenanalyse
- 2.2.1 Der ordentliche Betriebserfolg
- 2.2.2 Der Finanz- und Verbunderfolg (betriebsfremdes Ergebnis)
- 2.2.3 Das außerordentliche Ergebnis
- 2.2.4 Der Bewertungserfolg
- 2.2.5 Analyse und Interpretation der Ergebnisquellenanalyse
- 2.1 Betragsmäßige Ergebnisanalyse
- 3. Die Rentabilitätsanalyse
- 3.1 Die Eigenkapitalrentabilität
- 3.2 Die Gesamtkapitalrentabilität
- 3.3 Die Betriebsrentabilität
- 3.4 Die Umsatzrentabilität bzw. Umsatzrendite
- 3.5 Der Return on Investment (ROI)
- 3.6 Der Gewinn pro Aktie und das Kurs-Gewinn-Verhältnis
- 4. Die Wertschöpfungsanalyse
- 5. Die Break-even-Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse umfassend zu beleuchten. Sie untersucht verschiedene Methoden und Instrumente zur Ermittlung und Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens.
- Ermittlung der Ertragskraft eines Unternehmens
- Analyse verschiedener Gewinnarten und -quellen
- Anwendung von Rentabilitätskennzahlen
- Wertschöpfungsanalyse
- Break-even-Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ziele und Aufgaben der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse: Dieses Kapitel definiert die erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse und ihre Ziele. Es betont die Ermittlung der gegenwärtigen und zukünftigen Gewinnfähigkeit eines Unternehmens, insbesondere die nachhaltige Ertragskraft. Die Bedeutung dieser Analyse für Anteilseigner, Investoren und Fremdkapitalgeber wird hervorgehoben. Weiterhin wird der Unterschied zwischen dem Gewinn im betriebswirtschaftlichen Sinn und dem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinn erläutert, wobei die bilanzpolitischen Wahlrechte und Spielräume eine zentrale Rolle spielen. Schließlich wird die Analyse der Erfolgsstruktur als weitere wichtige Aufgabe der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse herausgestellt.
2. Die Ergebnisanalyse: Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Methoden zur Ermittlung des tatsächlich erwirtschafteten Gewinns. Die betragsmäßige Ergebnisanalyse, mit Fokus auf das Ergebnis nach DVFA und den Cash Flow, steht im Mittelpunkt. Der Vergleich von Börsenwert und Bilanzwert wird als zusätzliches Instrument zur Beurteilung der Ertragskraft diskutiert, wobei die Grenzen dieser Methode aufgrund spekulative Einflüsse deutlich gemacht werden. Schliesslich wird die Erfolgsquellenanalyse als Methode zur Untersuchung der Erfolgsstruktur des Unternehmens vorgestellt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit zur erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Ermittlung und Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens mithilfe verschiedener Methoden und Kennzahlen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Ziele und Aufgaben der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse; 2. Die Ergebnisanalyse (inkl. betragsmäßiger Ergebnisanalyse und Erfolgsquellenanalyse); 3. Die Rentabilitätsanalyse (mit verschiedenen Rentabilitätskennzahlen wie Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität, usw.); 4. Die Wertschöpfungsanalyse; und 5. Die Break-even-Analyse.
Was sind die Ziele und Aufgaben der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse?
Die erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse zielt darauf ab, die gegenwärtige und zukünftige Gewinnfähigkeit eines Unternehmens zu ermitteln und zu beurteilen, insbesondere die nachhaltige Ertragskraft. Sie ist relevant für Anteilseigner, Investoren und Fremdkapitalgeber. Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse der Erfolgsstruktur und der Unterschied zwischen dem betriebswirtschaftlichen Gewinn und dem in der GuV ausgewiesenen Gewinn unter Berücksichtigung bilanzpolitischer Spielräume.
Wie wird die Ergebnisanalyse durchgeführt?
Die Ergebnisanalyse umfasst die betragsmäßige Ergebnisanalyse (mit Fokus auf das Ergebnis nach DVFA und den Cash Flow) und die Erfolgsquellenanalyse. Der Vergleich von Börsenwert und Bilanzwert wird als zusätzliches Instrument diskutiert, wobei dessen Grenzen aufgrund spekulative Einflüsse hervorgehoben werden. Die Erfolgsquellenanalyse untersucht die Struktur des Unternehmenserfolges, indem verschiedene Gewinnarten und -quellen analysiert werden.
Welche Rentabilitätskennzahlen werden betrachtet?
Die Rentabilitätsanalyse behandelt verschiedene Kennzahlen, darunter die Eigenkapitalrentabilität, die Gesamtkapitalrentabilität, die Betriebsrentabilität, die Umsatzrentabilität/Umsatzrendite, der Return on Investment (ROI), der Gewinn pro Aktie und das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese Kennzahlen dienen der Beurteilung der Ertragskraft aus verschiedenen Perspektiven.
Welche weiteren Analysen werden behandelt?
Neben der Ergebnis- und Rentabilitätsanalyse werden auch die Wertschöpfungsanalyse und die Break-even-Analyse behandelt. Diese liefern zusätzliche Informationen zur Beurteilung der Unternehmenssituation und der Ertragskraft.
Was ist der Schwerpunkt der Arbeit?
Der Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Beleuchtung der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse und der Anwendung verschiedener Methoden und Instrumente zur Ermittlung und Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Die Analyse verschiedener Gewinnarten und -quellen sowie die Anwendung von Rentabilitätskennzahlen spielen eine zentrale Rolle.
- Citation du texte
- Andreas Weiß (Auteur), 2003, Aufgaben und Instrumente der erfolgswirtschaftlichen Bilanzanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14100