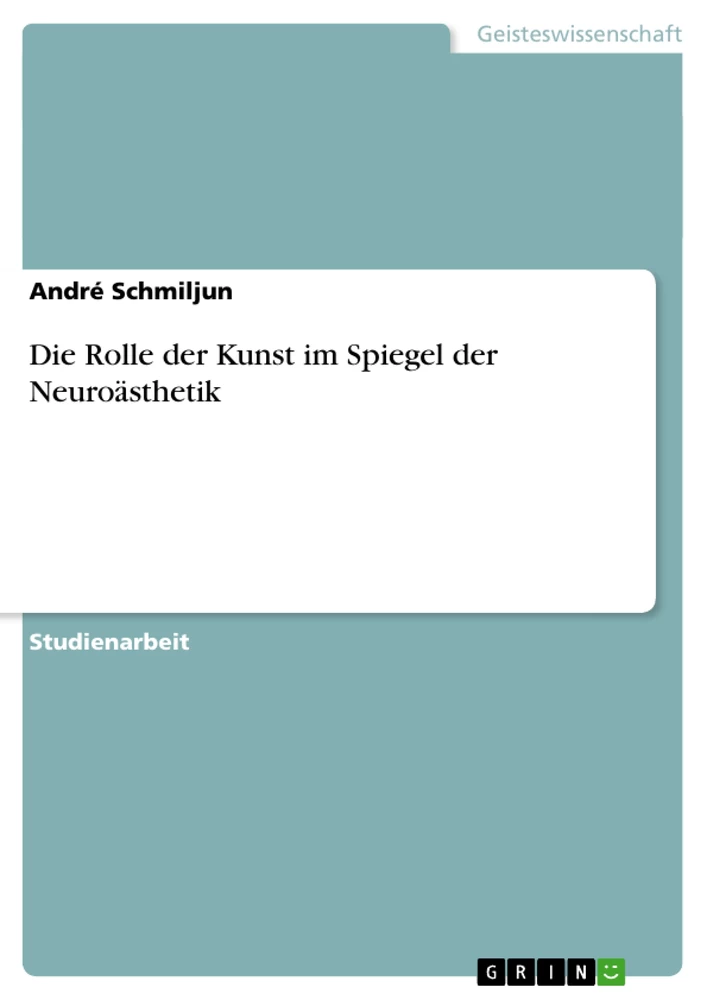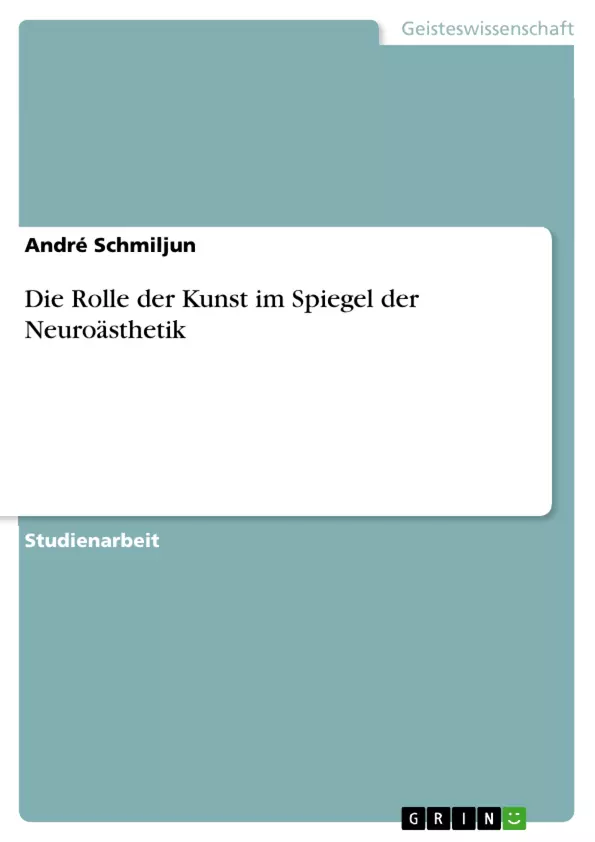Es wäre nicht vermessen zu sagen, dass die Frage, was ist Schönheit, bereits
Generationen von Denkern verschiedenster Strömungen beschäftigt hat. Vor allem in der philosophischen Disziplin, der Ästhetik, ist über Jahrhunderte versucht worden, Erklärungen und Regeln aufzubringen, um dem Phänomen des Schönen auf den Grund zu gehen.
Mit welcher Systematik können beispielsweise Aussagen bewertet werden wie: „Ich finde dieses Gemälde, anders als jene Skulptur, schön“. Eine vielversprechende Lösungsmöglichkeit bieten die erst seit einiger Zeit vielseitig betriebenen Diskussionen innerhalb des neuen wissenschaftlichen Forschungszweiges, der Neuroästhetik.
Der interdisziplinäre Zusammenschluss von Neurobiologie und Ästhetik verfolgt das Ziel, Erkenntnisse der Geisteswissenschaften für die Erforschung des menschlichen Gehirns zu nutzen. Bisher gestaltete sich die Basis neurobiologischer Literatur zum Thema Kunst und Schönheit sehr
übersichtlich.
Inzwischen jedoch ist das Interesse gewachsen, die Beziehung zwischen Kunst und Gehirn genauer zu studieren, herauszufinden, wie sich ideale Schönheit in den Hirnaktivitäten darstellt, welches Verhältnis zwischen Schönheit und Belohnung oder Lust besteht und schließlich wie sich Kreativität im Gehirn niederschlägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ramachandran und Hirnstein: „The Science of Art. A neurological theory of aethetic experience“
- Einführung, Konzept und Vorgehensweise
- Die Suche nach dem Wesen in den Dingen
- Peak-Shift-Effect
- Essenzen lassen nicht erkennen!
- ,,Art and the Brain“ – Semir Zeki
- Künstler sind Neurobiologen.
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Neuroästhetik die Rolle der Kunst im menschlichen Gehirn beleuchtet. Sie setzt sich zum Ziel, zwei bedeutende neuroästhetische Konzepte, eines von Semir Zeki und eines von Ramachandran und Hirnstein, zu vergleichen und ihre Kunstdefinitionen zu analysieren.
- Die Beziehung zwischen Kunst und Hirnaktivitäten
- Die Rolle von Schönheit und Belohnung/Lust im Gehirn
- Die Darstellung von Kreativität im Gehirn
- Die Unterschiede und Parallelen zwischen den neuroästhetischen Konzepten von Zeki, Ramachandran und Hirnstein
- Die kritische Bewertung der funktionalistischen Ansätze in der Neuroästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit und den Forschungsstand in der Neuroästhetik vor. Sie zeigt auf, dass die Neuroästhetik als neuer Forschungszweig die Verbindung zwischen Neurobiologie und Ästhetik erforscht, um das menschliche Gehirn und seine Reaktion auf Kunst zu verstehen.
Das Kapitel über Ramachandran und Hirnstein analysiert ihre Theorie der ästhetischen Erfahrung. Sie postulieren, dass es wissenschaftlich überprüfbare Kriterien für die ästhetische Einordnung von Objekten gibt und dass diese Kriterien auf neurobiologischen Prinzipien beruhen. Die Autoren untersuchen, wie bestimmte Merkmale in Bildern auf bestimmte Gehirnareale wirken und so ein Gefühl von Wohlbefinden hervorrufen.
Das Kapitel über Semir Zeki befasst sich mit seiner Theorie der Kunst und des Gehirns. Zeki argumentiert, dass Künstler in gewisser Weise Neurobiologen sind, da sie bewusst oder unbewusst neurologische Mechanismen nutzen, um bestimmte ästhetische Erfahrungen zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Neuroästhetik, Kunsttheorie, Schönheit, Gehirn, Hirnaktivitäten, ästhetische Erfahrung, Belohnung, Lust, Kreativität, Zeki, Ramachandran, Hirnstein.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Neuroästhetik?
Neuroästhetik ist ein interdisziplinärer Forschungszweig, der Erkenntnisse der Neurobiologie nutzt, um zu untersuchen, wie das menschliche Gehirn Schönheit und Kunst wahrnimmt und verarbeitet.
Was besagt Semir Zekis Theorie „Art and the Brain“?
Zeki argumentiert, dass Künstler unbewusst wie Neurobiologen handeln, indem sie neurologische Mechanismen nutzen, um gezielt ästhetische Erfahrungen im Gehirn zu erzeugen.
Was ist der „Peak-Shift-Effect“ in der Kunst?
Nach Ramachandran und Hirnstein reagiert das Gehirn besonders stark auf übersteigerte Merkmale (Karikaturen oder abstrakte Kunst), was ein intensiveres ästhetisches Erlebnis auslöst.
Wie hängen Schönheit und Belohnung im Gehirn zusammen?
Die Wahrnehmung von Schönheit aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn, was Gefühle von Lust und Wohlbefinden hervorruft.
Welche Kritik gibt es an funktionalistischen Ansätzen der Neuroästhetik?
Kritiker bemängeln, dass die Reduktion von Kunst auf Hirnaktivitäten die kulturelle und geisteswissenschaftliche Tiefe des Kunstbegriffs vernachlässigen könnte.
- Citar trabajo
- André Schmiljun (Autor), 2008, Die Rolle der Kunst im Spiegel der Neuroästhetik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141070