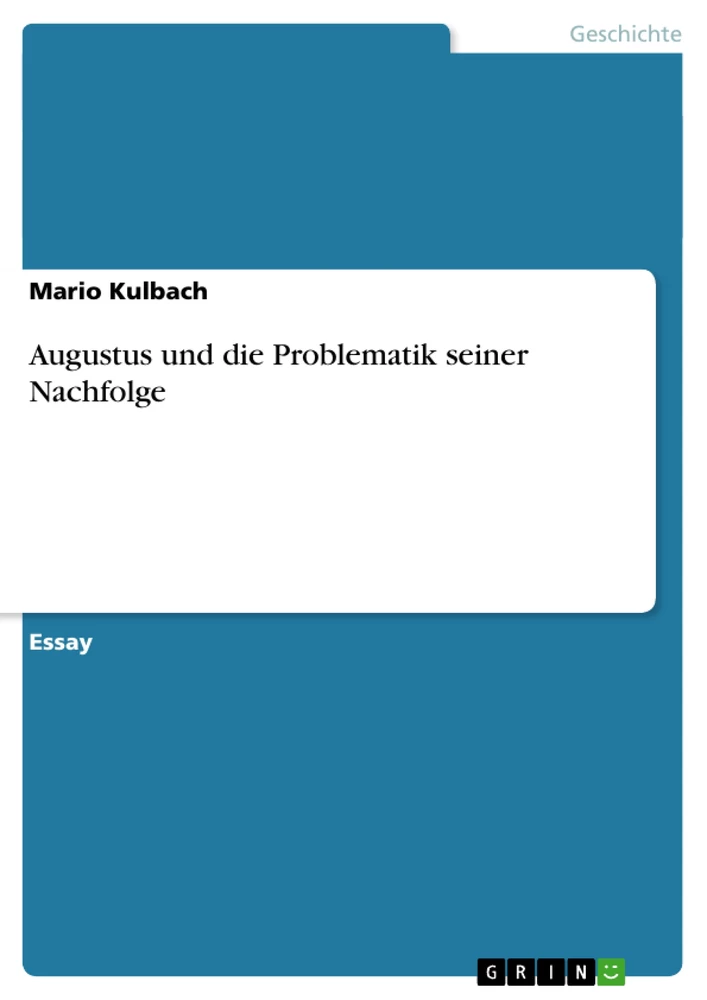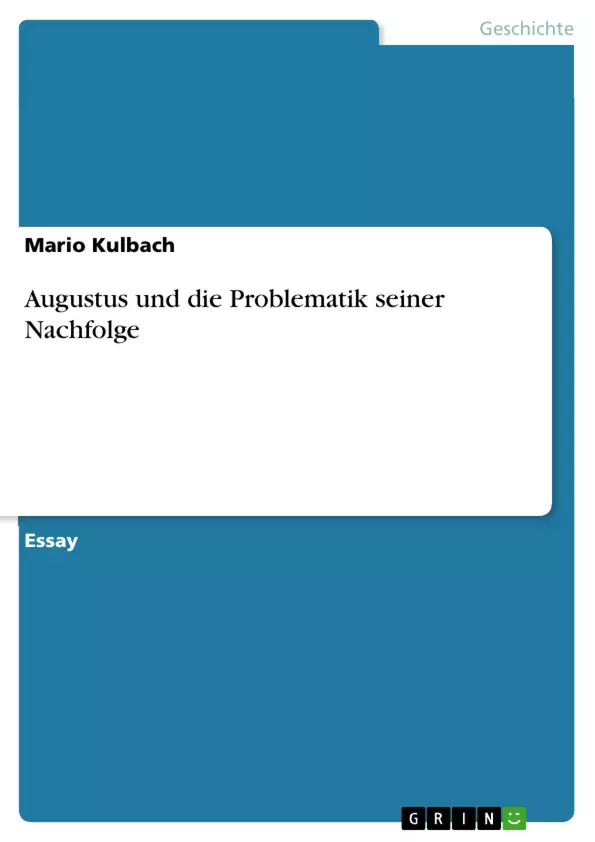Im diesem Aufsatz soll die Problematik der Nachfolgerfindung durch Augustus näher beschrieben werden. Die Frage ist in welcher Hinsicht die Nachfolgerfrage eine besonders schwierige darstellte. Der zeitgenössische Betrachter (d.h. von 63 v. Chr. bis 14 n. Chr.) konnte die Stellung des Augustus nicht prägnant, vor allem noch nicht als Kaiser, zusammenfassen; es gab keine Bezeichnung für seine Macht, seine politischen Möglichkeiten und seine gleichzeitig legale, republikanische Position. Seine Macht beruhte in erster Linie auf verschiedenen Amtsgewalten, die ihm, wie er immer wieder betonte, von Senat und Volk von Rom angetragen wurden, seinem unermesslichem Reichtum und seiner zahlrei-chen Bindungen an Gruppen und Einzelpersonen im ganzen Reich, also das, was man als „auctoritas“ bezeichnen mochte. Aufgrund, dass diese „auctoritas“, also diejenige Macht-quelle, die nicht durch Ämter oder Reichtum, sondern nur durch Beziehungen, Einfluss und Anerkennung durch andere greifbar war, einen erheblichen Teil Augustus´ Macht ausmachte, konnte man diese auch nicht einfach vererben. Eine direkte „Amtsvererbung“ (von einem institutionalisiertem Amt kann wahrlich noch keine Rede sein) konnte natür-lich auch nicht stattfinden, da sich Augustus die jahrelange formale Wahrung der republi-kanischen Gegebenheiten sonst hätte sparen können; es sollte ja gerade nicht so aussehen, als ob er über den Staat verfügte. Also mussten vielmehr der Senat und das Volk von Rom bestimmen, wer die Führung des Gemeinwesens in Händen halten sollte. In diesem Punkt erwies sich Augustus als gekonnter Manipulator, ohne dabei aber die republikanischen Bestimmungen zu verletzen. Mit Hilfe von, durch den Senat immer wieder bewilligter, Privilegien und Ämtern für die Nachfolgekandidaten und der auch öfter durchgeführten öffentlichen Zurschaustellung potentieller Nachfolger, trieb er die Weitervererbung seiner Position in die von ihm angestrebte Richtung. Er war nämlich nicht gewillt seine Stellung im Staat mit seinem Tod enden zu lassen, sondern sie, wie jeder römische Aristokrat, in seiner Familie zu erhalten. Aufgrund dessen ist sein frühzeitiges Bemühen zu erkennen seine Position faktisch weiterzugeben. Doch dieses Bemühen hatte ein garvierendes Problem: Denn Augustus besaß selber keinen leiblichen Sohn, auf den er politische Kompetenzen und familiäre Macht hätte übertragen können. So musste er sich in anderen Richtungen nach einem männlichen Nachfolger umschauen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Marcellus als Nachfolger und die Krise um 23 v. Chr.
- III. Agrippa, die „Caesares\" und Tiberius
- IV. Die „Caesares\" contra Tiberius
- V. Tiberius' Rückkehr und die Begründung der Erbmonarchie
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Problematik der Nachfolgefindung durch Augustus. Er untersucht, warum die Frage nach einem Nachfolger für Augustus besonders schwierig war, und analysiert die Strategien, die Augustus einsetzte, um seine Position innerhalb seiner Familie zu sichern.
- Augustus' "auctoritas" und die Schwierigkeit der Vererbung seiner Macht
- Die Bedeutung der Heiratspolitik für die Nachfolgeplanung
- Die Rolle von Marcellus, Agrippa und den "Caesares" als potenzielle Nachfolger
- Die Position von Tiberius und die Konflikte mit den "Caesares"
- Die Entwicklung der Erbmonarchie unter Augustus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Der Aufsatz führt in die Problematik der Nachfolgefindung durch Augustus ein. Er erläutert, warum die Frage nach einem Nachfolger für Augustus besonders schwierig war, da seine Macht auf verschiedenen Faktoren beruhte, die sich nicht einfach vererben ließen.
II. Marcellus als Nachfolger und die Krise um 23 v. Chr.
Dieses Kapitel beschreibt die Krise, die um 23 v. Chr. entstand, als Augustus in einem labilen gesundheitlichen Zustand war. Es wird die Heirat seiner Tochter Julia mit ihrem Vetter Marcellus analysiert und die Hintergründe für dieses ungewöhnliche Ereignis beleuchtet. Es wird deutlich, dass Augustus bereits zu diesem Zeitpunkt die Notwendigkeit sah, einen Nachfolger zu finden, um seine Position nach seinem Tod zu sichern.
III. Agrippa, die „Caesares\" und Tiberius
Der Aufsatz beleuchtet die Rolle von Marcus Vipsanius Agrippa als langjähriger Weggefährte und treuer Freund des Augustus. Es wird die Bedeutung der "tribunicia potestas" und des "imperium proconsulare" für Agrippa beschrieben, die ihm gleiche Machtbefugnisse wie Augustus verliehen. Es wird die Vermählung Julias mit Agrippa analysiert und die Adoption ihrer Söhne, Gaius Caesar und Lucius Caesar, als potentielle Nachfolger des Augustus beleuchtet. Schließlich wird der Tod Agrippas im Jahr 12 v. Chr. und die daraus resultierende Notwendigkeit beschrieben, die Nachfolgefrage neu zu bewerten.
IV. Die „Caesares\" contra Tiberius
Dieses Kapitel befasst sich mit den "Caesares" und ihrer Rolle als potentielle Nachfolger des Augustus. Es werden die politischen Strategien von Augustus im Umgang mit Tiberius und den "Caesares" beschrieben, um eine geordnete Machtübertragung zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Augustus, Nachfolge, "auctoritas", "tribunicia potestas", "imperium proconsulare", "Caesares", Tiberius, Marcellus, Agrippa, Julia, Heiratspolitik, Erbmonarchie, Prinzipat, Republik, Familie, Dynastie, Machtübertragung, politische Strategie
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Nachfolge von Augustus so problematisch?
Augustus’ Macht basierte auf seiner persönlichen „auctoritas“ und informellen Beziehungen, die rechtlich nicht einfach wie ein Amt vererbt werden konnten.
Hatte Augustus einen leiblichen Sohn als Nachfolger?
Nein, Augustus besaß keinen leiblichen Sohn, weshalb er gezwungen war, durch Adoptionen und Heiratspolitik innerhalb seiner weiteren Familie nach Erben zu suchen.
Welche Rolle spielten die „Caesares“ Gaius und Lucius?
Gaius und Lucius Caesar waren die Söhne seiner Tochter Julia und Agrippa; sie wurden von Augustus adoptiert und als bevorzugte Nachfolger aufgebaut.
Wie sicherte Augustus die Machtübertragung formal ab?
Er ließ dem Senat und dem Volk Privilegien und Ämter (wie die tribunicia potestas) für seine Wunschkandidaten bewilligen, um deren Position zu legitimieren.
Wer wurde schließlich der Nachfolger von Augustus?
Nach dem frühen Tod vieler anderer Kandidaten wurde schließlich Tiberius sein Nachfolger und begründete damit die Erbmonarchie.
- Quote paper
- Mario Kulbach (Author), 2007, Augustus und die Problematik seiner Nachfolge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141118