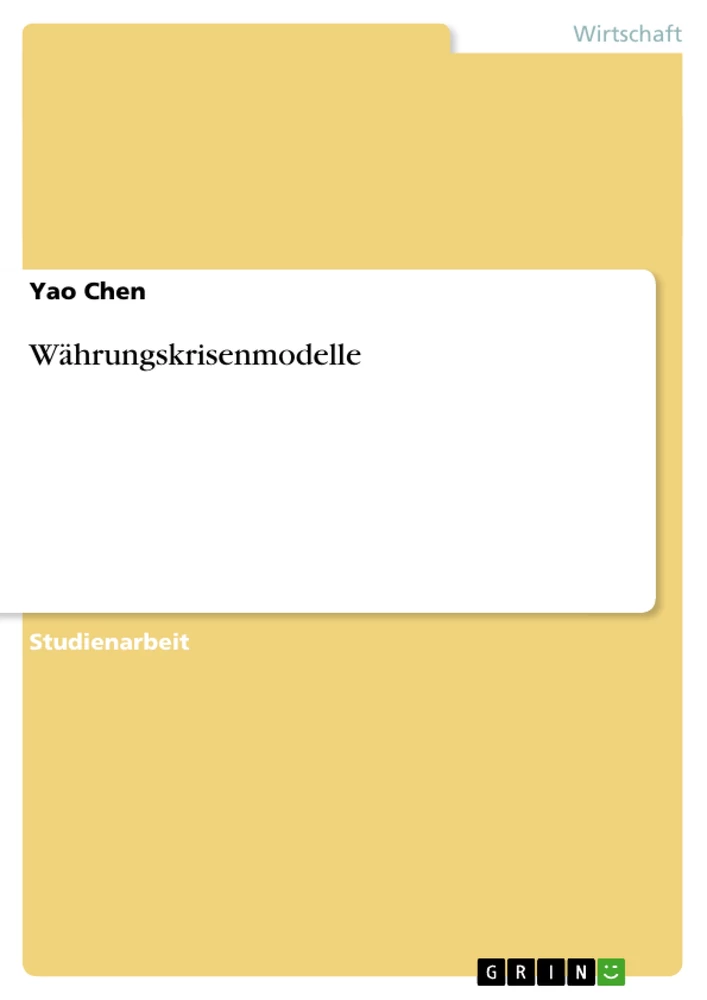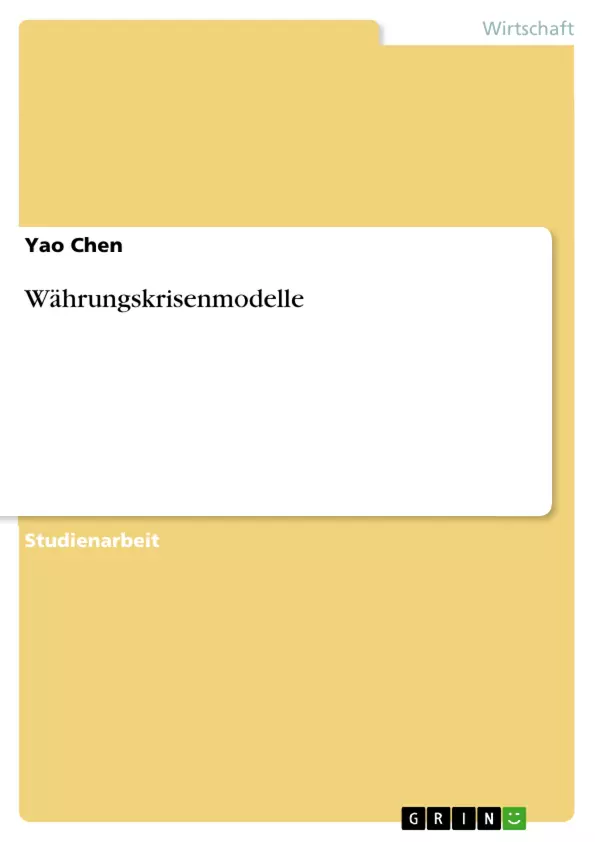Die hohe Aufmerksamkeit, die den Währungskrisen in den letzten Jahren sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Öffentlichkeit widerfährt, kann als ein Beweis für die große Bedeutung dieses Themas für das internationale Finanzsystem gesehen werden. Auch vor dem Hintergrund der heutigen Finanzkrise sind Warnungen bezüglich der Stabilität einiger fixierter, aber auch flexibler, Währungen, sowie Bemühungen der jeweiligen Regierungen zur Verteidigung ihrer heimischen Währungen zu finden. Ziel dieser Seminararbeit ist es, einen Überblick über die Konzepte der drei Währungskrisenmodellgenerationen zu geben, wobei der Schwerpunkt auf den ersten beiden Generationen liegt. Im Kapitel 2 werden wichtige Währungskrisen seit dem Zusammenbruch des Bretton Woods Systems sowie die parallele theoretische Entwicklung der Generationen der Währungskrisenmodelle dargestellt. Danach wird die erste Modellgeneration im Kapitel 3 anhand des Beispiels von Flood und Garber (1984) näher beschrieben. Das Kapitel 4 widmet sich der Erläuterung der zweiten Modellgeneration mit Hilfe des Modells von Obstfeld (1996). Anschließend wird die akademische Debatte zwischen den Vertretern der beiden Generationen über den richtigen Erklärungsansatz im Kapitel 5 geschildert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Währungskrisen und die theoretische Entwicklung der Währungskrisenmodelle
- Modelle der ersten Generation
- Modell von Flood & Garber (1984)
- Implikation und Kritik
- Modelle der zweiten Generation
- Modell von Obstfeld (1996)
- Implikation und Kritik
- Die Debatte: Sind Währungskrisen selbsterfüllend?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit strebt an, einen Überblick über die Entwicklung der Währungskrisenmodelle zu bieten, mit Fokus auf die ersten beiden Generationen. Dabei werden die zentralen Konzepte und Argumente der Modelle beleuchtet, um die Entstehung und die Charakteristika von Währungskrisen zu verstehen.
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Währungskrisen
- Die Rolle von Politik und Markt in Währungskrisen
- Die Bedeutung von Spekulation und Selbstverstärkungseffekten
- Die Frage nach der Selbsteinlösung von Währungskrisen
- Die verschiedenen Generationen von Währungskrisenmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz von Währungskrisen für das internationale Finanzsystem und skizziert die historische Entwicklung des Themas. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Modellgenerationen vorgestellt, welche die Entstehung und die Charakteristika von Währungskrisen zu erklären versuchen. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Modell von Flood und Garber (1984), einem Vertreter der ersten Generation, und analysiert seine Implikationen und Schwächen. Das vierte Kapitel widmet sich dem Modell von Obstfeld (1996), einem Vertreter der zweiten Generation, und untersucht seine Erkenntnisse und Kritikpunkte. Im fünften Kapitel wird die Debatte um den richtigen Erklärungsansatz für Währungskrisen behandelt, wobei die Vertreter der beiden Generationen in ihren Argumentationen gegenübergestellt werden.
Schlüsselwörter
Währungskrisen, Währungskrisenmodelle, Modellgenerationen, Flood & Garber, Obstfeld, Spekulation, Selbstverstärkungseffekte, Fixer Wechselkurs, Floating-Regime, Asienkrise, Finanzkrise
Häufig gestellte Fragen
Was sind Währungskrisenmodelle der ersten Generation?
Diese Modelle (z. B. Flood & Garber 1984) erklären Krisen durch fundamentale Inkonsistenzen in der Wirtschaftspolitik, wie etwa ein hohes Staatsdefizit bei gleichzeitig fixem Wechselkurs.
Was unterscheidet die zweite Generation von der ersten?
Modelle der zweiten Generation (z. B. Obstfeld 1996) betonen selbsterfüllende Erwartungen und multiple Gleichgewichte. Hier kann eine Krise auch ohne fundamentale Schwächen allein durch Spekulation ausgelöst werden.
Sind Währungskrisen immer vorhersehbar?
In Modellen der ersten Generation sind sie oft die logische Folge falscher Politik. In der zweiten Generation sind sie schwerer vorhersehbar, da psychologische Marktfaktoren eine größere Rolle spielen.
Welche Rolle spielt die Spekulation bei Währungskrisen?
Spekulanten testen die Entschlossenheit der Zentralbank, einen Kurs zu verteidigen. Wenn die Kosten der Verteidigung zu hoch werden, bricht das System zusammen, was die Spekulation belohnt.
Was war die Bedeutung des Bretton-Woods-Systems?
Nach dem Zusammenbruch dieses Systems fester Wechselkurse im Jahr 1973 stieg die Volatilität an den Devisenmärkten massiv an, was die Entwicklung theoretischer Krisenmodelle erst notwendig machte.
- Quote paper
- Yao Chen (Author), 2009, Währungskrisenmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141225