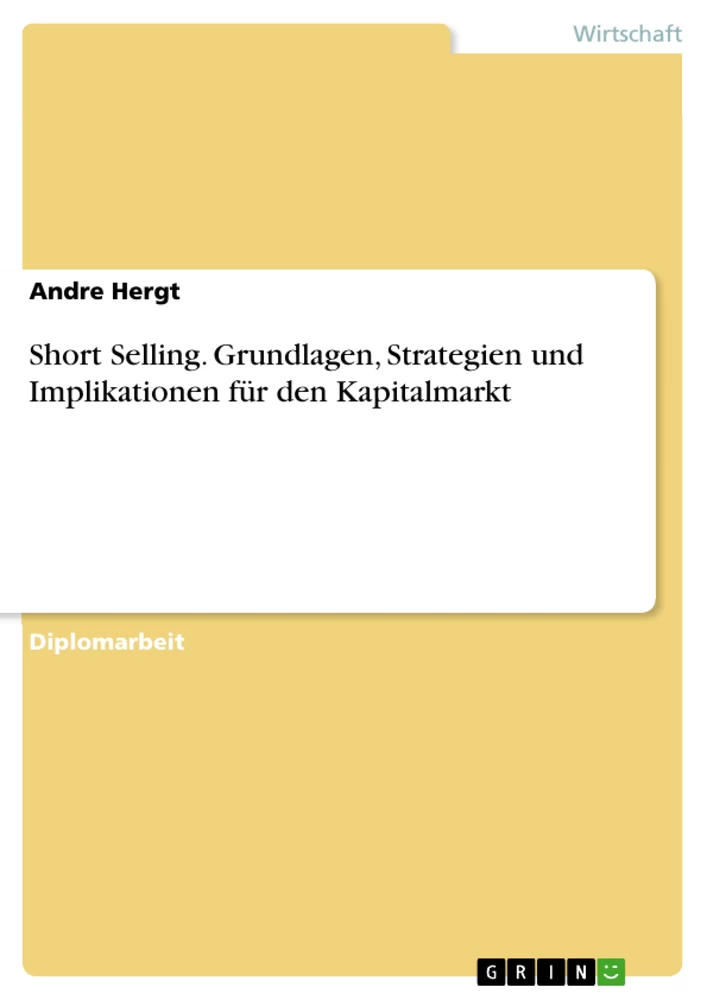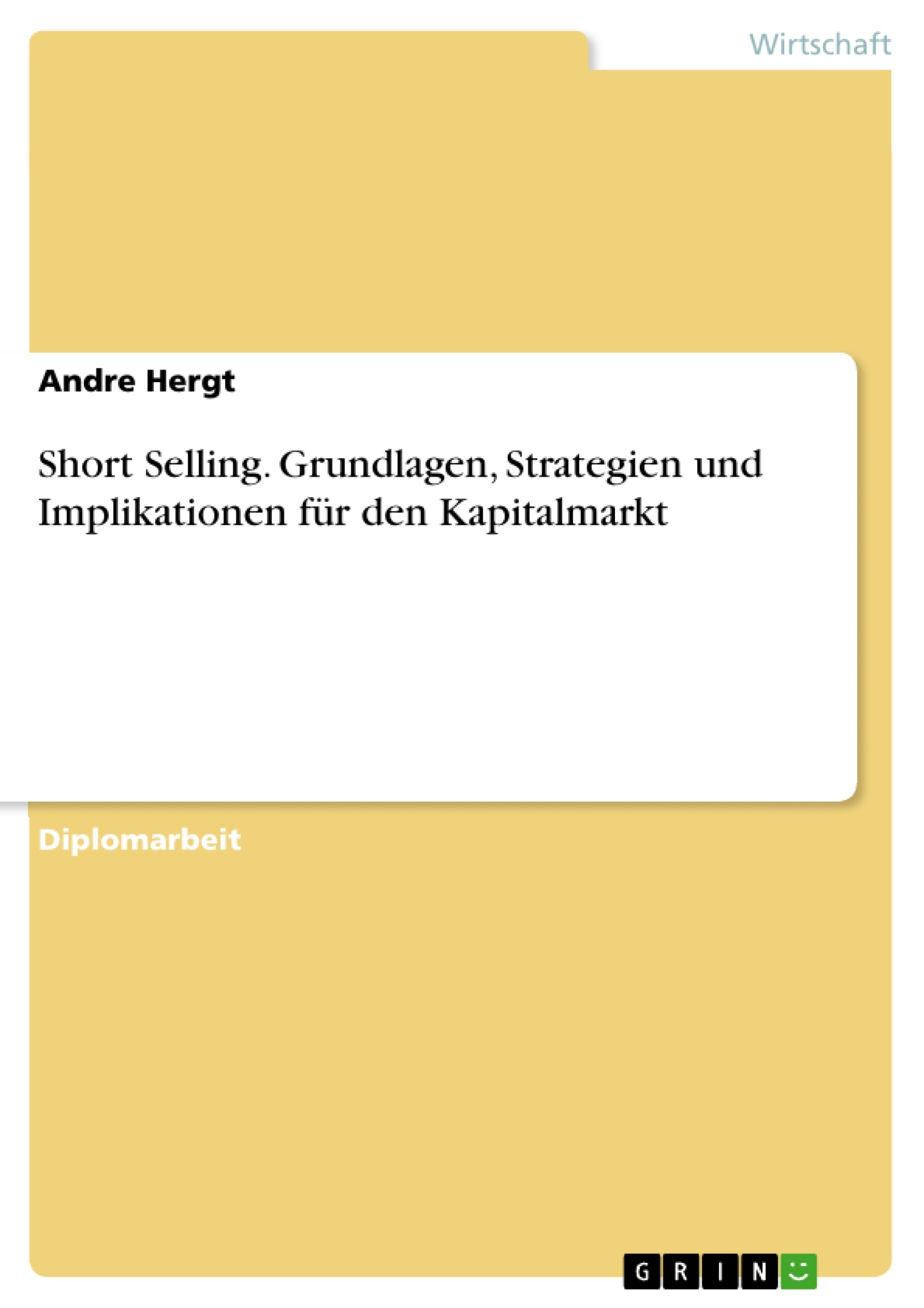Die Konzeption des klassischen Leerverkaufs ist weder hochgradig komplex noch ein Phänomen der jüngeren Vergangenheit. Dennoch wird eine derartige Transaktion von vielen Investoren nach wie vor als intransparent und fragwürdig angesehen. Im Zuge der Ausbreitung der internationalen Finanzkrise im Jahre 2008 sind es vor allem die Aktien-Leerverkäufe, die wiederholt in den Fokus von Öffentlichkeit und Regulierungsbehörden geraten sind. Mitunter werden jene Geschäfte für den Zusammenbruch der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September des gleichen Jahres verantwortlich gemacht.
Während Leerverkäufe in Deutschland bis dato ausschließlich als ein charakteristisches und spekulatives Instrument von Hedge-Fonds wahrgenommen wurden, so gaben Marktbeobachter ihnen nun eine Mitschuld an den drastischen Kursverlusten ausgewählter Finanzdienstleister. Neben bereits bestehenden Regularien sahen sich die zuständigen Aufsichtsbehörden weltweit dazu veranlasst, weitere Leerverkaufsbeschränkungen zu implementieren, um die Stabilität der internationalen Kapitalmärkte zu gewährleisten.
Insbesondere die sogenannten „ungedeckten Leerverkäufe“ können nach Ansicht der Regulierungsbehörden zur Manipulation von Marktpreisen eingesetzt werden und damit erhebliche Nachteile für den gesamten Finanzmarkt bewirken. Entgegen dieser Betrachtungsweise sehen viele Marktteilnehmer und Ökonomen in der Möglichkeit des Leerverkaufs ein notwendiges Instrumentarium für die Funktionsfähigkeit der globalen Kapitalmärkte. Sowohl bei der praktischen Umsetzung unterschiedlicher Handelsstrategien als auch im Hinblick auf die Theorie effizienter Kapitalmärkte wird der Einsatz von Leerverkäufen als unverzichtbar angesehen.
Vor dem Hintergrund dieser Thematik stellt sich primär die Frage, inwieweit Investoren mittels Short Selling überhaupt an den Wertveränderungen der veräußerten Wertpapiere partizipieren können, und welche Rahmenbedingungen für die Durchführung von Leerverkäufen in der Praxis erfüllt sein müssen. In diesem Zusammenhang gilt es, sich auch mit den verschiedenen Marktleih-Systemen für Wertpapiere auseinanderzusetzen. Die Anwendung der „Wertpapierleihe“ ist nicht nur für den traditionellen Leerverkauf am Kassamarkt rechtlich wie technisch eine Grundvoraussetzung, sondern bietet darüber hinaus in ihren vielseitigen Ausgestaltungsformen weitere Einsatzmöglichkeiten für die Marktteilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Short Selling als Handelsstrategie
- 2.1 Der traditionelle Leerverkauf
- 2.2 Abwicklung von Leerverkaufstransaktionen
- 2.3 Risikomanagement beim Short Selling
- 3 Securities Lending and Borrowing
- 3.1 Die Wertpapierleihe im weiteren Sinne
- 3.2 Wertpapierleihe im engeren Sinne (Wertpapierdarlehen)
- 3.3 Repurchase Agreement (Wertpapierpensionsgeschäft)
- 3.4 Sell/Buy Back-Transaktion
- 4 Synthetische Leerverkäufe
- 4.1 Optionsstrategien
- 4.2 Single Stock Futures (SSFs)
- 4.3 Contracts for Difference (CFDs)
- 5 Naked Short Selling: Ungedeckte Leerverkäufe
- 5.1 Definition eines ungedeckten Leerverkaufs
- 5.2 Marktmanipulation im elektronischen Handelsverkehr
- 5.3 Naked Short Selling eine reale Gefahr?
- 6 Leerverkaufsrestriktionen in der Praxis
- 6.1 Uptick Rule
- 6.2 Circuit Breaker
- 6.3 Leerverkaufsverbote
- 7 Short Selling im Lichte der Kapitalmarkteffizienz
- 7.1 Efficient Market Hypothesis
- 7.2 Der Effizienzbeitrag von Leerverkäufen
- 7.3 Leerverkäufe im Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- 8 Zusammenfassung und Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Short Selling, seine Strategien und Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Ziel ist es, die Grundlagen des Leerverkaufs zu erläutern, verschiedene Strategien zu analysieren und die Implikationen für die Kapitalmarktstabilität zu beleuchten.
- Grundlagen des traditionellen und synthetischen Short Selling
- Risikomanagement und -kontrolle beim Short Selling
- Der Einfluss von Short Selling auf die Kapitalmarkteffizienz
- Leerverkaufsrestriktionen und deren Auswirkungen
- Marktmanipulation durch Naked Short Selling
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Short Selling ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es beschreibt die Bedeutung des Leerverkaufs für den Kapitalmarkt und stellt die Forschungsfragen vor, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel, indem sie den Kontext und die Relevanz des Themas herausarbeitet. Die Bedeutung von Short Selling als Mechanismus zur Preisfindung und Risikosteuerung wird angedeutet, um die Motivation für die tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema zu begründen.
2 Short Selling als Handelsstrategie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Short Selling als Handelsstrategie. Es erläutert den traditionellen Leerverkauf, einschließlich der Spekulation auf fallende Kurse, des Hedgings von Risiken und von Arbitragestrategien. Weiterhin wird die Abwicklung von Leerverkaufstransaktionen detailliert beschrieben, einschließlich der Rolle von Brokern, Margin Accounts und Rebate Rates. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Risikomanagement, wobei Buy-In/Recall-Risiken und Short Squeezes, illustriert am Beispiel der VW-Aktie, ausführlich behandelt werden. Der Short Interest und die SI-Ratio werden als wichtige Kennzahlen im Risikomanagement eingeführt.
3 Securities Lending and Borrowing: Kapitel 3 widmet sich dem Thema Securities Lending and Borrowing, wobei zwischen der Wertpapierleihe im weiteren und engeren Sinne differenziert wird. Es werden verschiedene Arten von Wertpapierdarlehen (besichert und unbesichert) erklärt und die Determinanten der Leihgebühr analysiert. Die Motivation der Vertragsparteien wird beleuchtet, und das Repurchase Agreement (Repo-Geschäft) wird ausführlich behandelt, einschließlich der Unterscheidung zwischen echten und unechten Pensionsgeschäften. Schließlich wird die Sell/Buy-Back-Transaktion als weitere Form des Wertpapierleihgeschäfts erklärt und in den Kontext eingeordnet.
4 Synthetische Leerverkäufe: In diesem Kapitel werden synthetische Leerverkäufe als Alternative zum traditionellen Leerverkauf vorgestellt. Es werden verschiedene Strategien zur Erzielung eines synthetischen Short Exposures erläutert, darunter der Einsatz von Optionen (Short Call und Long Put), Single Stock Futures (SSFs) und Contracts for Difference (CFDs). Für jede Strategie werden die Mechanismen, Risiken und Vorteile detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der Funktionsweise der synthetischen Short-Positionen und der Vergleich zu traditionellen Leerverkäufen.
5 Naked Short Selling: Ungedeckte Leerverkäufe: Kapitel 5 befasst sich mit dem riskanten Thema des Naked Short Selling, definiert als der Leerverkauf ohne vorherige Sicherung der Aktie. Es analysiert die potenzielle Marktmanipulation durch ungedeckte Leerverkäufe im Kontext des elektronischen Handels und des Clearing- und Settlement-Systems. Die Rolle von automatischen Wertpapierleihprogrammen und regulatorische Lücken, insbesondere in den USA, werden kritisch beleuchtet. Abschließend wird die Frage nach der realen Gefahr von Naked Short Selling anhand empirischer Erkenntnisse diskutiert.
6 Leerverkaufsrestriktionen in der Praxis: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Maßnahmen zur Regulierung von Short Selling. Es beschreibt die Uptick Rule, Circuit Breaker und Leerverkaufsverbote und analysiert deren Wirksamkeit und Auswirkungen auf die Marktliquidität und Preisbildung. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Ansätze zur Regulierung von Leerverkäufen und deren jeweiliger Rechtfertigung.
7 Short Selling im Lichte der Kapitalmarkteffizienz: Kapitel 7 untersucht die Beziehung zwischen Short Selling und der Kapitalmarkteffizienz. Es beginnt mit einer Erläuterung der Efficient Market Hypothesis und analysiert den Beitrag von Leerverkäufen zur Bewertungseffizienz und Preisstabilität. Die Auswirkungen von Short Selling auf die Liquidität und Markttiefe werden diskutiert. Schließlich wird das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und seine Modifikationen im Zusammenhang mit Short Selling untersucht. Hierbei wird die Integration von Short Selling in das Standard CAPM sowie in Zero-Beta CAPM nach Black und das CAPM bei positiver Zinsspanne erörtert.
Schlüsselwörter
Short Selling, Leerverkauf, Securities Lending, Wertpapierleihe, Synthetischer Leerverkauf, Naked Short Selling, Risikomanagement, Kapitalmarkteffizienz, Marktmanipulation, Regulierung, Uptick Rule, Circuit Breaker, Leerverkaufsverbote, CAPM.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diplomarbeit über Short Selling
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht umfassend das Thema Short Selling (Leerverkauf), seine verschiedenen Strategien, seine Auswirkungen auf den Kapitalmarkt und die damit verbundenen Risiken und Regulierungen. Die Arbeit analysiert traditionelle und synthetische Leerverkäufe, beleuchtet die Rolle des Risikomanagements und untersucht den Einfluss von Short Selling auf die Kapitalmarkteffizienz.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter der traditionelle Leerverkauf, die Abwicklung von Leerverkaufstransaktionen, Risikomanagement (inkl. Short Squeezes und Buy-In/Recall-Risiken), Securities Lending and Borrowing (Wertpapierleihe), synthetische Leerverkäufe (mit Optionen, SSFs und CFDs), Naked Short Selling (ungedeckte Leerverkäufe) und Marktmanipulation. Zusätzlich werden Leerverkaufsrestriktionen (Uptick Rule, Circuit Breaker, Leerverkaufsverbote) und die Beziehung zwischen Short Selling und der Kapitalmarkteffizienz (inkl. CAPM) untersucht.
Welche Arten von Short Selling werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen dem traditionellen Leerverkauf, synthetischen Leerverkäufen und ungedeckten Leerverkäufen (Naked Short Selling). Synthetische Leerverkäufe werden anhand von Optionen, Single Stock Futures (SSFs) und Contracts for Difference (CFDs) erläutert. Die jeweiligen Mechanismen, Risiken und Vorteile jeder Strategie werden detailliert dargestellt.
Wie wird das Risikomanagement beim Short Selling behandelt?
Die Arbeit widmet dem Risikomanagement beim Short Selling einen erheblichen Teil. Sie behandelt Buy-In/Recall-Risiken und Short Squeezes ausführlich, unter anderem am Beispiel der VW-Aktie. Wichtige Kennzahlen wie der Short Interest und die SI-Ratio werden im Kontext des Risikomanagements eingeführt.
Welche Rolle spielt die Kapitalmarkteffizienz?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Short Selling auf die Kapitalmarkteffizienz. Sie erläutert die Efficient Market Hypothesis und analysiert den Beitrag von Leerverkäufen zur Bewertungseffizienz und Preisstabilität. Die Auswirkungen auf die Liquidität und Markttiefe sowie die Integration von Short Selling in das Capital Asset Pricing Model (CAPM) werden diskutiert.
Wie werden Leerverkaufsrestriktionen behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene Maßnahmen zur Regulierung von Short Selling, darunter die Uptick Rule, Circuit Breaker und Leerverkaufsverbote. Die Wirksamkeit und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Marktliquidität und Preisbildung werden kritisch bewertet.
Was ist Naked Short Selling und welche Gefahren birgt es?
Naked Short Selling wird als der Leerverkauf ohne vorherige Sicherung der Aktie definiert. Die Arbeit analysiert das damit verbundene Risiko der Marktmanipulation, insbesondere im Kontext des elektronischen Handels. Die Rolle von automatischen Wertpapierleihprogrammen und regulatorische Lücken werden diskutiert, und die Frage nach der realen Gefahr von Naked Short Selling wird anhand empirischer Erkenntnisse untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Die folgenden Kapitel behandeln sukzessive die Grundlagen des Short Selling, Securities Lending, synthetische Leerverkäufe, Naked Short Selling, Leerverkaufsrestriktionen und den Einfluss von Short Selling auf die Kapitalmarkteffizienz. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Würdigung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Zu den wichtigsten Schlüsselwörtern gehören: Short Selling, Leerverkauf, Securities Lending, Wertpapierleihe, Synthetischer Leerverkauf, Naked Short Selling, Risikomanagement, Kapitalmarkteffizienz, Marktmanipulation, Regulierung, Uptick Rule, Circuit Breaker, Leerverkaufsverbote, CAPM.
- Quote paper
- Andre Hergt (Author), 2009, Short Selling. Grundlagen, Strategien und Implikationen für den Kapitalmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141280