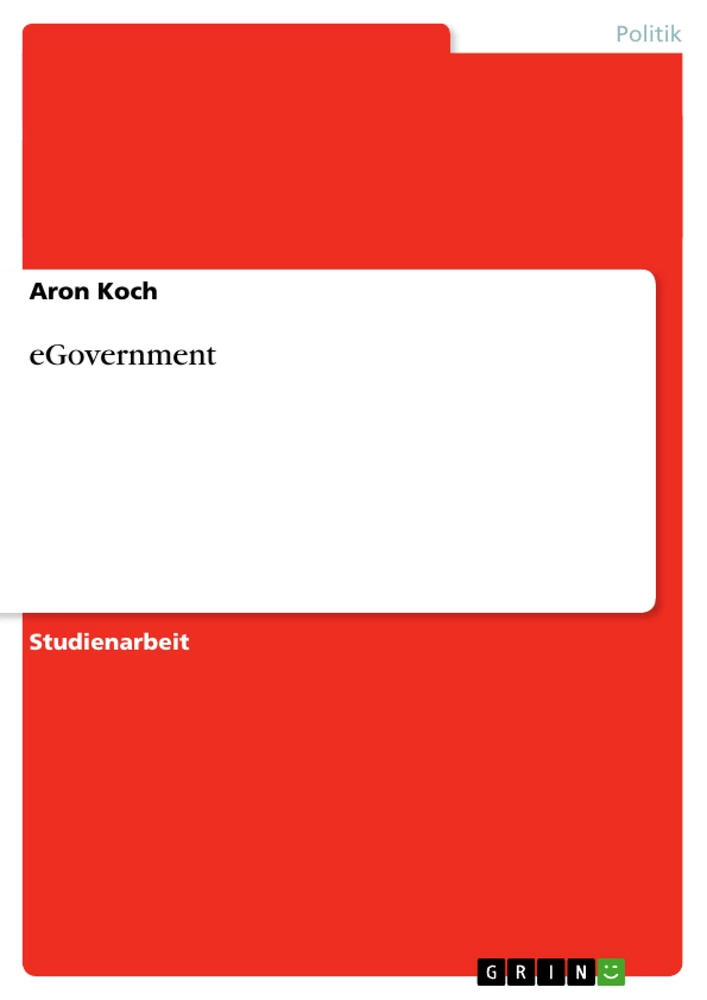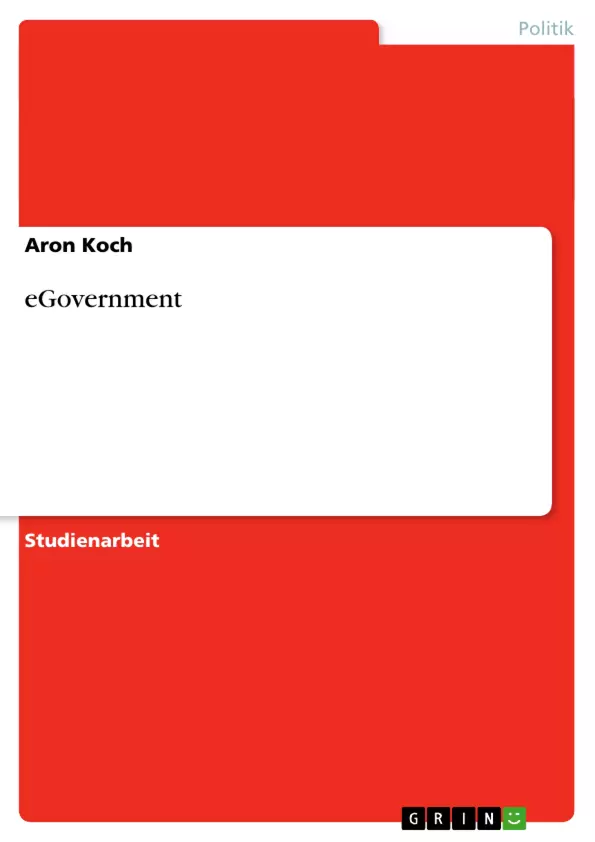Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet neue Möglichkeiten des Informationsaustausches und der wirtschaftlichen Betätigung. Warenbestellungen, Zahlungsanweisungen an Banken, die Übermittlung sensibler Daten, Anträge oder Einsprüche bei Behörden und eine Vielzahl weiterer Kommunikationsbeziehungen, die in der Vergangenheit über Papier abgewickelt wurden, erfolgen mittlerweile auf elektronischem Wege. Dabei konnte bisher die Rechtsverbindlichkeit nicht immer gewährleistet werden.
Auch auf Seiten des Staates werden die Potenziale dieser neuen Techniken im Rahmen der Implementierung von eGovernment und der damit verbundenen Modernisierung der Verwaltungen umgesetzt. Dies hat aufgrund knapper öffentlicher Kassen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, einen großen Anreiz für die staatliche Verwaltung. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat im September 2000 die eGovernment-Initiative „BundOnline 2005“ gestartet und die Bundesverwaltung verpflichtet, ihre über 350 internetfähigen Dienstleistungen bis zum Jahr 2005 online bereit zu stellen. Seit Ende 2002 werden bereits mehr als 160 Dienstleistungen der Verwaltung online angeboten. Unter Koordination des Bundesministeriums des Innern (BMI) wurden ein Umsetzungsplan erstellt und Basiskomponenten definiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick
- Entstehung
- Definition
- Anwendungsbereiche des eGovernment
- Regulierendes und Partizipierendes eGovernment
- Begriffshierarchie eGovernment
- eProcurement
- eOrganisation
- eAssistance
- eAdministration
- eDemocracy
- Interaktionsgrad
- Voraussetzungen für den Einsatz
- Rechtliche Voraussetzungen
- Emotionale Voraussetzungen
- Technische Voraussetzungen
- Architekturbaukasten für eGovernment - Anwendungen
- Praxisbeispiele in Deutschland
- Was will die Bevölkerung?
- Grundlegende Ziele
- Aktueller Stand der Umsetzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzept des eGovernment und beleuchtet dessen Entstehung, Definition, Anwendungsbereiche und Voraussetzungen. Dabei werden verschiedene Aspekte des eGovernment, wie die hierarchische Struktur und der Interaktionsgrad, analysiert und in Bezug auf die Praxis in Deutschland gesetzt.
- Entstehung und Entwicklung des eGovernment
- Definition und Anwendungsbereiche des eGovernment
- Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung von eGovernment
- Beispiele für die Anwendung von eGovernment in Deutschland
- Regulierendes und Partizipierendes eGovernment
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Entwicklung des eGovernment, beschreibt dessen Entstehung und definiert den Begriff. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Anwendungsbereiche des eGovernment untersucht, wobei der Fokus auf der Begriffshierarchie, dem Interaktionsgrad und der Unterscheidung zwischen regulierendem und partizipierendem eGovernment liegt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für den Einsatz von eGovernment, indem rechtliche, emotionale und technische Aspekte beleuchtet werden. Das vierte Kapitel stellt einen Architekturbaukasten für eGovernment-Anwendungen vor, während das fünfte Kapitel Praxisbeispiele in Deutschland betrachtet, einschließlich der Bevölkerungswünsche, grundlegender Ziele und des aktuellen Umsetzungsstandes.
Schlüsselwörter
eGovernment, Informations- und Kommunikationstechnik, Verwaltung, Modernisierung, Online-Dienste, Bürgerfreundlichkeit, Interaktion, Rechtliche Voraussetzungen, Technische Voraussetzungen, Praxisbeispiele, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter eGovernment?
eGovernment bezeichnet die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik zur Modernisierung der Verwaltung und zur Bereitstellung staatlicher Dienstleistungen auf elektronischem Wege.
Was war das Ziel der Initiative „BundOnline 2005“?
Die Initiative verpflichtete die Bundesverwaltung, bis zum Jahr 2005 über 350 internetfähige Dienstleistungen online zur Verfügung zu stellen.
Welche Anwendungsbereiche gibt es im eGovernment?
Die Arbeit unterscheidet Bereiche wie eProcurement, eAdministration, eDemocracy, eOrganisation und eAssistance sowie zwischen regulierendem und partizipierendem eGovernment.
Welche Voraussetzungen müssen für eGovernment erfüllt sein?
Es müssen rechtliche (z.B. Rechtsverbindlichkeit), technische und emotionale Voraussetzungen (Akzeptanz in der Bevölkerung) erfüllt werden.
Warum ist eGovernment für den Staat attraktiv?
Hauptgründe sind knappe öffentliche Kassen sowie die notwendige Anpassung an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen durch Verwaltungsmodernisierung.
- Quote paper
- Aron Koch (Author), 2003, Die Anwendungsbereiche und Voraussetzungen des eGovernments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14128