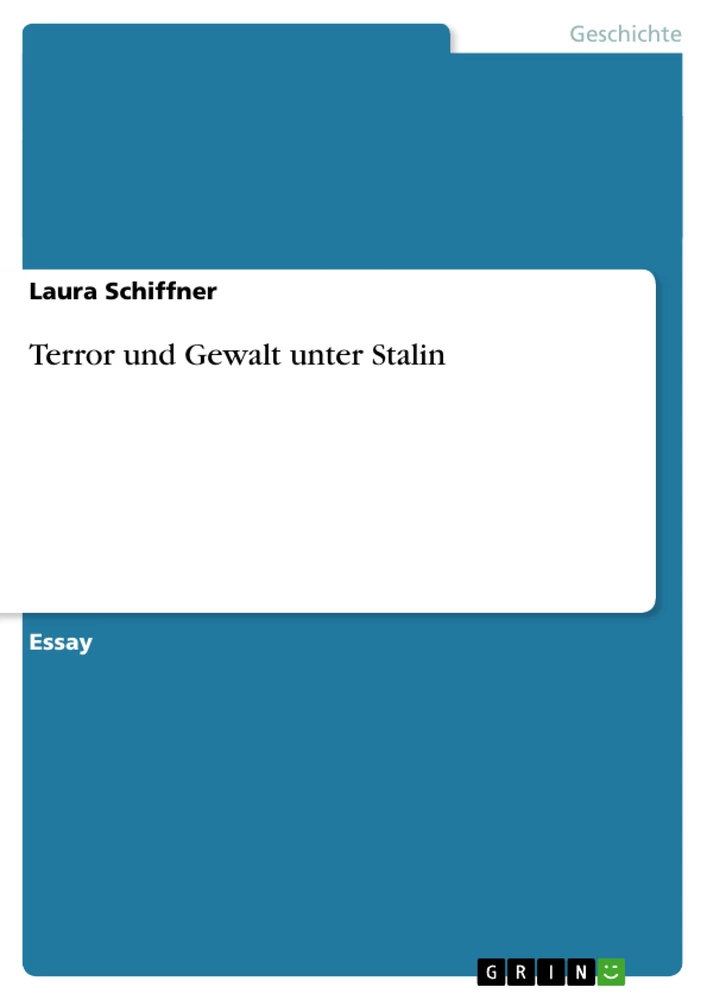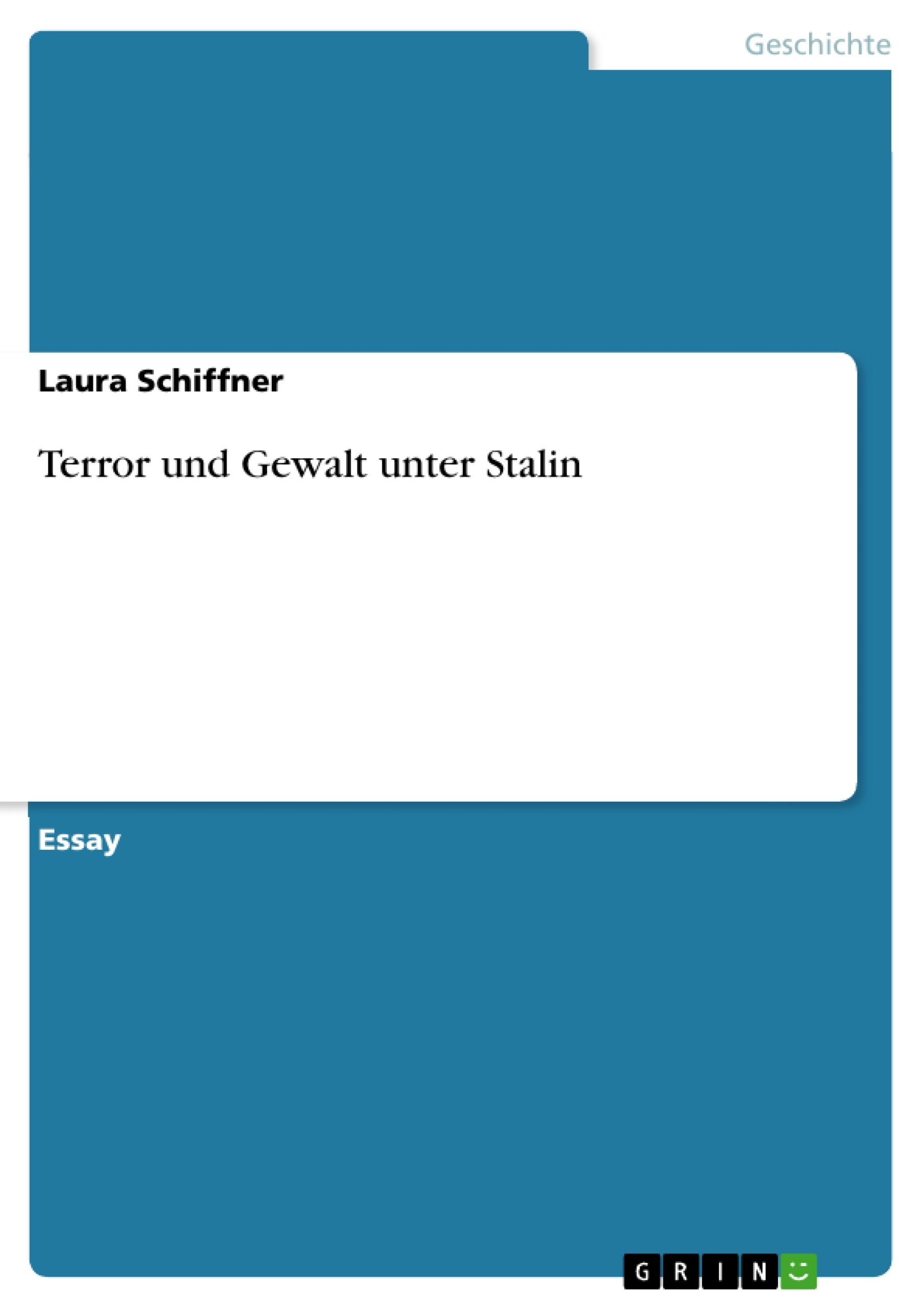„Als Stalin am 5. März 1953 starb, endete auch der beinahe dreißigjährige Ausnahmezustand, den er und seine Gefolgsleute über die Sowjetunion verhängt hatten.“ (Baberowski, Jörg: Der rote Terror, Die Geschichte des Stalinismus, Bonn 2007, S. 7.) Der Ausnahmezustand, den Baberowski in seiner Monographie beschreibt, meint den bewussten Terror und die maßlose Gewalt, welche seit der Machtergreifung der Bolschewiki im Oktober 1917 in der Sowjetunion herrschten. Es stellt sich zum Einen die Frage, wie und warum er so viel Gewalt über das Land bringen konnte. War er doch in der öffentlichen Wahrnehmung ein freundlicher, aber zynischer Mann. Zum Anderen muss ergründet werden, wie es Stalin gelungen war, an die Spitze der Macht zu gelangen. Dazu ist es zunächst notwendig, die historischen Ereignisse und die politische Entwicklung jenes großen Landes in dieser Zeit zu betrachten, die ausschlaggebend Stalin den Weg zur Macht ebneten. Mit dem heutigen Geschichtsverständnis ist der Stalinismus ohne seinen Namensgeber nicht denkbar. Für das Verstehen des Stalinismus` muss insofern seine Biografie und besonders seine „politische Karriere“ untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Terror und Gewalt unter Stalin
- Die Machtübernahme Stalins
- Der Ausnahmezustand
- Die „Neue Ökonomische Politik“ (NEP)
- Die kriegerische Sprache der Bolschewiki
- Stalins Biografie und Persönlichkeit
- Stalins Aufstieg zur Macht
- Stalins „Networking“ und die Eliminierung von Gegnern
- Die Exzesse der Kollektivierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert die Verwendung von Terror und Gewalt unter der Herrschaft von Joseph Stalin in der Sowjetunion. Der Essay untersucht die Gründe für Stalins Machtübernahme und die Entstehung eines Ausnahmezustands, der die Sowjetunion über Jahrzehnte prägte.
- Stalins Biografie und die Prägung seiner Persönlichkeit durch Gewalt
- Die Entwicklung des Terrorregimes und seine Auswirkungen auf die Sowjetgesellschaft
- Die „Neue Ökonomische Politik“ (NEP) und ihre Folgen
- Stalins Machtpolitik und die Eliminierung von Gegnern
- Die Rolle der Kollektivierung in der Stalinschen Diktatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer Einführung in die Thematik Terror und Gewalt unter Stalin und stellt die zentrale Frage nach den Gründen für Stalins Machtübernahme und die Entstehung des Ausnahmezustands in der Sowjetunion.
- Im zweiten Kapitel wird die Machtübernahme Stalins beleuchtet, wobei die Rolle der Bolschewiki und die Entwicklung der Sowjetunion nach der Oktoberrevolution beschrieben werden.
- Das dritte Kapitel beschreibt den Ausnahmezustand, der sich unter Stalins Herrschaft etablierte und die Sowjetgesellschaft prägte. Es werden die verschiedenen repressiven Maßnahmen der Regierung, die Gewalt und der Terror beschrieben.
- Das vierte Kapitel analysiert die „Neue Ökonomische Politik“ (NEP) und ihre Folgen für die Sowjetgesellschaft. Die Einführung des Marktes und die Entstehung sozialer Ungleichheiten werden diskutiert.
- Das fünfte Kapitel befasst sich mit der kriegerischen Sprache der Bolschewiki, die Terror und Gewalt als Mittel zur Durchsetzung des Sozialismus rechtfertigte. Der Aufstand in Kronstadt und die Verfolgung von Gegnern werden beleuchtet.
- Das sechste Kapitel untersucht Stalins Biografie und Persönlichkeit. Es werden seine Kindheitserfahrungen, seine Machtgier und seine Methoden zur Durchsetzung seiner Ziele beschrieben.
- Im siebten Kapitel wird Stalins Aufstieg zur Macht analysiert. Seine strategischen Vorgehensweisen, die Eliminierung von Gegnern und die Rolle des Politbüros werden beleuchtet.
- Das achte Kapitel befasst sich mit Stalins „Networking“ und der Ausschaltung von politischen Gegnern. Seine Strategien zur Sicherung der Macht und die Ausspielung von Oppositionsgruppen werden dargestellt.
- Das neunte Kapitel beschreibt die Exzesse der Kollektivierung und die Rolle von Stalins Gefolgsleuten bei der Durchsetzung der Politik. Es wird die Brutalität der Kollektivierungspolitik und die Folgen für die Bevölkerung dargestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieses Essays sind: Stalinismus, Terror, Gewalt, Machtübernahme, Ausnahmezustand, „Neue Ökonomische Politik“ (NEP), Kollektivierung, Politbüro, Bolschewiki, Sowjetunion, Diktatur.
Häufig gestellte Fragen
Wie kam Joseph Stalin an die Macht?
Stalin nutzte geschicktes Networking innerhalb des Politbüros, besetzte Schlüsselpositionen mit Gefolgsleuten und eliminierte systematisch politische Gegner wie Trotzki.
Was kennzeichnete den Terror unter Stalin?
Der Stalinismus war geprägt durch maßlose Gewalt, Schauprozesse, Deportationen und einen bewussten Ausnahmezustand, der die gesamte Sowjetunion über Jahrzehnte im Griff hielt.
Was waren die Folgen der Kollektivierung?
Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft führte zu extremer Brutalität gegenüber der Bauernschaft, Hungersnöten und der Zerstörung traditioneller Dorfstrukturen.
Welche Rolle spielte die „Neue Ökonomische Politik“ (NEP)?
Die NEP war eine vorübergehende Liberalisierung. Stalin beendete sie, um eine radikale Industrialisierung und staatliche Kontrolle durchzusetzen, was den Terror verschärfte.
Wie wird Stalins Persönlichkeit in der Forschung beschrieben?
Er galt als zynisch und machtgierig. Seine Biografie zeigt, dass er Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung politischer Ideale und zur Sicherung seiner Diktatur betrachtete.
- Arbeit zitieren
- Laura Schiffner (Autor:in), 2009, Terror und Gewalt unter Stalin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141360