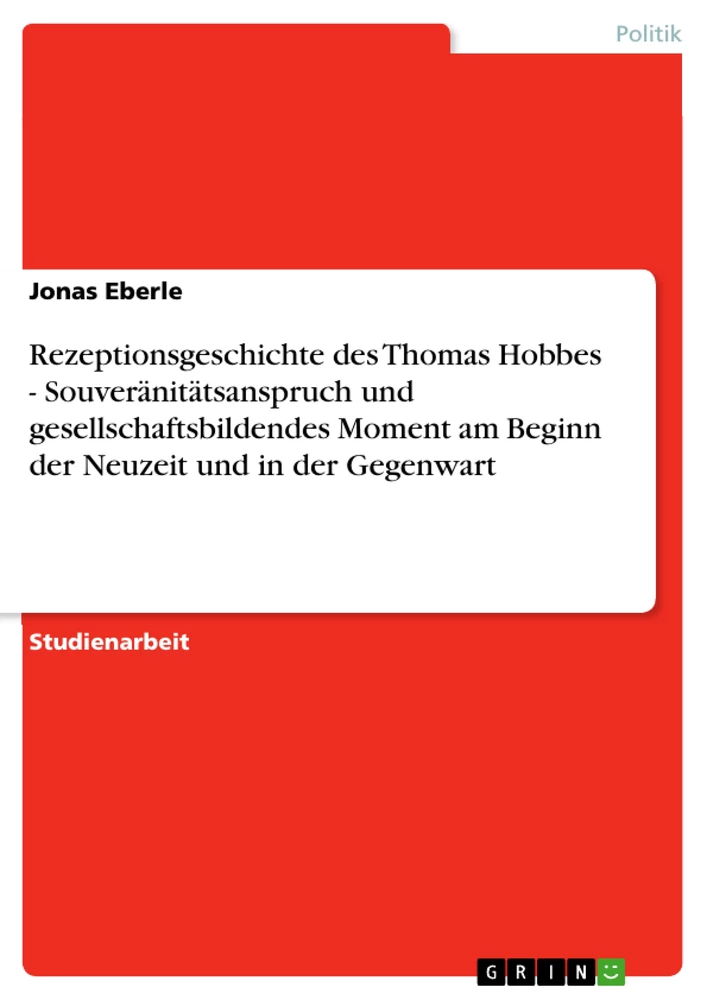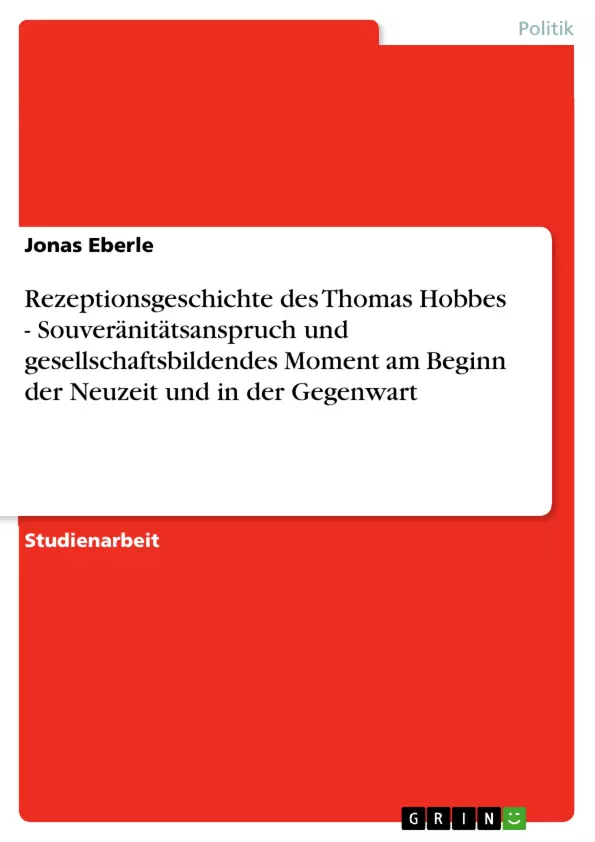Diese Arbeit soll anhand einer Auswahl einiger Autoren, die Hobbes direkt oder indirekt rezipierten, zum Verständnis Hobbesscher Ideen beitragen und in einer historisch-kritischen Herangehensweise die Auseinandersetzung mit seinen Werken zu seinen Lebzeiten wie in der jüngeren Vergangenheit untersuchen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit versucht diese Arbeit durch die Beobachtung ebenjener Auseinandersetzung Relevantes zu Tage zu fördern. Das Augenmerk wird dabei auf den Rezeptionslinien liegen, die seine in „De Cive“ und „Leviathan“ erfassten Hauptthesen – das vernunftbasierte Zustandekommen eines gesellschaftsbildenden Moments durch einen violenten Kriegszustand und die Einsetzung eines unumschränkten Souveräns zur Lösung der virulenten Konflikte um Eigentum und Leben und zur Kanalisierung des individuellen Egoismus.
Thomas Hobbes wurde im Jahre 1588 als Sohn eines Geistlichen geboren. Nach dem Besuch der Privatschule, setzte Thomas Hobbes seinen Bildungsweg als Student am Magdalen College fort, welches er 1607 als Baccalaureus artium abschloss.
Ab 1608 arbeitete Thomas Hobbes als Hofmeister beim Hofe des Barons Cavendish, dabei kam es zur ausführlichen Beschäftigung mit der Geschichte der Peleponnesischen Krieges und der Idee, inspiriert von Euklid, die „Menschen wie Geometrie zueinander in Verbindung zu setzen“. Dies ist der Kern des Hobbesschen Gesellschaftsbildes. Das Individuum als Atom der Gesellschaft zu sehen, begründet das affektionskausale Modell des materialistischen Menschenbildes.
Hobbes beschäftigt sich eingehend mit der klassischen (Moral-) Philosophie und deren Kategorien Gerechtigkeit und Tugend, und versucht sie beständig zu widerlegen.
Er publiziert 1640 des Pamphlet “The Elements of Law”. Schon hier ergreift er die absolutistische Option als Lösung des Konflikts konkurriender Gesellschaftsgruppen. Er flieht aus Angst vor dem provozierten Parlament nach Frankreich.
Erst 1651, nachdem Cromwell die Macht ergriffen, das Parlament entmachtet und König Karl I hingerichtet hatte, kehrt Hobbes nach England zurück. Das Hauptwerk des Philosophen – der „Leviathan“ – und seine umfassende Abhandlung über den Bürger („De Cive“) erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. 17. und 18. Jahrhundert – Kritik und verdeckte Rezeption
- II.1. Benedict Baruch Spinoza – rationalistische Bibelkritik
- II.2. John Locke - das naturrechtliche Eigentum
- II.3. Jean-Jacques Rousseau – Kritik des negativen Menschenbildes
- III. 20. Jahrhundert Erstarken des Kontraktualismus und Entwicklung zweier Hauptinterpretationsstränge
- III.1. James Buchanan, John Rawls und Robert Nozick - Sozialphilosophie nach Hobbes
- III.2. Zwei Interpretationsansätze der Hobbes-Rezeption
- IV. Schluss und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit soll die Rezeption der Ideen von Thomas Hobbes im Laufe der Geschichte beleuchten und anhand ausgewählter Autoren, die sich direkt oder indirekt mit seinem Werk auseinandersetzten, ein tieferes Verständnis seiner Schriften fördern. Der Fokus liegt dabei auf den Rezeptionslinien, die sich mit den zentralen Thesen des Hobbesschen Gesellschaftsbildes auseinandersetzen, insbesondere die Begründung des Gesellschaftsbildenden Moments durch einen gewalttätigen Naturzustand und die Notwendigkeit eines absoluten Souveräns zur Bewältigung von Konflikten und zur Kanalisierung des individuellen Egoismus.
- Die Kritik und verdeckte Rezeption der Gedanken von Thomas Hobbes im 17. und 18. Jahrhundert.
- Die Weiterentwicklung des Kontraktualismus im 20. Jahrhundert und die Entstehung von zwei Hauptinterpretationssträngen der Hobbes-Rezeption.
- Das Verhältnis von Hobbes' Ideen zum Gesellschaftsbild und der politischen Philosophie im Wandel der Zeit.
- Der Einfluss von Hobbes' Werk auf die Debatten über Staatsgewalt und Individuum.
- Die Relevanz der Hobbesschen Konzepte in der Gegenwart.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Arbeit und ihre Zielsetzung vor. Es gibt einen kurzen Überblick über das Leben und Werk von Thomas Hobbes und betont die Relevanz seiner Gedanken für die politische Philosophie.
II. 17. und 18. Jahrhundert - Kritik und verdeckte Rezeption
Dieser Abschnitt untersucht die Rezeption des Hobbesschen Gedankenguts im 17. und 18. Jahrhundert. Dabei werden die kritischen Positionen von Spinoza und Locke sowie die verdeckte Rezeption von Hobbes' Ideen durch andere Denker beleuchtet.
II.1. Benedict Baruch Spinoza - rationalistische Bibelkritik
Dieses Unterkapitel behandelt die Position des rationalistischen Philosophen Baruch de Spinoza und dessen Kritik an der absoluten Staatsgewalt, die im Gegensatz zu Hobbes' Konzept steht.
II.2. John Locke - das naturrechtliche Eigentum
Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Philosophie John Lockes, einem prominenten Vertreter des Naturrechts, und dessen Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien des Gesellschaftsvertrags.
II.3. Jean-Jacques Rousseau - Kritik des negativen Menschenbildes
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Kritik des Philosophen Jean-Jacques Rousseau an Hobbes' negativem Menschenbild und seiner Vorstellung von einem Naturzustand.
III. 20. Jahrhundert Erstarken des Kontraktualismus und Entwicklung zweier Hauptinterpretationsstränge
Dieser Abschnitt behandelt die Weiterentwicklung des Kontraktualismus im 20. Jahrhundert und beleuchtet die Entstehung zweier Hauptinterpretationsstränge der Hobbes-Rezeption.
III.1. James Buchanan, John Rawls und Robert Nozick - Sozialphilosophie nach Hobbes
Dieses Unterkapitel befasst sich mit den Ideen von James Buchanan, John Rawls und Robert Nozick und deren Bezug zu den Hobbesschen Konzepten.
III.2. Zwei Interpretationsansätze der Hobbes-Rezeption
Dieser Abschnitt beleuchtet die verschiedenen Interpretationsansätze der Hobbes-Rezeption im 20. Jahrhundert.
IV. Schluss und Zusammenfassung
Dieses Kapitel wird nicht in der Zusammenfassung behandelt, da es den Abschluss der Arbeit darstellt und möglicherweise wichtige Schlussfolgerungen oder Erkenntnisse enthält, die nicht in einem Vorschautext dargestellt werden sollten.
Schlüsselwörter
Thomas Hobbes, Naturzustand, Gesellschaftsvertrag, Souveränität, Absolutismus, Kontraktualismus, Staatsgewalt, Individuum, Kritik, Rezeption, Spinoza, Locke, Rousseau, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Sozialphilosophie, Interpretationsansätze, politische Philosophie.
- Citar trabajo
- Jonas Eberle (Autor), 2003, Rezeptionsgeschichte des Thomas Hobbes - Souveränitätsanspruch und gesellschaftsbildendes Moment am Beginn der Neuzeit und in der Gegenwart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14137