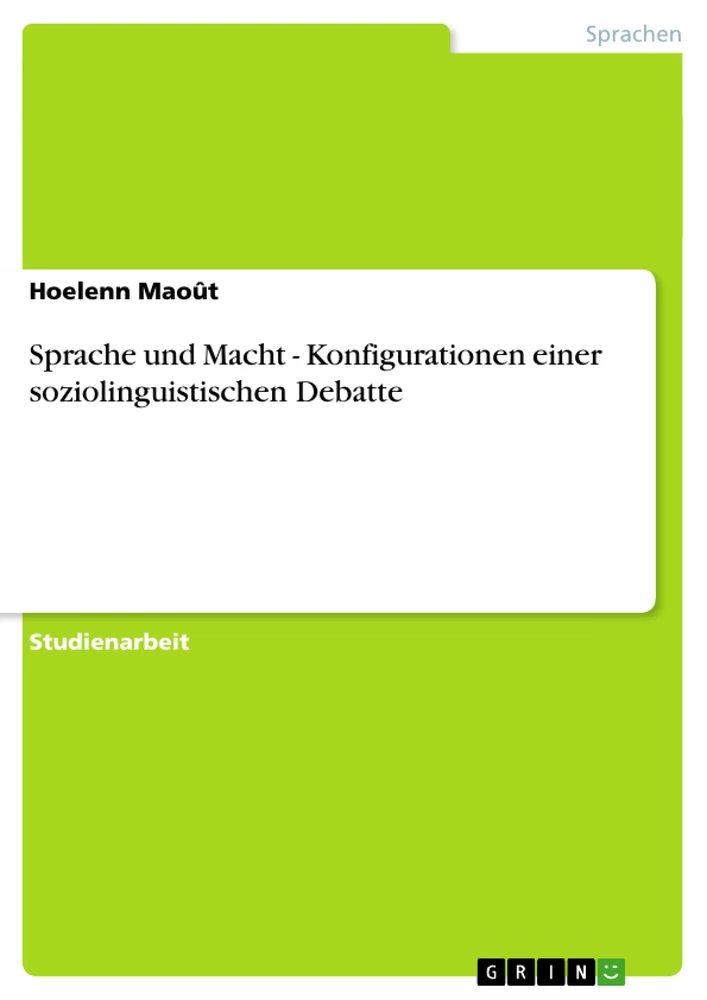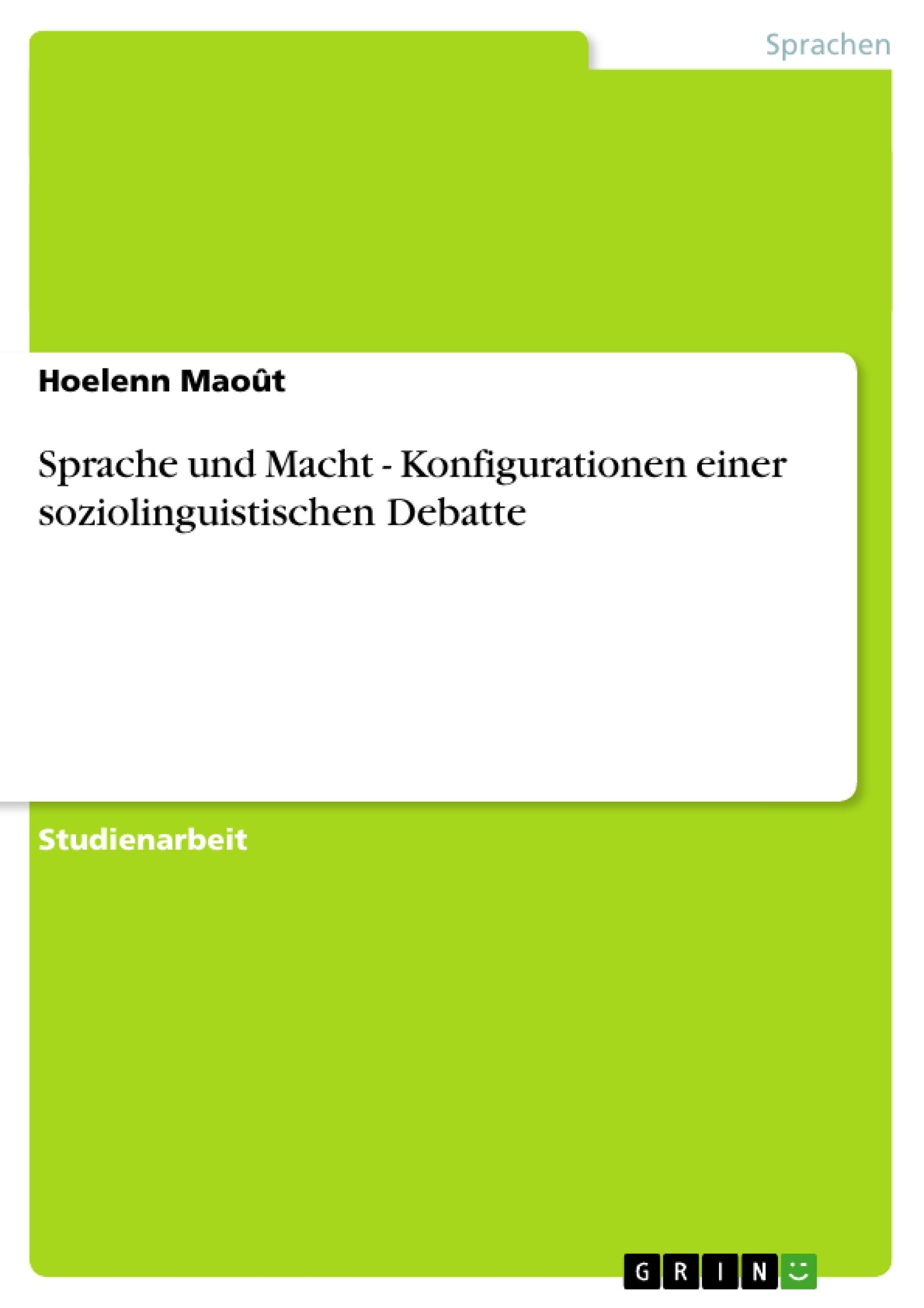„Ja, ich glaube, wenn man von der Linguistik spricht, muss man sich klar sein, dass man von Politik spricht. Und wenn man von Politik spricht, muss man wissen, dass es sich dabei um Sprache handelt.“
Bourdieu: Die verborgenen Mechanismen der Macht
Wie das einleitende Motto andeutet, setzt sich diese Arbeit mit der Diskussion um die Spannungen zwischen Sprache und Macht am Beispiel der gegenwärtigen französischen Gesellschaft auseinander. Aus diesem Grunde geht die linguistische Analyse mit einer Untersuchung der sozialen Zusammenhänge einher, in der die Sprache stets stattfindet.
Um in die Thematik aus diachroner Perspektive einzusteigen, befasst sich der erste Abschnitt mit den historisch-politischen Prämissen des heutigen Standardfranzösisch, welches im Folgenden aus verschiedenen Blickwinkeln und Disziplinen problematisiert wird. Daher umreißt der zweite Teil die Debatte zwischen dem Semiologen Barthes und der Literaturwissenschaftlerin Merlin-Kajman, deren verschiedene Standpunkte sich zwar durch voneinander differierende Konzeptionen von Macht und Sprache auszeichnen, sich indessen in ihrer Radikalität der Kritik entsprechen.
Der Ansatz der soziologischen Perspektive folgt im Hauptteil dieser Arbeit in einer umfassenden Beschäftigung mit den Thesen und praktischen Felderfahrungen Bourdieus. Sein Versuch, die akademischen, unausgesprochenen Voraussetzungen der Sprachanalyse aufzuzeigen und durch Bewusstwerdung aufzubrechen, mündet einerseits in der Idee, dass ein sprachlicher Tausch immer ein ökonomischer Tausch ist. Andererseits zieht dieser Entwurf der Sprache die Konsequenz nach sich, denjenigen, die mit dem wenigsten Kapital ausgestattet sind und deshalb kaum soziale Anerkennung erfahren, Raum für ihre spezifischen Erfahrungen mit der französischen Gesellschaft und Sprache zu geben. Somit ist es neben der wissenschaftlichen Analyse der verschiedenen Sprach- und Machttheorien Anliegen dieser Arbeit, die außerhalb des universitären Diskurs und Duktus formulierten Inhalte und Sprachprodukte darzulegen. Mit dem Ziel, den Bogen zur Merlin-Kajmanschen Beobachtung vom Verschwinden der Sprache zu ziehen, aber auch um die sozialen Hierarchien innerhalb der Sprachbewertung nicht zu reproduzieren, ergründet Teil IV die heutige Jugendkultur Frankreichs am Beispiel der Hip-Hop-Bewegung in ihrem charakteristischen historisch-politischen, sozial-sprachlichen, architektonischen und medial bestimmten Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache und Macht
- La langue est-elle fasciste?
- Sprachwissenschaft und Soziologie
- Eine linguistische Wirtschaftskunde
- Körperliche Hexis und sprachlicher Habitus
- Banlieue zwischen Mythos und Realität
- ,Multisprech': Les langues des Cités
- Schlussbemerkung
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Spannungen zwischen Sprache und Macht im Kontext der französischen Gesellschaft. Sie untersucht die historischen und politischen Prämissen des Standardfranzösisch und beleuchtet die Debatte um die Macht der Sprache aus verschiedenen Perspektiven. Die Arbeit befasst sich mit den Thesen von Pierre Bourdieu und untersucht, wie Sprache als ökonomisches Kapital fungiert und soziale Hierarchien widerspiegelt. Darüber hinaus analysiert sie die Jugendkultur Frankreichs am Beispiel der Hip-Hop-Bewegung und deren spezifische Sprachformen.
- Die historische und politische Entwicklung des Standardfranzösisch
- Die Debatte um die Macht der Sprache und ihre faschistischen Aspekte
- Die soziologische Perspektive auf Sprache und Macht nach Pierre Bourdieu
- Die Sprachformen der Jugendkultur in Frankreich
- Die Beziehung zwischen Sprache, Macht und sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Macht in der französischen Gesellschaft. Sie beleuchtet die historischen und politischen Prämissen des Standardfranzösisch und zeigt auf, wie Sprache als Mittel der Macht und der sozialen Kontrolle eingesetzt wird.
Das Kapitel „Sprache und Macht“ befasst sich mit der Kontroverse zwischen Roland Barthes und Hélène Merlin-Kajman. Barthes argumentiert, dass Sprache faschistisch ist, da sie uns zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen. Merlin-Kajman hingegen kritisiert Barthes' These und argumentiert, dass Sprache nicht nur ein Instrument der Macht, sondern auch ein Mittel der Befreiung sein kann.
Das Kapitel „Sprachwissenschaft und Soziologie“ analysiert die Thesen von Pierre Bourdieu und untersucht, wie Sprache als ökonomisches Kapital fungiert und soziale Hierarchien widerspiegelt. Bourdieu argumentiert, dass sprachliche Kompetenz ein Kapital darstellt, das auf verschiedenen Märkten gehandelt wird und soziale Anerkennung verschafft.
Das Kapitel „Banlieue zwischen Mythos und Realität“ analysiert die Sprachformen der Jugendkultur in Frankreich am Beispiel der Hip-Hop-Bewegung. Es untersucht, wie die Sprache der Banlieue eine eigene Identität und Kultur widerspiegelt und gleichzeitig als Mittel der Rebellion und des Widerstands gegen die etablierte Macht dient.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Sprache, Macht, Frankreich, Standardfranzösisch, Soziolinguistik, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Hélène Merlin-Kajman, Jugendkultur, Hip-Hop, Banlieue, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Sprache und Macht in Frankreich zusammen?
Sprache fungiert in Frankreich als Mittel der sozialen Distinktion. Beherrschung des Standardfranzösisch ist oft Voraussetzung für Macht und gesellschaftliche Anerkennung.
Was ist Bourdieus Konzept des sprachlichen Kapitals?
Pierre Bourdieu sieht Sprache als eine Form von ökonomischem Kapital: Wer die "richtige" Sprache spricht, besitzt Macht auf dem sozialen Markt.
Warum bezeichnete Roland Barthes die Sprache als „faschistisch“?
Barthes argumentierte, dass Sprache nicht nur Mitteilung ist, sondern den Sprecher zwingt, innerhalb vorgegebener Machtstrukturen zu denken und zu sprechen.
Welche Rolle spielt Hip-Hop für die Sprache in den Banlieues?
Hip-Hop bietet Jugendlichen in den Vororten einen Raum für eigene Sprachprodukte, die sich bewusst vom Standardfranzösisch abgrenzen und soziale Hierarchien herausfordern.
Was versteht man unter dem sprachlichen Habitus?
Der Habitus ist die verinnerlichte Art zu sprechen und sich auszudrücken, die durch die soziale Herkunft geprägt ist und unbewusst die Zugehörigkeit zu einer Klasse signalisiert.
- Citar trabajo
- M.A. Hoelenn Maoût (Autor), 2007, Sprache und Macht - Konfigurationen einer soziolinguistischen Debatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141415