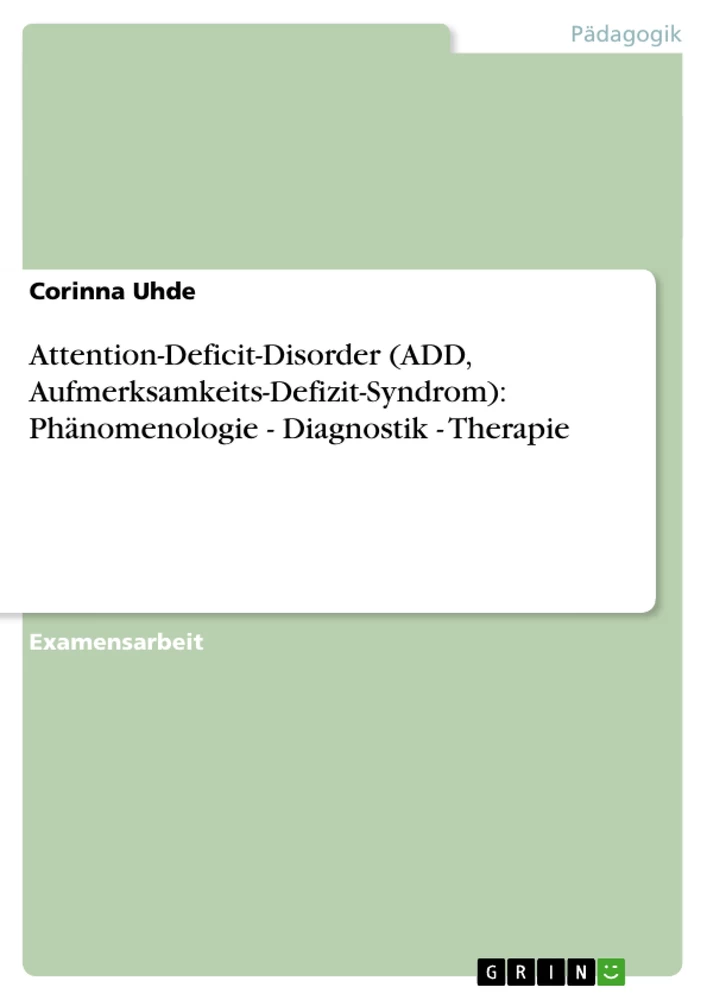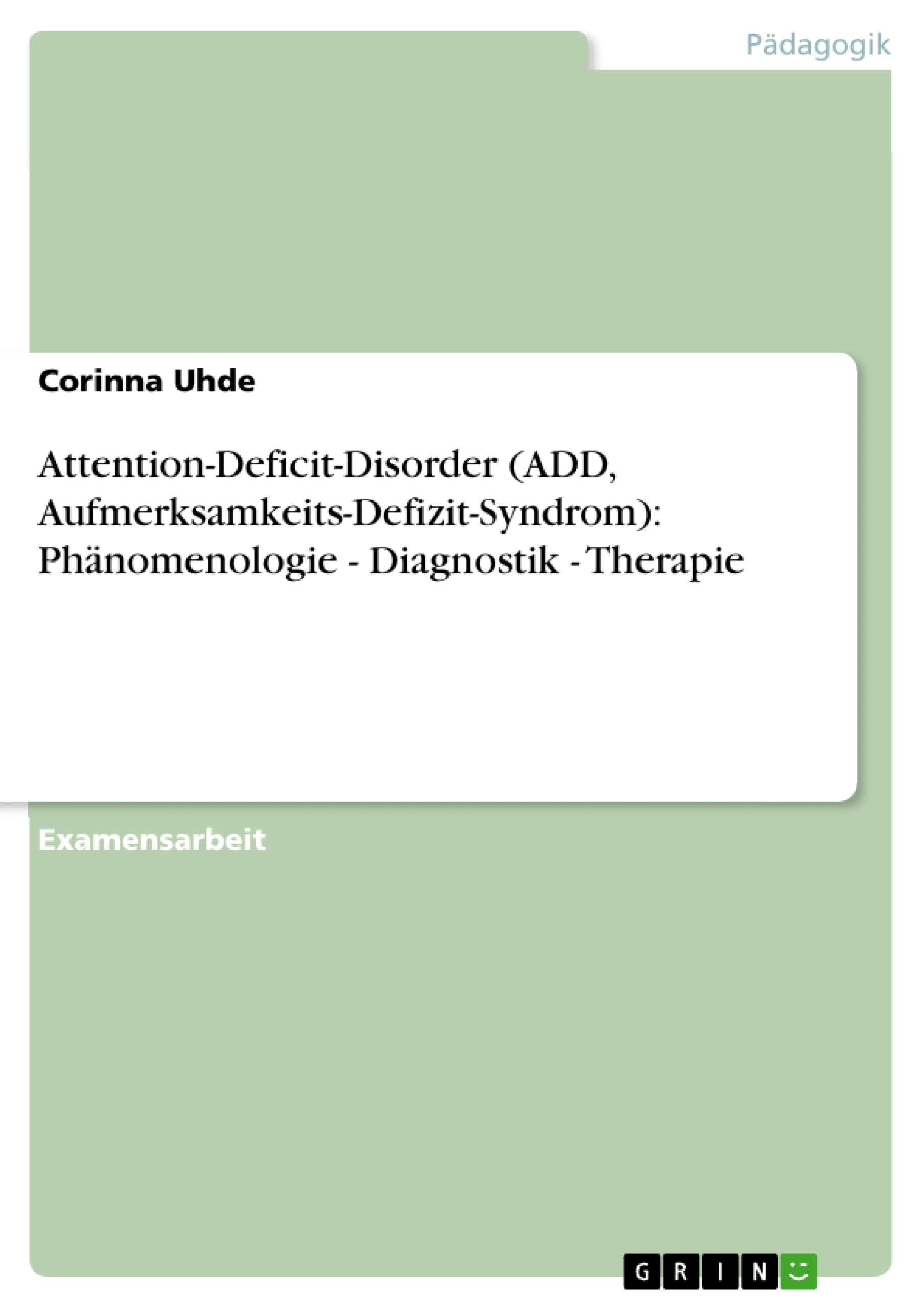Während eines Praktikums an einer Schule für Erziehungshilfe in einer 1./2. Klasse, welches ich im Rahmen meines Studiums absolvierte, erlebte ich zum ersten Mal hautnah sogenannte "hyperaktive Kinder". Ich hatte zuvor zwar ein Seminar zur Hyperaktivität belegt und konnte deshalb auf ein Grundwissen zurückgreifen, was es jedoch bedeutet, mit diesen Kindern zu arbeiten und vor allem, was es für diese Kinder bedeutet, mit uns arbeiten zu müssen, wurde mir erst nach und nach im realen Zusammensein mit ihnen bewußt. Da sich das Praktikum insgesamt über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren hinzog, erlebte ich die Schüler innerhalb verschiedener Perioden. Ich bemerkte unter anderem, wie sich die Einnahme von Ritalin auf ihr Verhalten auswirkte.
Besonders bei einem Schüler empfand ich die Wirkung des Medikaments als unglaublich heftig. Der sonst lebhafte und deshalb für Eltern und Lehrer anstrengende Junge war die ersten Stunden des Morgens wie weggetreten, wirkte völlig apathisch und wie paralysiert.
Der Zustand dieses Jungen hat mich sehr entsetzt und ich verstand nicht, was ihm die Einnahme dieses Medikament eigentlich Positives geben sollte?
Aus diesem Grund fing ich an, mich mehr mit dem Hyperkinetischen Syndrom und seinen Therapieformen zu befassen. Durch Zufall stieß ich dabei auf ein Buch der Ergotherapeutin Rega Schaefgen: "Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom - Eine Form der sensorischen Integrationsstörung".
Beim Lesen dieses Buches erfuhr ich zum ersten Mal von der Attention-Deficit-Disorder (ADD), wobei Schaefgen hier den Begriff Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) ohne Hyperaktivität benutzt. Bei der Symptombeschreibung fielen mir spontan ein Schüler aus meiner Praktikumklasse und auch zwei Kinder aus dem Bekanntenkreis ein, auf die eine solche Diagnose möglicherweise zutreffen könnte.
Diese Tatsache machte mich sehr nachdenklich.
Ich hatte bisher weder im Rahmen meines Studiums noch anderswo jemals etwas von der ADD gehört und wenn ich mich nicht näher mit Hyperaktivität befaßt hätte, wäre dies so rasch sicherlich auch nicht geschehen- und doch fielen mir spontan drei Kinder ein, die möglicherweise ADD haben könnten?
Die auffälligen, lebhaften Störenfriede und Zappelphilippe waren es, die meine Aufmerksamkeit erregt hatten, ihretwegen hatte ich mich näher mit dem ADS befaßt und über ihre Störung hatte ich mehr erfahren wollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorwort
- Aufbau der Arbeit
- Begriffsdefinition und -entwicklung
- Fallbeispiel
- Fazit
- Symptomatik
- DSM-IV
- Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Konzentrationsunbeständigkeit
- Sekundärsymptome
- Der Verlauf der ADD in den verschiedenen Lebensphasen
- ADD im Säuglings- und Kleinkindalter
- ADD bei Schulkindern
- ADD in der Pubertät
- ADD im Erwachsenenalter
- Ursachen
- Ursachen in Familie, Erziehung und Lebenswelt des Kindes
- Umweltverschmutzung
- ADS als Folge von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Ernährungsfehlern und Allergien
- Biologische Ursachen
- Neuro-physiologische Grundlagen
- Nervenzellen
- Entwicklungs- und Funktionsstörungen des Gehirns
- Das Zentralnervensystem
- Funktionsweise des ZNS
- Bereiche der Sensorischen Integration und ihre neuro-physiologischen Grundlagen
- Reizfilterung
- Erregungslevel im ZNS
- Biologische Ursachen im Bereich des Gehirns und Nervensystems
- Neuroanatomische Hypothesen
- Biochemische Hypothesen
- Weitere biologische Hypothesen
- Vererbte genetische Merkmale
- Zusammenfassung und Fazit
- Das funktionelle Verstehen der Symptomatik
- Diagnostik
- Anamnese der Krankheits- und Lebensgeschichte des Kindes
- Leistungen in der Schule
- Beobachten des Kindes im Alltag
- Tests, Skalen und Fragebögen
- Psychologische Beurteilung
- Klinische und ärztliche Untersuchung
- Therapieformen
- Medikamentöse Behandlung des ADD
- Stimulantien
- Antidepressiva
- Ausblick
- Ergotherapeutische und mototherapeutische Behandlungskonzepte
- Vom Problem zur Therapie
- Sensorische Integrationstherapie nach Ayres
- Beispiel: Verbesserung der Bewegungs- und Körperwahrnehmung
- Sensorische Integration im Dialog
- Alertprogramm nach Sue Williams
- Somationstechnik mit Gelenkapproximation nach Zisi
- Zusammenfassung und Relativierung
- Umstellen der Ernährung
- Psychotherapeutische Behandlungsverfahren
- Verhaltenstherapie
- Konzentrationstrainingsprogramm (KTP) nach Ettrich
- Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern nach Lauth/Schlottke
- Spieltherapie
- Therapieziele
- Pädagogische Interventionen
- Der Umgang mit dem ADD-Kind zuhause
- Verbesserte Eltern-Kind-Interaktion nach THOP
- Der Umgang mit dem ADD-Kind in der Schule
- Sensorische Diät nach Pat Willbarger
- Individuelle Förderung
- Die Hunter und Farmer -Theorie nach Thom Hartmann
- ADS- Kinder- rechtshemisphärisch?
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) ohne Hyperaktivität (ADD), seine Phänomenologie, Diagnostik und Therapie. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Erkrankung zu vermitteln und verschiedene Behandlungsansätze zu beleuchten.
- Definition und Entwicklung des ADD-Begriffs
- Symptombilder und deren Verlauf in verschiedenen Lebensphasen
- Biologische, psychologische und umweltbedingte Ursachen von ADD
- Diagnostische Verfahren zur Erkennung von ADD
- Vielfältige Therapieansätze, inklusive medikamentöser, ergotherapeutischer und psychotherapeutischer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation der Autorin, sich mit ADD zu befassen, ausgelöst durch Erfahrungen während eines Praktikums an einer Schule für Erziehungshilfe. Sie hebt die Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen und der praktischen Erfahrung mit betroffenen Kindern hervor und deutet auf die Notwendigkeit einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema hin.
Begriffsdefinition und -entwicklung: Dieses Kapitel widmet sich der präzisen Definition des Aufmerksamkeitsdefizit-Disorders (ADD) und seiner Entwicklung als diagnostischer Begriff. Es beleuchtet die Abgrenzung zu anderen verwandten Störungen und verfolgt die historische Entwicklung des Verständnisses von ADD.
Fallbeispiel: Ein detailliertes Fallbeispiel illustriert die typischen Symptome und Herausforderungen, die mit ADD verbunden sind. Es dient als anschaulicher Bezugspunkt für die folgenden Kapitel, die sich mit Symptomatik, Ursachen und Therapie beschäftigen. Die Fallbeschreibung zeigt die individuellen Schwierigkeiten eines Kindes mit ADD und dessen Auswirkungen auf das soziale und schulische Umfeld.
Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Symptome von ADD, basierend auf Kriterien des DSM-IV. Es differenziert zwischen Kern- und Sekundärsymptomen und analysiert deren Ausprägung in verschiedenen Altersgruppen (Säuglingsalter, Kindesalter, Pubertät, Erwachsenenalter), um den Verlauf der Störung über die Lebensspanne zu verdeutlichen. Die Beschreibung der Symptomatik unterstreicht die Heterogenität der Störung und die damit verbundenen individuellen Herausforderungen.
Ursachen: Dieses Kapitel untersucht die multifaktoriellen Ursachen von ADD. Es analysiert den Einfluss von familiären, erzieherischen und umweltbedingten Faktoren, sowie biologische Aspekte wie neurophysiologische Grundlagen und genetische Veranlagung. Die detaillierte Erörterung neurologischer und biochemischer Aspekte vermittelt ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge.
Diagnostik: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen diagnostischen Verfahren, die zur Feststellung von ADD eingesetzt werden. Es beschreibt die Bedeutung der Anamnese, die Rolle von Tests und Fragebögen sowie die Notwendigkeit einer umfassenden psychologischen und klinischen Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Diagnostik, die verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung berücksichtigt.
Therapieformen: Dieses Kapitel behandelt eine große Bandbreite von Therapieansätzen für ADD, von medikamentösen Behandlungen (Stimulantien und Antidepressiva) über ergotherapeutische und mototherapeutische Konzepte (Sensorische Integrationstherapie, Alertprogramm) bis hin zu psychotherapeutischen Verfahren (Verhaltenstherapie, Spieltherapie) und der Bedeutung einer angepassten Ernährung. Es bewertet die jeweiligen Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze und betont die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung.
Pädagogische Interventionen: Dieses Kapitel befasst sich mit pädagogischen Interventionen im häuslichen und schulischen Umfeld von Kindern mit ADD. Es beleuchtet den wichtigen Aspekt der Eltern-Kind-Interaktion und beschreibt Strategien für eine unterstützende und fördernde Gestaltung des Lernprozesses in der Schule. Die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und die Anpassung der Lernumgebung an die spezifischen Herausforderungen von ADD-Kindern stehen im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeits-Defizit-Disorder (ADD), Diagnostik, Therapie, Symptome, Ursachen, Neurophysiologie, Biologische Faktoren, Psychotherapeutische Verfahren, Ergotherapie, Pädagogische Interventionen, Verhaltenstherapie, Medikamentöse Behandlung, DSM-IV, Individuelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aufmerksamkeits-Defizit-Störung ohne Hyperaktivität (ADD)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ohne Hyperaktivität (ADD). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Phänomenologie, Diagnostik und Therapie von ADD.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung des ADD-Begriffs, Symptomatik und deren Verlauf in verschiedenen Lebensphasen, biologische, psychologische und umweltbedingte Ursachen, diagnostische Verfahren, verschiedene Therapieansätze (medikamentös, ergotherapeutisch, psychotherapeutisch), und pädagogische Interventionen im häuslichen und schulischen Umfeld.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einem Vorwort. Es folgt ein Kapitel zur Begriffsdefinition und -entwicklung, ein Fallbeispiel, Kapitel zur Symptomatik, Ursachen, Diagnostik und Therapieformen. Zusätzlich werden pädagogische Interventionen und eine Schlussbetrachtung behandelt. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Welche Symptomatik wird bei ADD beschrieben?
Die Symptomatik von ADD wird detailliert anhand des DSM-IV beschrieben. Es werden Kern- und Sekundärsymptome unterschieden, und der Verlauf der Störung in verschiedenen Altersgruppen (Säuglingsalter, Kindesalter, Pubertät, Erwachsenenalter) wird analysiert. Die Heterogenität der Störung und die damit verbundenen individuellen Herausforderungen werden hervorgehoben.
Welche Ursachen für ADD werden genannt?
Das Dokument untersucht multifaktorielle Ursachen, darunter familiäre, erzieherische und umweltbedingte Faktoren sowie biologische Aspekte wie neurophysiologische Grundlagen und genetische Veranlagung. Neurologische und biochemische Aspekte werden detailliert erläutert.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Die Diagnostik von ADD umfasst die Anamnese (Krankheits- und Lebensgeschichte des Kindes, Leistungen in der Schule, Beobachtung im Alltag), Tests, Skalen und Fragebögen sowie psychologische und klinische Untersuchungen. Eine ganzheitliche Diagnostik wird betont.
Welche Therapieformen werden vorgestellt?
Es werden vielfältige Therapieansätze vorgestellt: medikamentöse Behandlungen (Stimulantien, Antidepressiva), ergotherapeutische und mototherapeutische Konzepte (Sensorische Integrationstherapie, Alertprogramm, Somationstechnik), psychotherapeutische Verfahren (Verhaltenstherapie, Spieltherapie) und die Bedeutung einer angepassten Ernährung. Die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung wird hervorgehoben.
Welche pädagogischen Interventionen werden empfohlen?
Das Dokument beschreibt pädagogische Interventionen im häuslichen und schulischen Umfeld. Es werden Strategien für eine unterstützende Eltern-Kind-Interaktion, die Gestaltung des Lernprozesses in der Schule und die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse von ADD-Kindern behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren dieses Dokument?
Schlüsselwörter sind: Aufmerksamkeits-Defizit-Disorder (ADD), Diagnostik, Therapie, Symptome, Ursachen, Neurophysiologie, Biologische Faktoren, Psychotherapeutische Verfahren, Ergotherapie, Pädagogische Interventionen, Verhaltenstherapie, Medikamentöse Behandlung, DSM-IV, Individuelle Förderung.
Gibt es ein Fallbeispiel?
Ja, das Dokument enthält ein detailliertes Fallbeispiel, das die typischen Symptome und Herausforderungen von ADD veranschaulicht und als Bezugspunkt für die weiteren Kapitel dient.
- Arbeit zitieren
- Corinna Uhde (Autor:in), 2000, Attention-Deficit-Disorder (ADD, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom): Phänomenologie - Diagnostik - Therapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14143