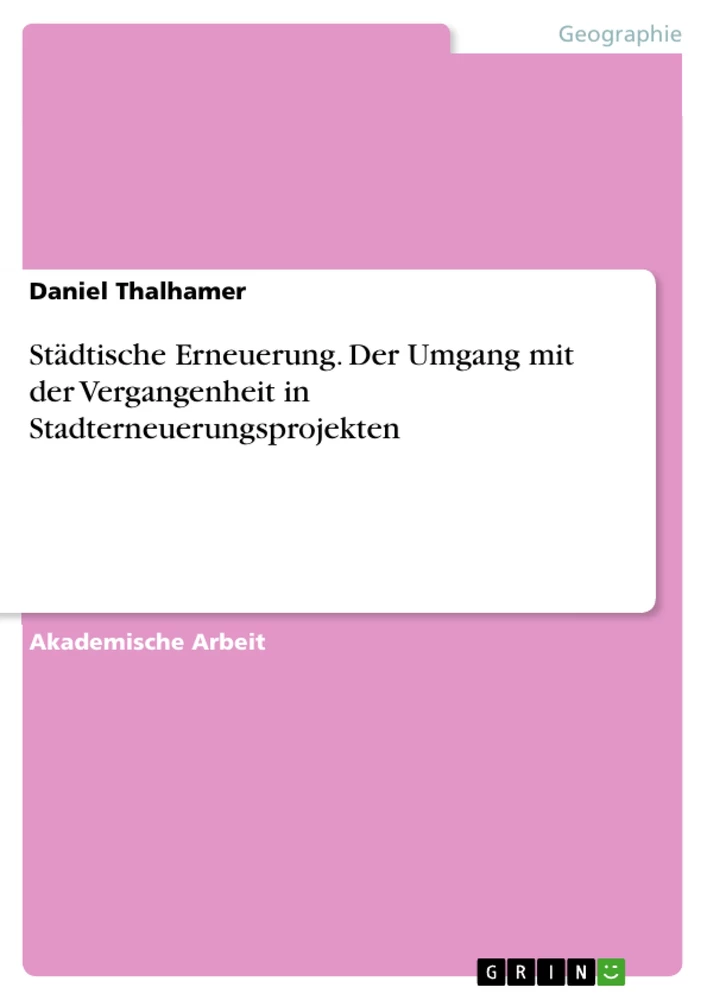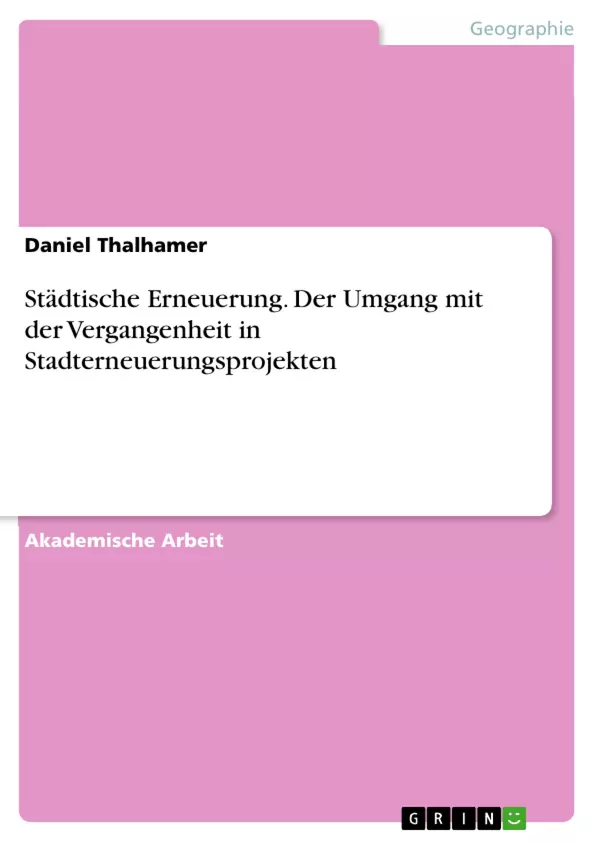In der folgenden Seminararbeit wird der Umgang mit der Vergangenheit in Stadterneuerungsprojekten behandeln. In der Arbeit wird im Speziellen einer Frage nachgegangen: Welche Möglichkeiten bringt die Vergabe eines UNESCO-Weltkulturerbestatus und welche Chancen bzw. Herausforderungen bedeutet das für Städte in Bezug auf Stadterneuerungsprojekte?
Frei nach der Soziologin Monica de Frantz, möchte ich darauf hinweisen, dass Wien aufgrund seines symbolischen und politischen Status als Hauptstadt, mit einem bedeutenden kulturellen Angebot ein optimales Umfeld bietet, um die politischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten zu veranschaulichen, die mit kulturellen Erneuerungsstrategien verbunden sind. Genau deswegen, weil Wien ein derart gutes Beispiel für die Schwierigkeiten zwischen Stadterneuerungs- und Erhaltungsprojekten darstellt, wird meine Arbeit das Hauptaugenmerk auf Wien legen. Hierbei möchte ich vor allem die diversen Nutzungskonflikte beleuchten. Das sehr aktuelle "Heumarktprojekt" wird ebenso eine Rolle spielen, wie die städtebaulichen Pläne eines Leseturms beim Museumsquartier, die letztenendes abgesagt wurden.
Dennoch ist es von großer Bedeutung, auch über den Tellerrand hinaus zu blicken. Aus diesem Grund werden neben der österreichischen Bundeshauptstadt Wien auch erwähnenswerte Beispiele aus Deutschland behandelt werden. Im Konkreten werde ich neben der österreichischen Hauptstadt noch die Fallbeispiele Dresden (Elbtal) und Hamburg (Speicherstadt) behandeln. Außerdem wird die Seminararbeit auf die wesentlichen Aspekte, die die Vergabe des UNESCO-Weltkulturerbestatuses mit sich bringt eingehen. Ein besonderes Augenmerk wird vor allem auf den Themen Massentourismus (Overtourism) und der Disneyfizierung von regenerierten historischen Zentren liegen. Im Mittelpunkt steht aber das ambivalente Verhältnis zwischen den Erhaltungsprozessen bzw. den Vergangenheitsprozessen von Städten und deren Erneuerungsmaßnahmen. Am Ende wird klar ersichtlich, dass das Erbe ein soziales Konstrukt darstellt und welche Chancen die Bewilligung des UNESCO- Weltkulturerbestatus für Städte beinhaltet. Weiters wird auch ersichtlich, welche möglichen Opfer Stadtbewohner bringen müssen, um solch einen Status erhalten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- UNESCO-Weltkulturerbe
- Eine Definition
- Tourismusmagnet
- Weltkulturerbe und Stadterneuerung
- Wien
- Kulturerbe vs. Bauprojekte
- Dresden
- Der Dresdner Brückenstreit
- UNESCO-Statusaberkennung
- Hamburg
- Speicherstadt und HafenCity
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht den Umgang mit der Vergangenheit in Stadterneuerungsprojekten, insbesondere im Kontext der UNESCO-Weltkulturerbe-Vergabe. Die Arbeit beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die dieser Status für Städte hinsichtlich Stadterneuerungsprojekte bietet.
- Die Auswirkungen des UNESCO-Weltkulturerbestatus auf den Tourismus und die "Disneyfizierung" von Städten
- Nutzungskonflikte zwischen Denkmalschutz und Stadterneuerung
- Die Ambivalenz von Vergangenheitserhaltung und Erneuerungsmaßnahmen
- Das soziale Konstrukt des Erbes und die Bewilligung des UNESCO-Weltkulturerbestatus
- Die Rolle des Massentourismus (Overtourism) in regenerierten historischen Zentren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Seminararbeit stellt die zentrale Fragestellung dar und erläutert die methodische Vorgehensweise. Sie fokussiert auf Wien als Fallbeispiel und die Schwierigkeiten zwischen Stadterneuerungs- und Erhaltungsprojekten.
- UNESCO-Weltkulturerbe: Dieses Kapitel definiert den Begriff "UNESCO-Weltkulturerbe" und beleuchtet die Bedeutung des Status als Tourismusmagnet. Es werden die möglichen negativen Folgen wie "Disneyfizierung" und strikte Auflagen für Anrainer*innen diskutiert.
- Wien: Hier werden die Konflikte zwischen Kulturerbe und Bauprojekten in Wien, wie das "Heumarktprojekt" und die Pläne eines Leseturms beim Museumsquartier, beleuchtet.
- Dresden: Das Kapitel behandelt den "Dresdner Brückenstreit" und die mögliche Aberkennung des UNESCO-Status aufgrund von Baumaßnahmen.
- Hamburg: Die "Speicherstadt" und die "HafenCity" in Hamburg werden als Beispiele für Stadterneuerungsprojekte vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Stadterneuerung, UNESCO-Weltkulturerbe, Tourismus, "Disneyfizierung", Nutzungskonflikte, Denkmalpflege, Vergangenheitserhaltung, soziale Konstruktion des Erbes, Overtourism, Fallbeispiele Wien, Dresden und Hamburg.
- Quote paper
- Daniel Thalhamer (Author), 2019, Städtische Erneuerung. Der Umgang mit der Vergangenheit in Stadterneuerungsprojekten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1415221