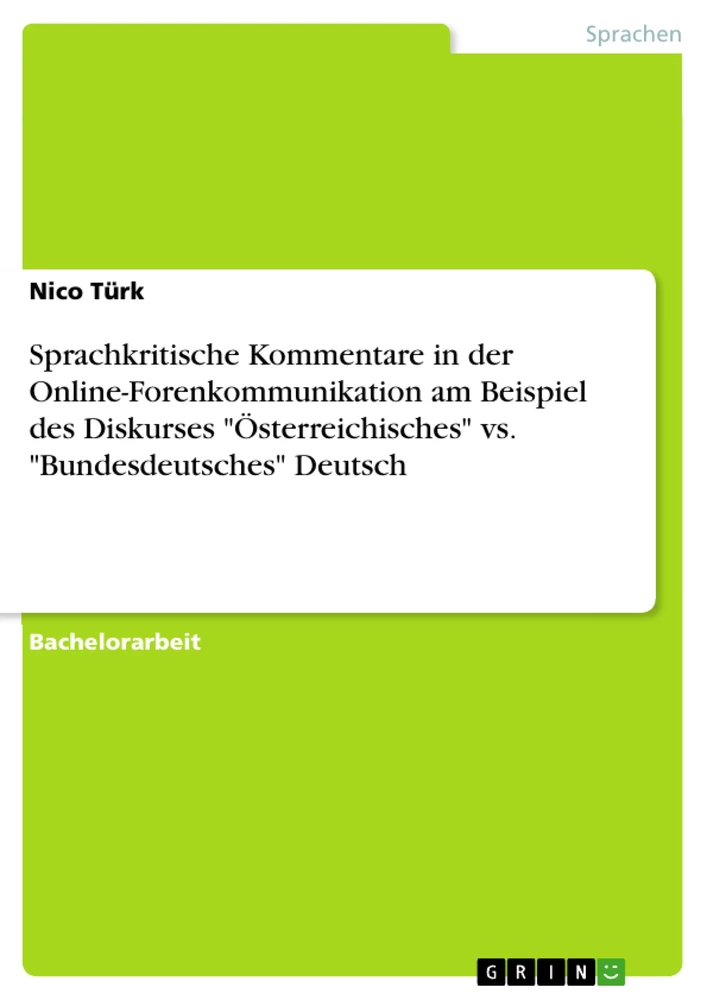Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich der Untersuchung laienlinguistischer Sprachkritik in Online-Foren und setzt sich mit der Frage auseinander, wie diese Kritik die Wahrnehmung und den Gebrauch von "österreichischem" und "bundesdeutschem" Deutsch beeinflusst. Durch die Analyse von User-Kommentaren werden sprachkritische Normen, die zugrunde liegenden Sprachmythen und die daraus resultierenden Interferenzen über die Sprecheridentität herausgearbeitet.
Die Arbeit deckt auf, dass viele laienlinguistische Bewertungen auf Falschannahmen und einem mangelnden Bewusstsein für die Grundlagen der deutschen Sprache beruhen und stark emotional geprägt sind. Trotzdem spielen diese Bewertungen eine wesentliche Rolle bei der Konstruktion der virtuellen Identität. Die Ergebnisse der Arbeit bieten wichtige Ansatzpunkte für die Sprachbildung im Deutschunterricht und fördern ein reflektiertes Verständnis des eigenen Sprachgebrauchs.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hinführung
- 3 Analyse
- 3.1 Datenerhebung
- 4 Datenauswertung
- 4.1 Lexemkritik
- 4.2 Kritik am „Bundesdeutschen“ Deutsch
- 4.3 Kritik an Kommentaren
- 4.4 Kritik am „Österreichischen“ Deutsch
- 4.5 Kritik an Sprachkritik
- 4.6 Kritik am Akzent / Aussprache
- 4.7 „Österreichisches“ Deutsch geht verloren
- 4.8 Kritik am Artikel
- 4.9 Nicht zuordenbar
- 5 Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht laienlinguistische Sprachkritik in Online-Foren am Beispiel des Diskurses „Österreichisches“ vs. „Bundesdeutsches“ Deutsch. Das Ziel ist die Analyse von Mustern dieser Kritik, um Ansatzpunkte für Verbesserungen im Deutschunterricht zu finden und ein reflektierteres Verständnis des eigenen Sprachgebrauchs zu fördern. Die Arbeit basiert auf der Analyse von Online-Kommentaren zu einem Artikel über diese Thematik.
- Analyse laienlinguistischer Sprachkritik in Online-Foren
- Identifizierung sprachkritischer Normen und zugrundeliegender Sprachmythen
- Untersuchung der Korrelation zwischen Sprache und Identität
- Bewertung der Funktion sprachkritischer Äußerungen
- Ableitung von Implikationen für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachkritischen Kommentare in Online-Foren ein und verortet die Arbeit im Kontext des medialen Diskurses über „Österreichisches“ vs. „Bundesdeutsches“ Deutsch. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage, welche die Art und Begründung laienlinguistischer Sprachkritik in Online-Kommentaren untersucht. Die These der Arbeit, dass laienlinguistische Bewertungen oft auf Falschannahmen und Emotionen beruhen, wird vorgestellt. Die Bedeutung dieser Kritik für die Konstruktion virtueller Identitäten wird angedeutet.
2 Hinführung: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel sprachkritischer Praktiken durch neue Medien und die Möglichkeit der öffentlichen Sprachkritik in Online-Foren. Es erläutert die medienspezifische Bedingtheit der Online-Sprachkritik im Gegensatz zu anderen Kommunikationsformen. Die Datengrundlage der Arbeit, bestehend aus 370 Kommentaren zu einem Artikel des „Der Standard“, wird detailliert dargelegt, inklusive der methodischen Herangehensweise basierend auf dem „Kritiklinguistischen Mehrebenenmodell“ von Arendt und Kiesendahl. Die Methode zielt auf die Rekonstruktion des sprachlichen Normverständnisses von Laien ab.
3 Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung der qualitativen Analyse der 370 Online-Kommentare. Es werden die Kategorien der Analyse erläutert, wobei die Analyse selbst nicht im Vorschautext dargestellt wird um den Umfang der Arbeit nicht zu stark zu reduzieren. Die Auswertung der Daten sollte zeigen, welche sprachlichen Phänomene kritisiert wurden, welche Normen zugrunde lagen, und welche Interferenzen über die Sprecher gezogen wurden. Ferner wird untersucht, welche Sprachmythen vorherrschten und wie der Bezug zwischen Sprache und Identität korrelierte.
4 Datenauswertung: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Analyse der Online-Kommentare, gegliedert nach verschiedenen Kategorien der Kritik: Lexemkritik, Kritik am „Bundesdeutschen“ Deutsch, Kritik an Kommentaren, Kritik am „Österreichischen“ Deutsch, Kritik an Sprachkritik, Kritik am Akzent/Aussprache, Kritik an der Aussage, dass „Österreichisches“ Deutsch verloren geht, Kritik am Artikel selbst, und Kommentare, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten. Der Fokus liegt hier auf der Synthese der verschiedenen Kritikpunkte und der Identifizierung wiederkehrender Muster und Tendenzen in der laienlinguistischen Sprachkritik.
Schlüsselwörter
Laienlinguistische Sprachkritik, Online-Forenkommunikation, „Österreichisches“ Deutsch, „Bundesdeutsches“ Deutsch, Sprachnormen, Sprachmythen, Identität, Online-Kommunikation, Varietäten des Deutschen, Plurizentrik, Deutschunterricht.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Laienlinguistische Sprachkritik in Online-Foren
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht laienlinguistische Sprachkritik in Online-Foren, speziell im Kontext des Diskurses um „Österreichisches“ versus „Bundesdeutsches“ Deutsch. Sie analysiert Muster dieser Kritik und sucht nach Ansatzpunkten für Verbesserungen im Deutschunterricht sowie für ein reflektierteres Sprachbewusstsein.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf der qualitativen Analyse von 370 Online-Kommentaren zu einem Artikel des „Der Standard“. Die Analyse verwendet das „Kritiklinguistische Mehrebenenmodell“ von Arendt und Kiesendahl, um das sprachliche Normverständnis der Kommentatoren zu rekonstruieren.
Welche Daten wurden analysiert?
Die Datengrundlage besteht aus 370 Kommentaren zu einem Artikel über „Österreichisches“ und „Bundesdeutsches“ Deutsch aus einem Online-Forum. Die Kommentare wurden nach verschiedenen Kategorien der Kritik analysiert.
Welche Kategorien der Kritik wurden untersucht?
Die Analyse gliedert die Kritik in folgende Kategorien: Lexemkritik, Kritik am „Bundesdeutschen“ Deutsch, Kritik an Kommentaren, Kritik am „Österreichischen“ Deutsch, Kritik an Sprachkritik, Kritik am Akzent/Aussprache, Kritik an der Aussage, dass „Österreichisches“ Deutsch verloren geht, Kritik am Artikel selbst, und Kommentare, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Auswertung zeigt wiederkehrende Muster und Tendenzen in der laienlinguistischen Sprachkritik. Die Ergebnisse werden detailliert im Kapitel 4 „Datenauswertung“ dargestellt, wobei der Fokus auf der Synthese der verschiedenen Kritikpunkte liegt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, laienlinguistische Sprachkritik in Online-Foren zu analysieren, sprachkritische Normen und zugrundeliegende Sprachmythen zu identifizieren, die Korrelation zwischen Sprache und Identität zu untersuchen, die Funktion sprachkritischer Äußerungen zu bewerten und Implikationen für den Deutschunterricht abzuleiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Laienlinguistische Sprachkritik, Online-Forenkommunikation, „Österreichisches“ Deutsch, „Bundesdeutsches“ Deutsch, Sprachnormen, Sprachmythen, Identität, Online-Kommunikation, Varietäten des Deutschen, Plurizentrik, Deutschunterricht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, eine Hinführung zur Thematik und Methodik, eine Analyse der Daten, die Auswertung der Ergebnisse und eine Schlussfolgerung (Conclusio). Die einzelnen Kapitel werden im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Wo liegt die Relevanz der Arbeit?
Die Arbeit ist relevant, da sie ein Verständnis für die Mechanismen laienlinguistischer Sprachkritik in digitalen Medien liefert und Ansatzpunkte für einen reflektierteren Umgang mit Sprache und Sprachvariation im Deutschunterricht aufzeigt.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass laienlinguistische Bewertungen oft auf Falschannahmen und Emotionen beruhen und die Bedeutung dieser Kritik für die Konstruktion virtueller Identitäten hervorgehoben wird.
- Quote paper
- Nico Türk (Author), 2023, Sprachkritische Kommentare in der Online-Forenkommunikation am Beispiel des Diskurses "Österreichisches" vs. "Bundesdeutsches" Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1415237