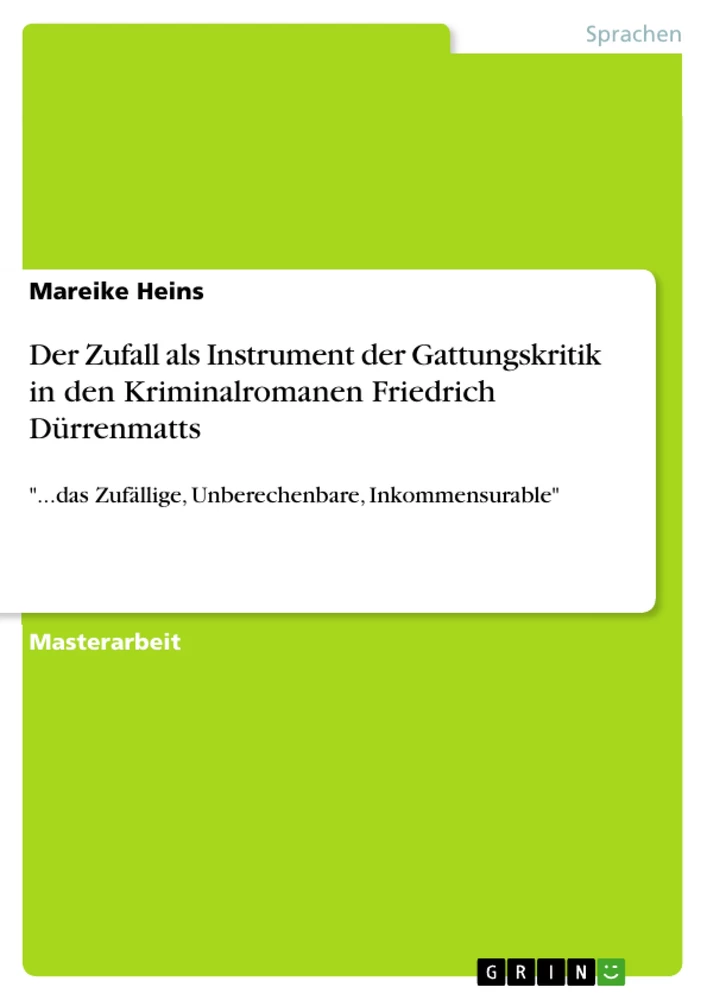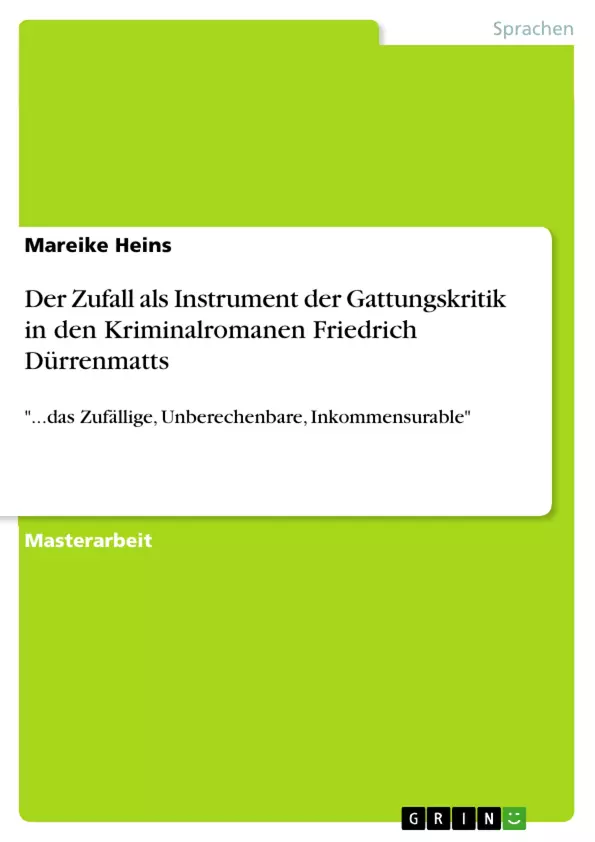Wie sich die kritische Auseinandersetzung Dürrenmatts mit der Gattung im Einzelnen zeigt wird in diesem Arbeit untersucht. Dabei werde drei Romane betrachtet: Dürrenmatts erster Kriminalroman "Der Richter und sein Henker", dessen Fortsetzung "Der Verdacht" sowie "Das Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman" – eine Überarbeitung des Drehbuchs zum Film "Es geschah am helllichten Tag", an dessen Entstehung Dürrenmatt ebenfalls beteiligt war.
Neben einer Thematisierung der Merkmale des klassischen Kriminalromans sowie des Begriffs des Zufälligen erfolgt eine Untersuchung des Figurenpersonals der Romane unter Betrachtung folgender Aspekte:
In welchem Verhältnis stehen die zentralen Charaktere zum Zufall?
Wie gehen sie mit dem Zufälligen um und was für ein Weltbild zeigt sich an ihren jeweiligen Haltungen?
Zentral und immer wieder kehrend ist im Gesamtwerk Friedrich Dürrenmatts das Motiv des Zufalls - so auch in seinen Kriminalromanen. Der vornehmlich für seine Komödien wie "Der Besuch der alten Dame" bekannte Schriftsteller bedient sich traditioneller Elemente des Kriminalromans und verfremdet sie zugleich: Durch den gezielten Einsatz des Zufalls werden sowohl die für den klassischen Kriminalroman typische Vorstellung einer geordneten heilen Welt unterlaufen als auch die Figur des traditionellen Detektivs, der diese Ordnung durch logisches Vorgehen zu schützen vermag, kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik, Textauswahl und Fragestellung
- Vorgehensweise
- Forschungsstand
- Theorieteil
- Der klassische Kriminalroman
- Der Begriff des Zufalls
- Der Richter und sein Henker - Zwei Seiten des Zufalls
- Eine Wette als Ausgangspunkt
- Bärlachs ambivalentes Verhältnis zum Zufall
- Der Nihilist Gastmann als sein ewiger Gegenspieler
- Tschanz eine Figur im Zwiespalt
- Tschanz als Polizist und Mörder
- Tschanz als Spielfigur Bärlachs
- Der Verdacht - Die Welt als Lotterie
- Dr. Emmenberger als Spiegelfigur zu Gastmann
- Die Bestätigung der These Bärlachs
- Die Philosophie des Bösen
- Der Zufall als bestimmender Faktor
- Die verhängnisvolle Hoffnung auf das Unwahrscheinlichste
- Bärlachs naiver Plan
- Das Leben als zufällige Möglichkeit
- Die Frage nach der Ohnmacht des Menschen
- Abschied von der heilen Welt – Gutes und Böses als Ergebnis des Zufalls?
- Das Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman - Der unausweichliche Zufall
- Der Film Es geschah am helllichten Tag als Dürrenmatts,konventionellste Detektivgeschichte'
- Die Rahmenhandlung als explizite Kritik
- „Hier wird der Schwindel zu toll“ – Dr. H.‘s. Kritik am Kriminalroman
- Das notwendige Arrangement mit dem Zufall
- Vom Allgemeinen zum Einzelfall – Die Binnenhandlung als Exempel
- Die Rolle des Zufalls im Fall Gritli Moser
- ,,Ein Mann der Organisation“ – Kommissär Matthäis Scheitern am Zufall
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kritische Auseinandersetzung Friedrich Dürrenmatts mit der Gattung des Kriminalromans, die er durch den gezielten Einsatz des Zufallsmotivs vollzieht. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von drei Kriminalromanen: "Der Richter und sein Henker", "Der Verdacht" und "Das Versprechen". Ziel ist es, die Entwicklung dieser Kritik in den drei Romanen aufzuzeigen und die zentrale Fragestellung zu beantworten, wie Dürrenmatt durch das Zufallsmotv traditionelle Muster des Kriminalromans unterläuft, verfremdet und kritisiert.
- Die Dekonstruktion des klassischen Kriminalromans
- Die Rolle des Zufalls in Dürrenmatts Werken
- Die Kritik an der Vorstellung einer geordneten, heilen Welt
- Die Ambivalenz des Zufalls als Chance und Bedrohung
- Die Hinterfragung des traditionellen Detektivs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet zunächst die Thematik der Arbeit, die Textauswahl und die Fragestellung. Sie stellt zudem die Vorgehensweise und den Forschungsstand dar. Der Theorieteil beschäftigt sich mit den zentralen Merkmalen des klassischen Kriminalromans und erläutert den Begriff des Zufalls, einschließlich seiner Bedeutungsmöglichkeiten und der Verbindung zum Begriff der Kontingenz.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf den Roman "Der Richter und sein Henker", der eine Wette als Ausgangspunkt nimmt und Bärlachs ambivalentes Verhältnis zum Zufall sowie die Figur des nihiistischen Gastmanns als seinen Gegenspieler beleuchtet. Auch Tschanz, als Polizist und Mörder, sowie als Spielfigur Bärlachs, wird in diesem Kapitel behandelt.
Im vierten Kapitel wird "Der Verdacht" analysiert. Es geht um Dr. Emmenberger, der als Spiegelfigur zu Gastmann erscheint und die Bestätigung der These Bärlachs sowie die Philosophie des Bösen repräsentiert. Das Kapitel beleuchtet außerdem den Zufall als bestimmenden Faktor, die verhängnisvolle Hoffnung auf das Unwahrscheinlichste und Bärlachs naiven Plan. Schließlich wird die Frage nach der Ohnmacht des Menschen und der Abschied von der heilen Welt diskutiert.
Das fünfte Kapitel widmet sich "Das Versprechen" und zeigt, wie der Film "Es geschah am helllichten Tag" als Dürrenmatts konventionellste Detektivgeschichte gilt. Die Rahmenhandlung dient als explizite Kritik am Kriminalroman, wobei Dr. H. die Gattung und das notwendige Arrangement mit dem Zufall kritisiert. Das Kapitel analysiert auch die Binnenhandlung als Exempel und die Rolle des Zufalls im Fall Gritli Moser sowie das Scheitern von Kommissär Matthäi am Zufall.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Dekonstruktion des klassischen Kriminalromans, dem Einfluss des Zufalls auf die menschliche Existenz, der Kritik an der Vorstellung einer heilen Welt und der Rolle des Detektivs in der Kriminalgeschichte. Wesentliche Schlüsselbegriffe sind: Zufall, Kontingenz, Kriminalroman, Gattungskritik, Friedrich Dürrenmatt, "Der Richter und sein Henker", "Der Verdacht", "Das Versprechen", Bärlach, Gastmann, Tschanz, Dr. Emmenberger, Kommissär Matthäi.
- Quote paper
- Mareike Heins (Author), 2021, Der Zufall als Instrument der Gattungskritik in den Kriminalromanen Friedrich Dürrenmatts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1417403