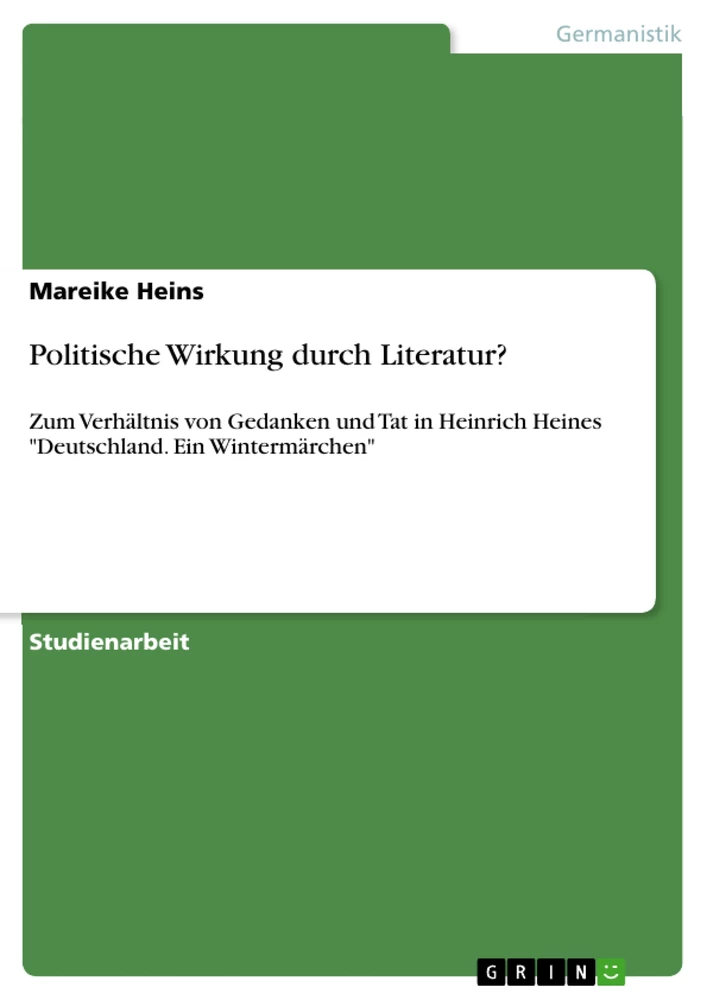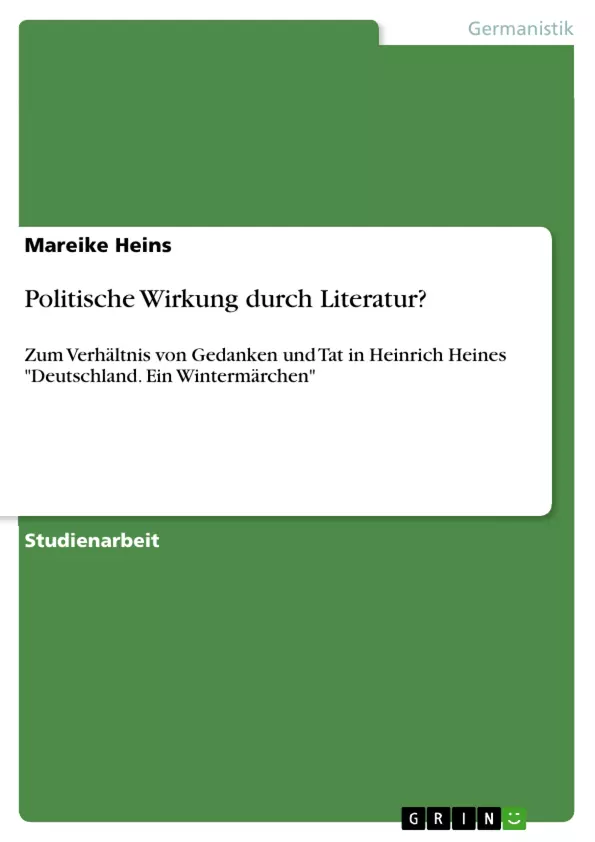Die Untersuchung thematisiert Heinrich Heines 1844 verfasstes und veröffentlichtes Versepos „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Genauer ins Auge gefasst werden dabei die Frage nach den Möglichkeiten von Literatur, politische Wirkung zu erzielen – direkt oder indirekt. In diesem Zusammenhang wird auch das Verhältnis von Gedanken und Tat betrachtet.
Zunächst wird kurz dargestellt, welches Bild von Deutschland sich dem lyrischen Ich des Wintermärchens präsentiert und welche Kritik daran vorgenommen wird. Anschließend wird das im Text versprochene ‚bessere Lied‘ thematisiert, d.h., die Wünsche und Ansprüche, die an ein zukünftiges Deutschland gestellt werden.
Exemplarisch betrachtet wird hierzu der Inhalt der Capita VI und VII, die sich in Köln abspielen. Anhand der hier auftretenden Figur des Liktors wird untersucht, in welchem Verhältnis die Gedanken und Ideen des Dichters zu ihrer Umsetzung in die Tat stehen. Welche Rolle spielt der Liktor und welche Verantwortung trägt der Dichter?
Anschließend werden die sprachlichen und stilistischen Mittel untersucht, derer Heine sich bedient, um seine Gedanken auch unter den kritischen Verhältnissen des damaligen Deutschlands an das Volk heranzutragen und seinen (literarischen) Beitrag zur politischen Lage zu leisten: Wie gelingt es Heine, seine kritischen und revolutionär geprägten Gedanken über eine breite Masse zu verteilen und zugleich der herrschenden Zensur weitestgehend zu entgehen?
Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst: Wie verhalten sich der Gedanke sowie seine Umsetzung in die Tat zueinander und welche Rolle spielen der Dichter sowie sein literarisches Schaffen in diesem Kontext?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Ein neues Lied, ein besseres Lied“?
- Heines Kritik an den deutschen Verhältnissen
- Forderungen an ein besseres Deutschland
- Richter und Büttel?
- Die Figur des Liktors
- Das Verhältnis von Gedanke und Tat
- Stilistische Besonderheiten
- Die äußere Form
- Das lyrische Ich
- Ironie und Nicht-Gesagtes als Mittel der Zensurumgehung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (1844) hinsichtlich der Frage, ob und wie Literatur politische Wirkung erzielen kann, direkt oder indirekt. Dabei wird das Verhältnis von Gedanken und Tat beleuchtet, ein Aspekt, der von Heine selbst im Text thematisiert wird.
- Kritik an den deutschen Verhältnissen der 1840er Jahre, insbesondere an Zensur und Mangel an Fortschritt
- Heines Vision eines „besseren“ Deutschlands und die dafür notwendigen politischen Veränderungen
- Analyse der Figur des Liktors in den Capita VI und VII, um das Verhältnis von Gedanken und Tat zu beleuchten
- Untersuchung der stilistischen Mittel, die Heine verwendet, um seine Kritik an den deutschen Verhältnissen zum Ausdruck zu bringen und die Zensur zu umgehen
- Zusammenführung der Ergebnisse und Diskussion der Rolle des Dichters und seines literarischen Schaffens im Kontext der politischen Situation.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt die Thematik vor und führt die zentrale Frage nach der politischen Wirkung von Literatur und dem Verhältnis von Gedanken und Tat ein.
- „Ein neues Lied, ein besseres Lied“?: Dieses Kapitel analysiert Heines Kritik an den deutschen Verhältnissen der 1840er Jahre, die er im „Wintermärchen“ zum Ausdruck bringt. Dabei werden Themen wie Zensur und Mangel an Fortschritt beleuchtet.
- Richter und Büttel?: Das Kapitel untersucht die Figur des Liktors in den Capita VI und VII und beleuchtet damit das Verhältnis von Gedanken und Tat. Es wird diskutiert, welche Rolle der Liktor spielt und welche Verantwortung der Dichter trägt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie politischer Wirkung von Literatur, dem Verhältnis von Gedanken und Tat, Zensur, Fortschritt und der Kritik an den deutschen Verhältnissen der 1840er Jahre. Der Fokus liegt auf der Analyse von Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ und seinen stilistischen Besonderheiten, insbesondere der Ironie als Mittel zur Zensurumgehung.
- Quote paper
- Mareike Heins (Author), 2019, Politische Wirkung durch Literatur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1417515