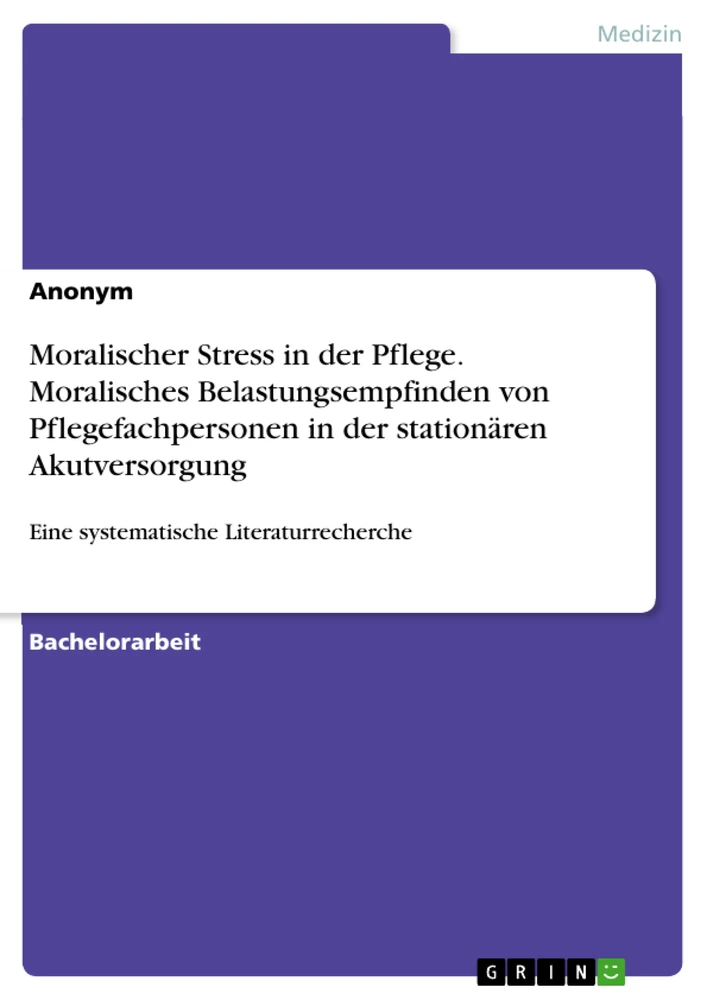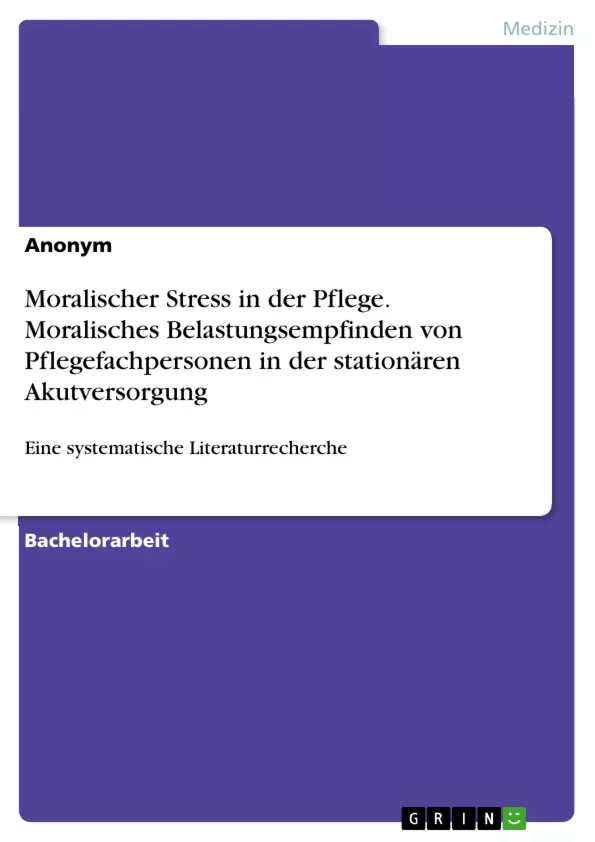Das Ziel der Arbeit ist, moralische Belastungen bei Pflegefachpersonen im akutstationären Setting ausfindig zu machen und Bewältigungsmöglichkeiten darzustellen. Dazu wird folgende Forschungsfrage gestellt: In welcher Weise können Pflegefachpersonen in der akut stationären Versorgung unterstützt werden, um moralischen Belastungen entgegenzuwirken? Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine systematische Literaturrecherche zur aktuellen Evidenz in verschiedenen Fachdatenbanken durchgeführt und anschließend anhand von Gütekriterien bewertet.
Pflegefachpersonen sind in der heutigen Zeit aufgrund gesellschaftlicher und medizintechnischer Entwicklungen sowie den darauffolgenden ethischen Fragestellungen gefordert, sich in ihrer Pflegepraxis immer wieder neu zu positionieren. Eine hohe Arbeitsbelastung liegt dem ständigen Wandel des Gesundheitssystems zugrunde. In den letzten Jahren zeigte sich ein deutlicher Anstieg an psychischen Erkrankungen unter Pflegenden, der zu einem frühzeitigen Berufsausstieg führte. Nicht nur körperliche Erkrankungen treten auf, sondern auch der berufliche Stress sorgt für ein moralisches Belastungsempfinden. Diese hängt wiederum mit moralischen Belastungen zusammen.
Die Forschung im Bereich der Pflegeethik untersucht seit Jahren ethische Dilemmata sowie die Verbesserung der Entscheidungsfindung und die Einführung von Bildung im Gesundheitswesen. Während ihrer täglichen Pflegepraxis müssen Pflegefachpersonen moralische Entscheidungen treffen. Diese gehen in erster Linie nach den eigenen Vorstellungen und ethischen Werten einher. In vielen klinischen Fällen stehen die Prinzipien der Ethik im Widerspruch mit der individuellen Wahrnehmung der Pflegefachperson. Moralische Belastungen sind Situationen, die zum moralischen Nachdenken anregen. Sie führen dazu, dass Pflegefachpersonen einerseits eine individuelle und professionelle Pflege ausüben möchten, andererseits sind die Arbeitsabläufe im Pflegealltag rational zu streng zu organisieren. Der Personalmangel erschwert es auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten*innen einzugehen. Es entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den eigenen Ansprüchen und dem moralischen Stresserleben.
Abschließend werden mögliche Bewältigungswege aufgezeigt, die sich auf den Stellenwert in einer moralischen Stresssituation in der Pflege beziehen. Die letzten beiden Kapitel befassen sich mit dem Diskussionsteil und ein Ausblick wird anschließend gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergrund und Problemstellung
- 2.1 Rahmenbedingungen im akutstationären Setting
- 2.2 Besondere Herausforderungen aufgrund der Corona Pandemie
- 3. Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Definitionen im Hinblick auf moralisches Belastungserleben
- 3.2 Ursachen und Entstehungsbedingungen
- 3.3 Auswirkungen von moralischer Belastungen
- 3.3.1 Burn-Out-Syndrom
- 3.3.2 Depression
- 3.3.3 Berufsausstieg
- 3.4 Ableiten der Forschungsfrage
- 4. Methodisches Vorgehen
- 4.1 Handsuche
- 4.2 Gestaltung der systematischen Literaturrecherche
- 4.3 PRISMA Flussdiagramm
- 4.4 Ein- und Ausschlusskriterien
- 4.5 Bewertung der Studienqualität
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Bewältigungsmöglichkeiten von moralischen Belastungen
- 5.2 Selbstmanagement und Resilienzförderung
- 5.2.1 Ethische Führungsebene
- 5.2.2 Ethische Reflexion
- 6. Diskussion
- 6.1 Inhaltliche Diskussion
- 6.2 Methodisches Vorgehen
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
- 7.1 Empfehlungen für die Forschung
- 7.2 Empfehlungen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das moralische Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen in der akutstationären Versorgung. Ziel ist es, Bewältigungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Forschungsfrage zu beantworten: Wie können Pflegefachpersonen unterstützt werden, um moralischen Belastungen entgegenzuwirken? Die systematische Literaturanalyse liefert Evidenz für die Gestaltung von Bewältigungsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen.
- Moralisches Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen
- Bewältigungsmöglichkeiten auf Teamebene, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention
- Einfluss von ethischem Klima und Führungskommunikation
- Rollen von Selbstpflegeprogrammen und ethischen Fallbesprechungen
- Bedarf an ethischen Edukationen in der deutschen Pflegekultur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des moralischen Belastungsempfindens von Pflegefachpersonen ein. Sie beschreibt den Kontext gesellschaftlicher und medizintechnischer Entwicklungen und den daraus resultierenden ethischen Herausforderungen. Der steigende Anteil psychischer Erkrankungen und der frühzeitige Berufsausstieg in der Pflege werden hervorgehoben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung moralischer Belastungen, deren Zusammenhänge mit beruflichem Stress und die Notwendigkeit der Erforschung von Bewältigungsstrategien werden betont. Abschließend wird ein Überblick über den Aufbau der Arbeit gegeben.
2. Hintergrund und Problemstellung: Dieses Kapitel beleuchtet die Rahmenbedingungen der Pflegearbeit im akutstationären Setting und die besonderen Herausforderungen, denen Pflegekräfte insbesondere im Kontext der Corona-Pandemie gegenüberstehen. Es werden Faktoren erörtert, die den beruflichen Handlungsspielraum der Pflegefachpersonen einschränken und zu moralischen Belastungen beitragen können. Die Darstellung der Problematik bildet die Grundlage für die Formulierung der Forschungsfrage.
3. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es umfasst Definitionen des moralischen Belastungserlebens, die Ursachen und Entstehungsbedingungen, und die Auswirkungen, wie beispielsweise Burn-out, Depressionen und Berufsausstieg. Der Abschnitt leitet schlussendlich zur Forschungsfrage über und etabliert ein fundiertes Verständnis des zu untersuchenden Phänomens.
4. Methodisches Vorgehen: Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten systematischen Literaturrecherche, inklusive der Suchstrategie, der Ein- und Ausschlusskriterien sowie der Bewertung der Studienqualität nach definierten Gütekriterien. Die Transparenz des methodischen Vorgehens ist essentiell für die Nachvollziehbarkeit und die Bewertung der Ergebnisse.
5. Darstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse. Der Fokus liegt auf den identifizierten Bewältigungsmöglichkeiten von moralischen Belastungen, unterteilt in die Ebenen Team, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Die Bedeutung von Selbstmanagement und Resilienzförderung, ethischer Führung und ethischer Reflexion werden ausführlich dargestellt.
6. Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie eingehend diskutiert. Sowohl inhaltliche als auch methodische Aspekte der Untersuchung werden kritisch reflektiert und in den Kontext der bestehenden Literatur eingeordnet. Es werden mögliche Limitationen der Studie angesprochen und der Mehrwert der Ergebnisse für die Praxis und die Forschung hervorgehoben. (Die Unterkapitel 6.1 und 6.2 werden hier nicht separat zusammengefasst, sondern in den Gesamtkontext des Diskussionskapitels integriert).
Schlüsselwörter
Moralisches Belastungsempfinden, Pflegefachpersonen, Akutstationäre Versorgung, systematische Literaturanalyse, Bewältigungsmöglichkeiten, Resilienz, ethische Führung, Selbstmanagement, Burn-out, Depression, Berufsausstieg, ethische Edukation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Moralisches Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen in der akutstationären Versorgung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das moralische Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen in der akutstationären Versorgung. Sie analysiert Bewältigungsmöglichkeiten und beantwortet die Forschungsfrage: Wie können Pflegefachpersonen unterstützt werden, um moralischen Belastungen entgegenzuwirken?
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Moralisches Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen, Bewältigungsmöglichkeiten auf Teamebene, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention, Einfluss von ethischem Klima und Führungskommunikation, Rolle von Selbstpflegeprogrammen und ethischen Fallbesprechungen sowie den Bedarf an ethischen Edukationen in der deutschen Pflegekultur.
Welche Methoden wurden angewendet?
Es wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, inklusive Suchstrategie, Ein- und Ausschlusskriterien sowie Bewertung der Studienqualität nach definierten Gütekriterien. Die Methodik wird detailliert im Kapitel 4 beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die systematische Literaturanalyse identifizierte Bewältigungsmöglichkeiten von moralischen Belastungen auf den Ebenen Team, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Die Bedeutung von Selbstmanagement und Resilienzförderung, ethischer Führung und ethischer Reflexion wurden hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Hintergrund und Problemstellung, Theoretischer Hintergrund, Methodisches Vorgehen, Darstellung der Ergebnisse, Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt und in der Zusammenfassung der Kapitel inhaltlich beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse kritisch, berücksichtigt methodische Aspekte und ordnet die Ergebnisse in den Kontext bestehender Literatur ein. Mögliche Limitationen werden angesprochen und der Mehrwert für Praxis und Forschung hervorgehoben. Empfehlungen für Forschung und Praxis werden formuliert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Moralisches Belastungsempfinden, Pflegefachpersonen, Akutstationäre Versorgung, systematische Literaturanalyse, Bewältigungsmöglichkeiten, Resilienz, ethische Führung, Selbstmanagement, Burn-out, Depression, Berufsausstieg, ethische Edukation.
Welche konkreten Auswirkungen von moralischen Belastungen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen von moralischen Belastungen wie Burn-out-Syndrom, Depressionen und Berufsausstieg bei Pflegefachpersonen.
Wie wird der theoretische Hintergrund der Arbeit aufgebaut?
Der theoretische Hintergrund umfasst Definitionen des moralischen Belastungserlebens, die Ursachen und Entstehungsbedingungen sowie die Auswirkungen. Er dient als Grundlage für die Formulierung der Forschungsfrage.
Wie ist die Struktur der Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die in die Thematik einführt. Es folgt die Darstellung des Hintergrunds und der Problemstellung. Der theoretische Hintergrund wird erläutert, bevor die Methodik detailliert beschrieben wird. Die Ergebnisse werden präsentiert, diskutiert und schließlich werden Zusammenfassung und Ausblick gegeben.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2023, Moralischer Stress in der Pflege. Moralisches Belastungsempfinden von Pflegefachpersonen in der stationären Akutversorgung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1417695