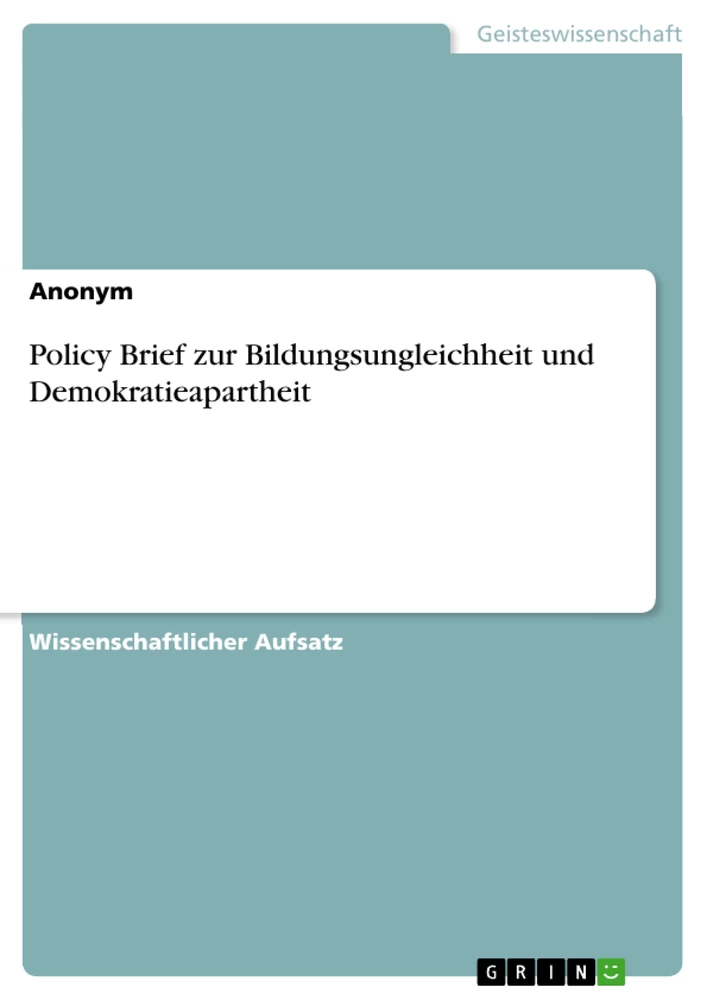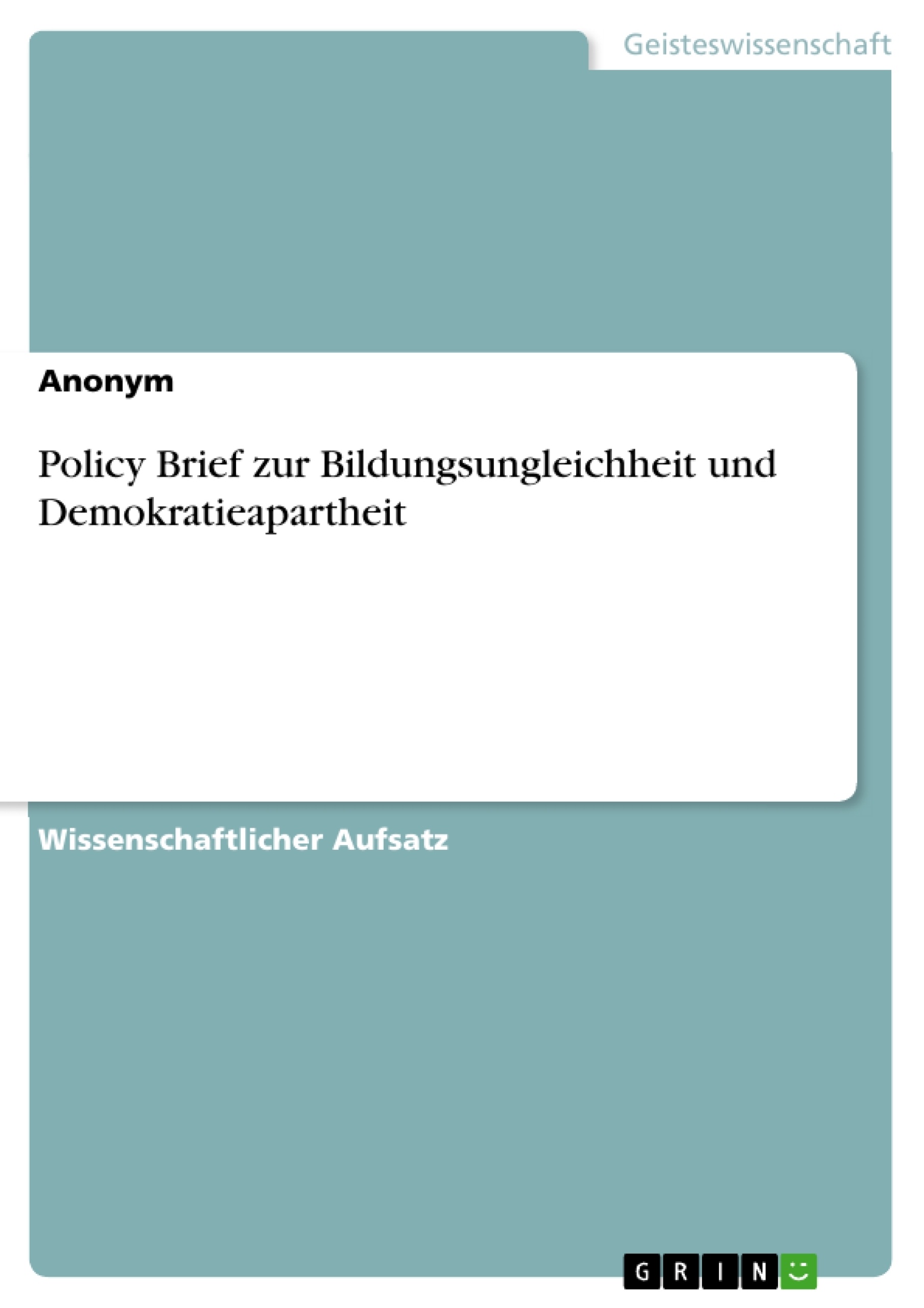Die Corona-Pandemie hat an den Schulen bestehende Ungleichheitsstrukturen offengelegt. Schon vor der Corona-Krise zeichnete sich das deutsche Bildungssystem dadurch aus, dass Bildungschancen stark von der sozialen Herkunft der Kinder und Jugendlichen abhängig waren. Der Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer Herkunft ist in Deutschland so stark wie in kaum einem anderen Land der OECD.
Ungleichheit wird im Folgenden verstanden als eine anhaltende, wenn nicht gleich sogar dauerhafte Ungleichverteilung materieller Ressourcen, aber auch von Respekt im Hinblick auf den gesellschaftlichen Status sowie von Zugangsrechten und Repräsentation, die nicht auf persönliche Leistungsunterschiede zurückzuführen, sondern dem Kapitalismus geschuldet sind.
Im Mittelpunkt bisheriger Diskurse um Bildungsgerechtigkeit steht häufig die soziale Ungleichheit und die mit ihr zusammenhängenden unterschiedlichen Ausgangslagen eines jeden Individuums. Bildungsgerechtigkeit als pädagogisches Handlungsziel und Zielsetzung bildungspolitischer Interventionen zielt auf den Abbau von Diskriminierung, einen chancengerechten Zugang zu (Bildungs-)Ressourcen und der Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. Bildungsungleichheiten beziehen sich auf eine Reihe sozialstruktureller Merkmale, die zu einer ungleichen Verteilung von Bildung führen können. Dazu gehören Merkmale wie die soziale Herkunft, der soziale Hintergrund oder sozioökonomische Status, Gender oder das Geschlecht sowie die kulturelle Herkunft im Zusammenhang mit Migrationshintergrund und ethnischer Zugehörigkeit und Sprache.
Der bildungspolitische Diskurs zum Thema Bildungsgerechtigkeit wird noch immer zentral von der Post-PISA Debatte geprägt, die den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in den Mittelpunkt gerückt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Bildungsungleichheit in Deutschland
- Die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf die Bildung
- Aktuelle Policy
- Fazit/Handlungsaufforderungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Policy Brief befasst sich mit der Bildungsungleichheit in Deutschland, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde. Er untersucht die Auswirkungen der Pandemie auf das Bildungssystem und analysiert die Politikmaßnahmen, die zur Bewältigung der Situation ergriffen wurden.
- Bildungsungleichheit und soziale Ungleichheit
- Einfluss der Corona-Pandemie auf die Bildungschancen
- Lernrückstände und psychosoziale Folgen
- Politische Maßnahmen und deren Wirksamkeit
- Demokratiedefizit und mangelnde Transparenz
Zusammenfassung der Kapitel
Bildungsungleichheit in Deutschland
Dieses Kapitel beleuchtet die bestehenden Bildungsungleichheiten in Deutschland, die durch die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler verstärkt werden. Der Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer Herkunft ist in Deutschland besonders stark ausgeprägt, was zu unterschiedlichen Bildungschancen führt.
Die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf die Bildung
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das deutsche Bildungssystem. Es wird deutlich, dass die Schulschließungen und das Homeschooling nicht alle Schülergruppen gleich hart getroffen haben. Besonders Kinder und Jugendliche aus den unteren sozialen Schichten waren von den negativen Folgen betroffen, was die bestehende Bildungsungleichheit noch verstärkte.
Aktuelle Policy
Dieses Kapitel untersucht die politischen Maßnahmen, die zur Bewältigung der coronabedingten Lernrückstände ergriffen wurden. Es werden die Inhalte des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ sowie die darin enthaltenen Maßnahmen zur Förderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern dargestellt. Zudem wird die Rolle des Bundes und der Länder bei der Umsetzung des Programms beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Corona-Pandemie, Schulschließungen, Homeschooling, Lernrückstände, psychosoziale Folgen, Politikmaßnahmen, Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“, Demokratiedefizit, Transparenz, soziale Ungleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancen, soziale Herkunft.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Policy Brief zur Bildungsungleichheit und Demokratieapartheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1417853