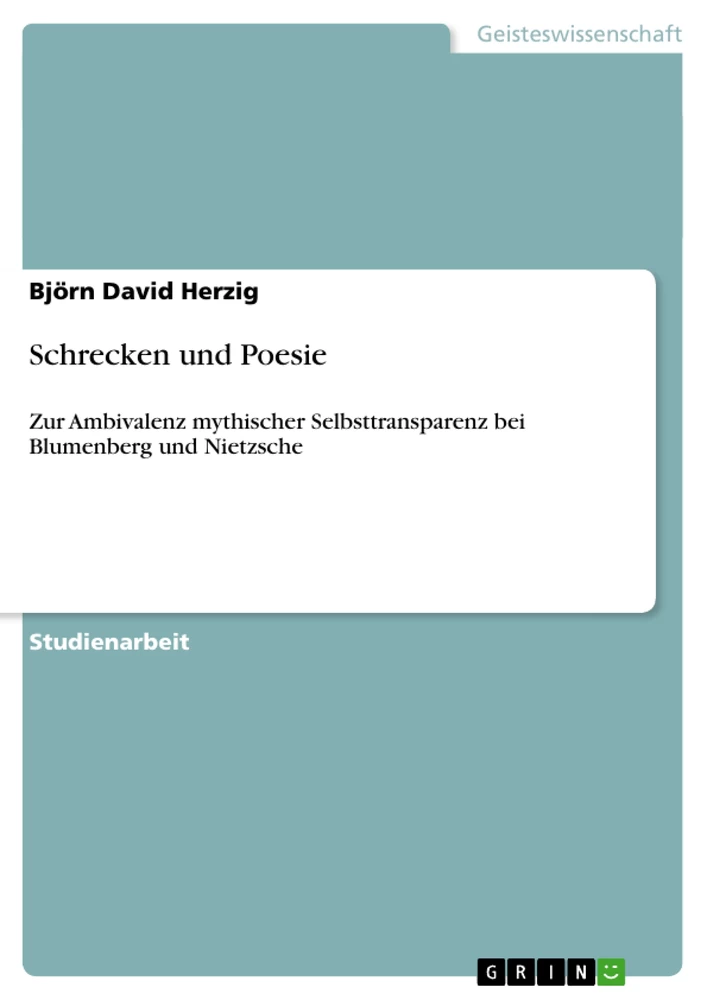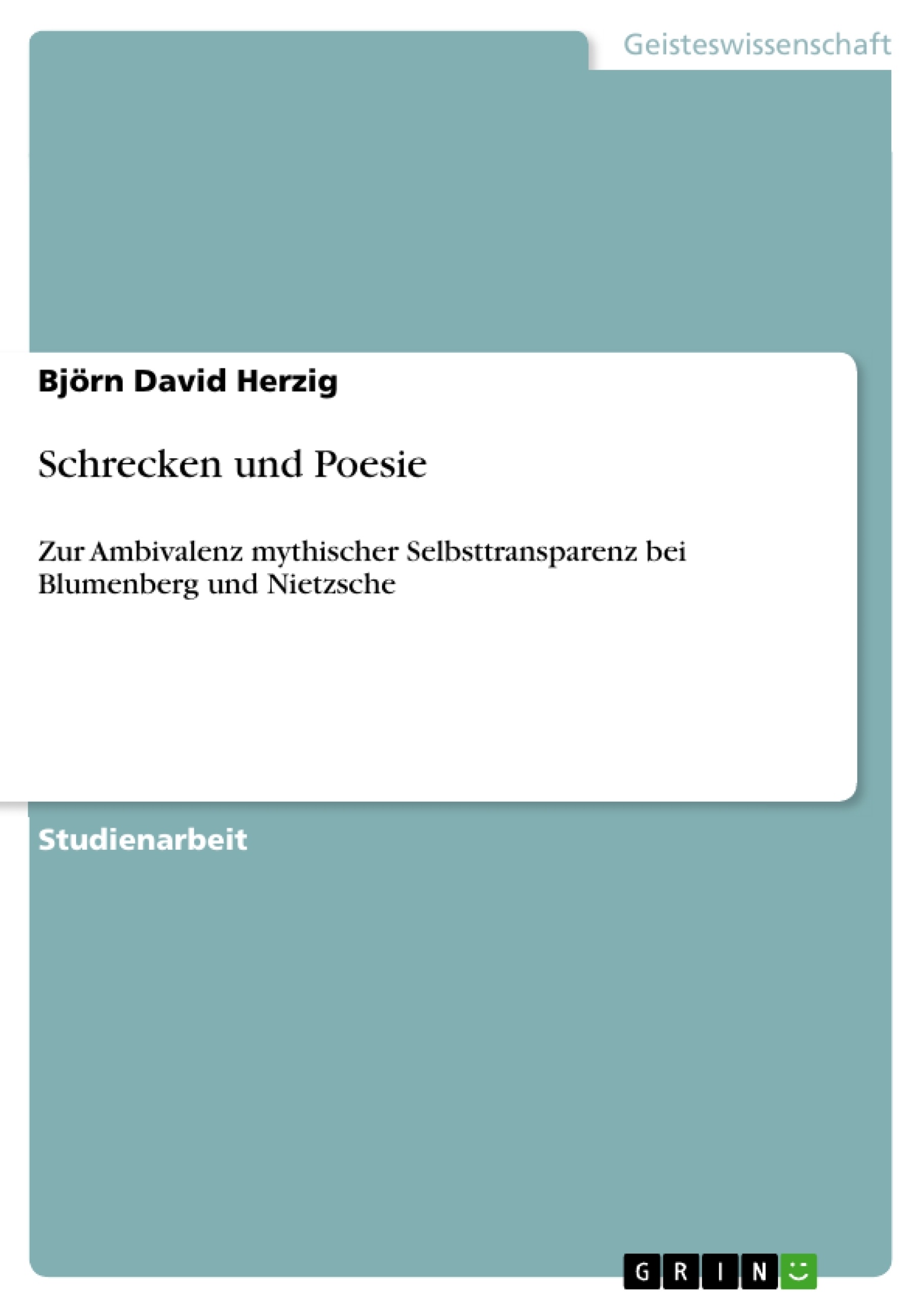Schrecken und Poesie – dieses polare Begriffspaar reicht aus, um das Weltverhältnis des Menschen, wie es Hans Blumenberg (1920 – 1996) in seiner kulturtheoretischen Studie "Arbeit am Mythos" (1979) beschreibt, auf seine kürzeste Formel zu bringen: Schrecken, damit ist die epiphanische Initialerfahrung des Menschen gemeint, der sich seiner Differenz zu den Dingen ringsum bewußt wird, aber noch keine kulturellen Deutungsmuster besitzt, um sich dieselben in differenzierter Form anzueignen. Weil ihm die Möglichkeit zum rational-ordnenden Zugriff noch fehlt, kann er die Wirklichkeit nicht anders denn als intransparente Front unverfügbarer Faktizität erfahren, deren allgegenwärtige Übermacht 'namenloses Entsetzen' evoziert. Poesie, im Gegensatz hierzu, bezeichnet die Summe menschlicher Abwehrreflexe, die sich vor diesem Hintergrund konstituieren. Vom Willen zur Selbstbehauptung motiviert, entwirft das bewußtgewordene Subjekt Strategien der Entlastung, welche auf eine möglichst umfassende Verdrängung der übermächtigen Wirklichkeit abzielen. -
Analog zum bipolaren Ansatz Blumenbergs, der menschlich-kulturelle Existenz im Spannungsfeld von absoluter Wirklichkeit und humaner Selbstbehauptung verortet, steht die bereits 100 Jahre zuvor von Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in seiner kulturphilosophischen Programmschrift "Die Geburt der Tragödie" (1872) entworfene duale Grundkonzeption von archaischem Pessimismus und ästhetisch-metaphysischer Selbsterlösung: Wie Blumenberg postuliert Nietzsche eine epiphanische Kontingenzerfahrung als anthropologische Ausgangssituation menschlicher Existenz und versteht Kultur vor diesem Hintergrund als überlebensstrategischen Defensivmechanismus, dessen Wert in seinem Potential zur Emanzipation vom Schrecken des Daseins besteht. - Im Rahmen der vorliegenden Arbeit möchte ich versuchen, anhand einer parallelen Lektüre beider Texte Blumenbergs bzw. Nietzsches Verständnis von Aufgabe und Funktion des Mythos präzise zu bestimmen. Wie gezeigt werden soll, sind mythopoetische Leistungen in beiden Modellen zunächst wesentlich über ihr Potential definiert, die 'anthropomorphe Lebenswelt' bzw. den 'Schein des Individuellen' zur ausschließlichen Wirklichkeit zu verklären. Ausgehend von dieser Diagnose möchte ich kritisch nach der anthropologischen Unhintergehbarkeit der hier angenommenen Kompensationsfunktion fragen: Könnte Kultur vielleicht auch im Dienste einer anderen Wahrheit stehen als der bloßen Affirmation lebensweltlichen Scheins?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Kultur als humane Selbstbehauptung?
- Kontingenz und Entlastung: Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (1979)
- Absolutismus der Wirklichkeit, Allmacht der Vorstellungen: Menschliches Dasein innerhalb seiner Grenzwerte
- Grammatik der Distanz: Namen, Bedeutsamkeiten, Verfahrensordnungen
- Mythische Verzögerung: Der Umweg übers Ungeheuerliche
- Silenische Weisheit und ästhetische Metaphysik: Friedrich Nietzsches Geburt der Tragödie (1872).
- Dialektik der Erlösung: Apollon vs. Dionysos
- ,Tragischer Mythus' und immanenter Trost
- Distanz oder Identifikation? - Mythische Selbsttransparenz und ihre Folgen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die kulturtheoretischen Ansätze von Hans Blumenberg und Friedrich Nietzsche hinsichtlich des Mythos vergleichend zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie beide Denker das Verhältnis von menschlicher Selbstbehauptung und der Erfahrung der Absurdität des Daseins beschreiben und inwiefern sie die Funktion des Mythos als Entlastungsphänomen verstehen.
- Die Ambivalenz des Mythos als Entlastungsphänomen und Instrument der Selbstbehauptung
- Die Rolle des Schrecken und der Poesie in der menschlichen Kultur
- Die Frage nach der Selbsttransparenz des Mythos und seine ontologischen Ursprünge
- Die Bedeutung des Anthropozentrismus und der Frage nach dem Verhältnis von Vorstellung und Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- In der Einleitung wird das Begriffspaar Schrecken und Poesie als Grundmotiv für die Analyse von Blumenbergs und Nietzsches Verständnis des Mythos vorgestellt.
- Kapitel 1 widmet sich Hans Blumenbergs Analyse der ,Arbeit am Mythos', indem es die zentrale These vom Mythos als überlebensstrategischem Defensivmechanismus erläutert. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der anthropologischen Grundsituation, der Erfahrung der ,absolutistischen Wirklichkeit' und den Strategien der ,Entlastung', welche durch die mythische ,Verzögerung' erreicht werden.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit Friedrich Nietzsches ,Geburt der Tragödie', indem es die Dialektik von apollonischer und dionysischer Kultur und die Bedeutung des ,Tragischen Mythus' als Instrument der ,Selbsttransparenz' und ,Erhebung' über den Schrecken des Daseins behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den Schlüsselbegriffen des Mythos, der Selbsttransparenz, der Absurdität, des Anthropozentrismus, des Schrecken und der Poesie. Sie untersucht die kulturtheoretischen Ansätze von Hans Blumenberg und Friedrich Nietzsche, die sich mit dem Menschen in seiner Relation zur Welt, der Frage nach der Bedeutung und Funktion des Mythos sowie der Bedeutung der Kontingenz auseinandersetzen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Hans Blumenberg unter "Arbeit am Mythos"?
Er versteht darunter den Prozess, durch den der Mensch den "Absolutismus der Wirklichkeit" und das damit verbundene Entsetzen durch Erzählungen und Namen handhabbar macht.
Wie definiert Friedrich Nietzsche die Funktion des Mythos?
In "Die Geburt der Tragödie" sieht Nietzsche den Mythos als ästhetisch-metaphysische Selbsterlösung, die den Menschen über den Schrecken des Daseins erhebt.
Was bedeuten "Schrecken" und "Poesie" in diesem Kontext?
"Schrecken" ist die Ur-Erfahrung der übermächtigen Wirklichkeit; "Poesie" bezeichnet die Summe kultureller Abwehrreflexe und Strategien zur Entlastung des Menschen.
Was ist die "Silenische Weisheit"?
Ein von Nietzsche aufgegriffener Mythos, der besagt, dass das Beste für den Menschen sei, gar nicht erst geboren zu sein – eine Einsicht, die durch die Kunst (das Apollonische) erträglich gemacht werden muss.
Welche Rolle spielen Apollon und Dionysos?
Sie stehen für zwei gegensätzliche Kunsttriebe: Apollon für den schönen Schein und die Individuation, Dionysos für den Rausch und die Aufhebung der Grenzen.
- Citar trabajo
- M.A. Björn David Herzig (Autor), 2005, Schrecken und Poesie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141824