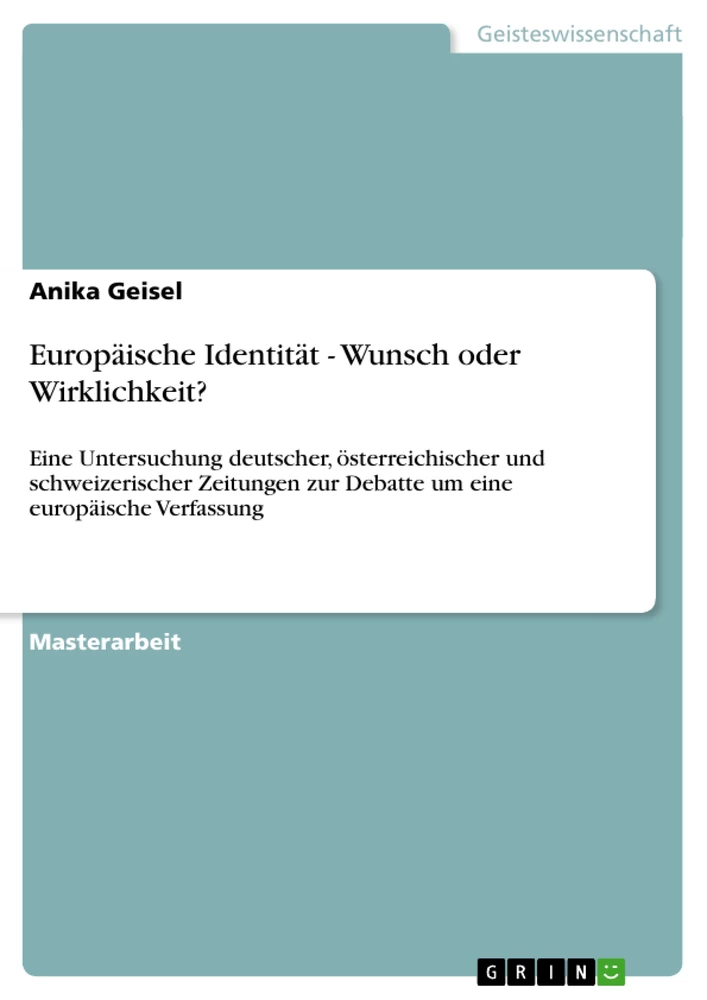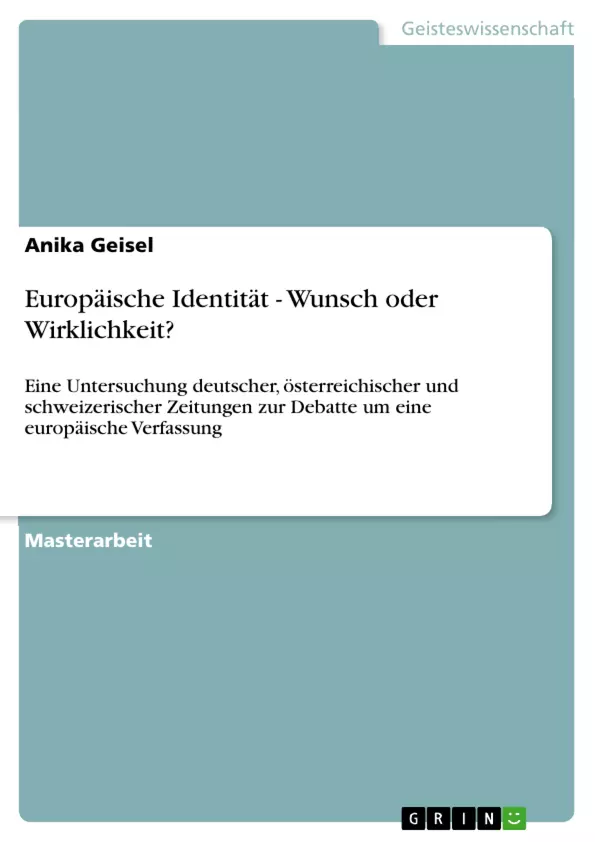Die Debatte um eine europäische Verfassung ist geprägt von Höhen und Tiefen. Nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005 verordnete sich die Europäische Union (EU) eine „Phase der Reflexion“, um gemeinsam mit den Bürgern Europas über die Zukunft der Union nachzudenken (Weidenfeld 2008, S. 78). Erst 2007 gelang es unter dem deutschen Ratsvorsitz die Verfassung wieder aus der Schublade zu holen und einen erneuten Anlauf – diesmal unter dem Namen „Vertrag von Lissabon“ – zu wagen.
Es gibt sowohl in den akademischen als auch in den politischen Debatten einen tief greifenden Konsens darüber, dass die Europäische Union heute weit davon entfernt ist, sich auf ein hinreichendes Maß politischer Bürgeridentität stützen zu können (Meyer 2008, S. 11). Am Beispiel Europas gerät ein Kategoriensystem auf den Prüfstand, so Neidhardt (2006, S. 46), dessen „zentrale Bezugsgröße, nämlich die ‚Gesellschaft‘, in den Sozialwissenschaften immer nur als ‚nationale Gesellschaft‘ vorgestellt war“. Der Verlust des Nationalstaats als Referenzrahmen impliziert eine Herausforderung der Europäischen Union: Die Schaffung einer kollektiven Identität der Europäer, die neben die nationale Identität tritt.
Ist ein starkes Gefühl kollektiver Identität der Europäer tatsächlich notwendig für eine politische und soziale Gemeinschaft oder reichen dazu auch starke gemeinsame Interessen? Die diffuse Unterstützung der Bevölkerung wird als essentiell für eine funktionierende politische Ordnung verstanden und ist insofern fest verknüpft mit der Idee einer kollektiven Identität (Risse 2001, S. 198). Gerhards schreibt (2003, S.470): „Die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen durch Minderheiten wird erleichtert und wahrscheinlicher, wenn sich die Minderheiten mit der EU identifizieren“. Umso mehr die Europäische Union an Bedeutung gewinnt, desto wichtiger wird auch die Frage nach der tatsächlichen Existenz einer europäischen Identität. Dies wird durch staatenübergreifende Probleme und Herausforderungen nur noch verstärkt; die Europäische Union wird in Zukunft immer weiter in der unmittelbaren Lebenswelt der Europäer verankert sein (Hermann/Brewer 2004, S. 3). Ziel dieser Masterarbeit ist es nun zu untersuchen, ob in der europäischen Verfassungsdebatte eine überwiegend nationale oder europäische Perspektive eingenommen wird. Mit Hilfe einer Frame-Analyse sollen außerdem Deutungsmuster bestimmt werden, die die Europäische Union näher beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2. Europa und die Europäische Union.........
- 2.1 Herausforderungen der Europäischen Union………………….
- 2.2 Defizite der Europäischen Union..........\n
- 3. Identität: Ursprünge der Forschung
- 3.1 Definition und Konzepte
- 3.2 Herausbildung von europäischer Identität..\n
- 3.2.1. Substantialismus
- 3.2.2. Funktionalismus.......
- 3.2.3. Prozeduralismus.......
- 3.3 Nationale Identität versus Europäische Identität...\n
- 3.4 Dimensionen einer europäischen Identität …………………….\n
- 3.4.1. Politische Dimension
- 3.4.2. Kulturelle Dimension........
- 3.4.3. Wirtschaftliche Dimension
- 3.4.4. Geographische Dimension
- 3.4.5. Rechtliche Dimension.........
- 3.5 Bisherige Operationalisierung von europäischer Identität..\n
- 3.5.1. In-groups versus out-groups.\n
- 4. Methodische Umsetzung.
- 4.1 Forschungsziel
- 4.1.1. Forschungsfragen und Operationalisierung..\n
- 4.1.2. Stichprobenauswahl
- 4.2 Die Verfassungsdebatte als Untersuchungsgegenstand.\n
- 4.2.1. Auswahl der Untersuchungsländer
- 4.2.2. Medienauswahl........
- 4.2.3. Festlegung des Stichprobenzeitraums und des Samplings der Zeitungsartikel ......
- 4.3 Die Frame-Analyse als Untersuchungsinstrument...\n
- 4.3.1. Die Entwicklung des Kategoriensystems
- 4.4 Vorbemerkungen zur statistischen Auswertung.\n
- 4.4.1. Intra-Kodierer-Reliabilitätstest..\n
- 5. Ergebnisse der Untersuchung
- 5.1 Allgemeine Merkmale der Daten....
- 5.2 Wir-Bezüge in der europäischen Verfassungsdebatte.\n
- 5.3 Abgrenzung nach außen......
- 5.4 Im Detail: die häufigsten Frames.......
- 5.5 Beziehung zwischen Wir-Bezügen, Frames, Sprechern, Nationalitäten und\nFunktionen
- 5.6 Was sagt uns das über eine europäische Identität?\n
- 6. Fazit und Ausblick......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Debatte um eine europäische Verfassung in deutschen, österreichischen und schweizerischen Zeitungen. Ziel ist es, durch die Analyse der verwendeten Frames und Wir-Bezüge die Konstruktion von europäischer Identität in den Medien zu erforschen.
- Die Herausforderungen und Defizite der Europäischen Union
- Konzepte und Ursprünge der europäischen Identität
- Dimensionen einer europäischen Identität
- Methodische Herangehensweise mittels Frame-Analyse
- Analyse von Wir-Bezügen und Frames in den ausgewählten Zeitungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Forschungsfrage und der Aufbau der Arbeit erläutert werden. Kapitel 2 beleuchtet die Herausforderungen und Defizite der Europäischen Union, die den Hintergrund für die Debatte um eine europäische Verfassung bilden. In Kapitel 3 werden verschiedene Konzepte und Theorien zur Herausbildung von europäischer Identität diskutiert. Hierbei werden insbesondere die Dimensionen einer europäischen Identität im Hinblick auf die Verfassungsdebatte fokussiert. Kapitel 4 beschreibt die methodische Umsetzung der Arbeit, die eine Frame-Analyse von Zeitungsartikeln aus Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 5 präsentiert, wo die Wir-Bezüge, Frames und deren Beziehung zu den Nationalitäten der Sprecher analysiert werden. Das Fazit und der Ausblick schließen die Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Europäische Identität, Verfassung, Frame-Analyse, Wir-Bezüge, Zeitungsanalyse, Medien, Nationale Identität, Herausforderungen der Europäischen Union, Defizite der Europäischen Union, Politische Dimension, Kulturelle Dimension, Wirtschaftliche Dimension, Geographische Dimension, Rechtliche Dimension.
Häufig gestellte Fragen
Existiert eine gemeinsame europäische Identität?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und stellt fest, dass die EU weit davon entfernt ist, eine hinreichende politische Bürgeridentität als Ersatz für nationale Identitäten zu besitzen.
Was ist eine Frame-Analyse?
Es ist eine Untersuchungsmethode, mit der Deutungsmuster (Frames) in Medien bestimmt werden, um zu verstehen, wie Themen wie die EU-Verfassung gerahmt werden.
Welche Dimensionen hat die europäische Identität?
Die Arbeit unterscheidet politische, kulturelle, wirtschaftliche, geographische und rechtliche Dimensionen der Identitätsbildung.
Warum ist die Verfassungsdebatte ein guter Untersuchungsgegenstand?
Anhand der Debatte lässt sich zeigen, ob Sprecher in den Medien eher eine nationale oder eine europäische Perspektive („Wir-Bezüge“) einnehmen.
Was bedeutet der Verlust des Nationalstaats als Referenzrahmen?
Es bedeutet, dass die EU eine kollektive Identität schaffen muss, um Akzeptanz für Mehrheitsentscheidungen zu finden, die über nationale Interessen hinausgehen.
- Quote paper
- Anika Geisel (Author), 2009, Europäische Identität - Wunsch oder Wirklichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141931