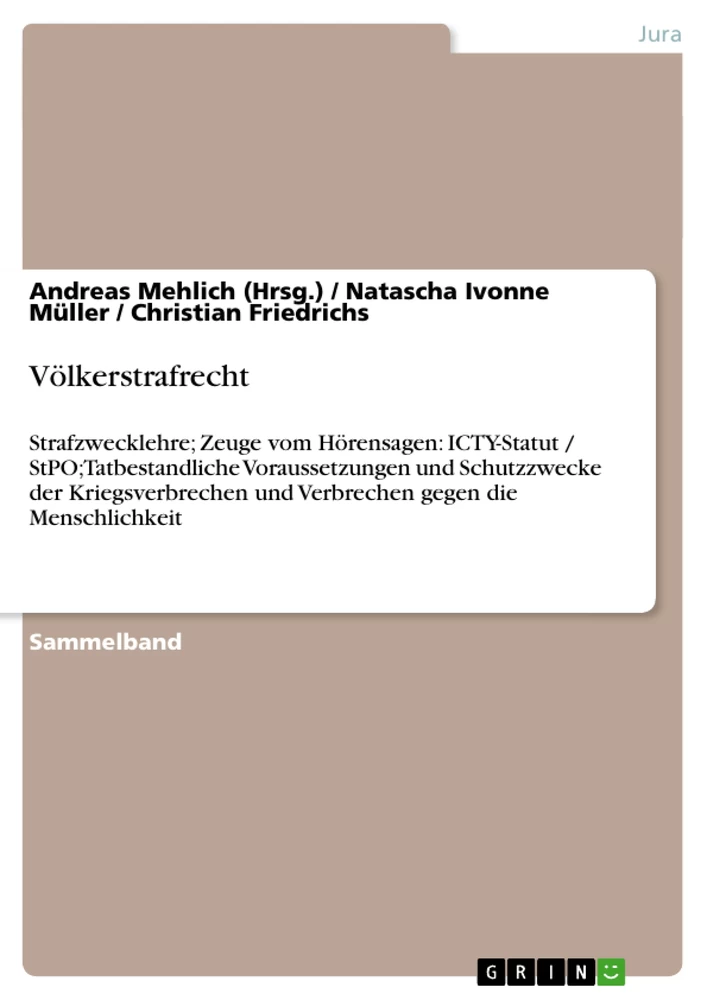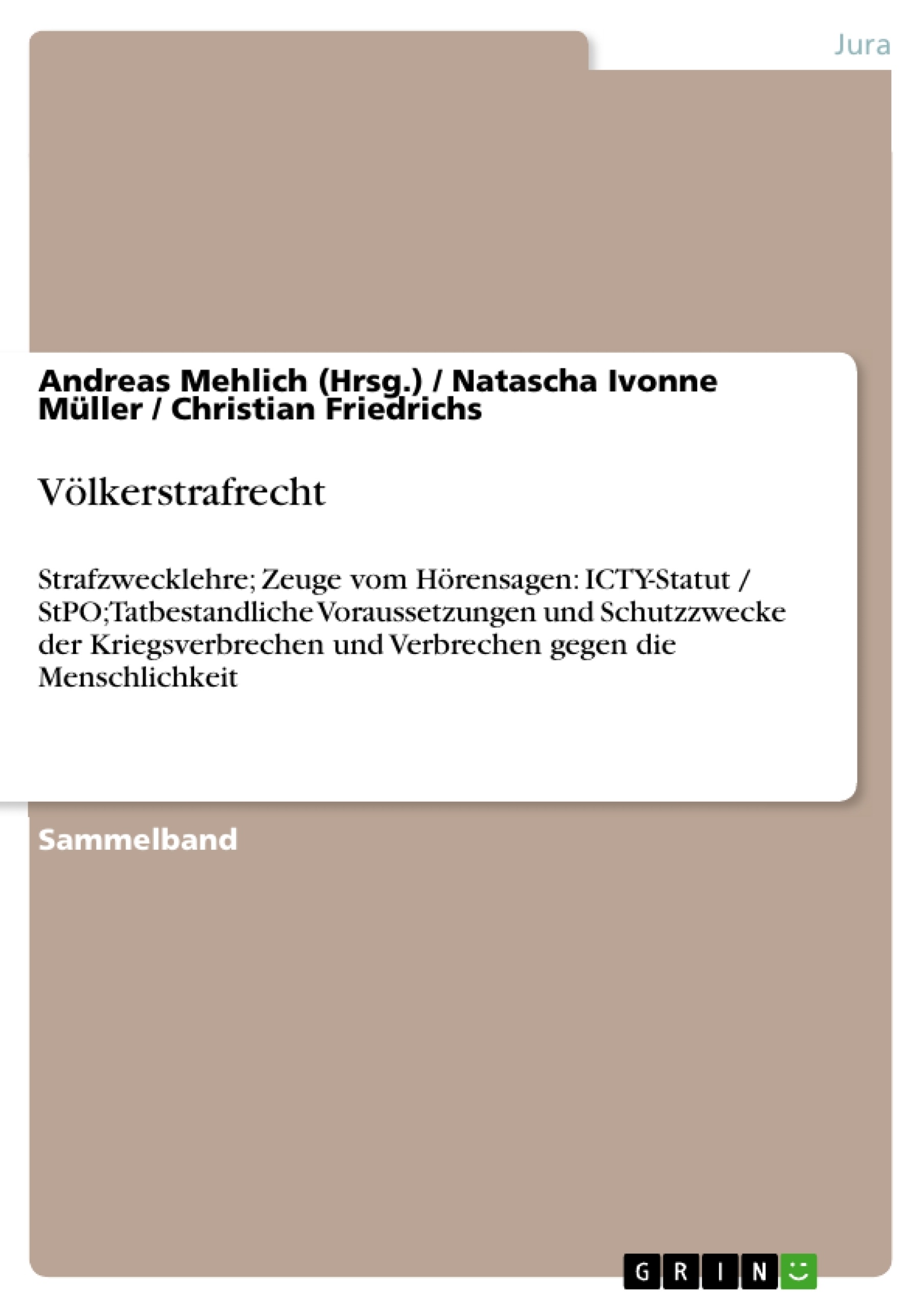Diese Arbeit umfasst drei Beiträge zu grundlegenden Problemstellungen des Völkerstrafrechts:
Andreas Mehlich behandelt die Fragestellung der Bedeutsamkeit der Strafzwecklehre im Völkerstrafrecht. Ausgehend von der klassischen Strafzwecklehre im nationalen Recht werden die einzelnen Zwecke auf die völkerstrafrechtliche Ebene projiziert. Hierbei werden die spezifischen völkerstrafrechtlichen Zielsetzungen analysiert und auf ihre Zweckmäßigkeit untersucht, ehe auf die Übertragbarkeit des gemeinhin bekannten klassischen Strafzweckkanons eingegangen wird. Schließlich werden sowohl dem nationalen Recht unbekannte, rein völkerstrafrechtliche Strafzwecke entwickelt als auch alternative Lösungsansätze jenseits der Bestrafung aufgezeigt sowie das Problem der Legitimation der Strafgewalt im Völkerstrafrecht diskutiert.
Natascha Ivonne Müller untersucht die rechtliche Stellung des Zeugen vom Hörensagen im deutschen Strafverfahren und vor dem ICTY. Dieser wird auf seine Funktion und Wirkung im Strafverfahren durchleuchtet, um eine entsprechende rechtstheoretische Einordnung vornehmen zu können. Unter Berücksichtigung der systemtypischen Abstufungen werden hierbei verschiedene Erklärungsmodelle dargestellt und die methodischen Konzeptionen miteinander verglichen.
Christian Friedrichs illustriert die tatbestandlichen Voraussetzungen und Schutzzwecke der
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei werden im Rahmen einer strikt normativen Betrachtung die einzelnen Deliktsmerkmale im Sinne der klassischen Strafrechtsdogmatik entwickelt und deren spezifischen Schutzwirkungen im jeweiligen Kontext erörtert. Die verschiedenen täterschaftlichen Konstituierungsmodi sind dabei ebenso Untersuchungsgegenstand wie die unterschiedlichen Begehungsformen, so dass insgesamt in die Ausgestaltung der völkerstrafrechtlichen Dogmatik eingeführt wird. Insofern wird ein Gesamtüberblick über die Systematik der völkerstrafrechtlichen Deliktsstrukturen gegeben und anhand der einschlägigen völker(straf)rechtlichen Verträge ein übergreifender Vergleich angestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Grundfragen des Völkerstrafrechts
- Die Bedeutsamkeit der Strafzwecklehre im Völkerstrafrecht
- A.) Einführung
- B.) Die klassischen Strafzwecktheorien
- I. Die absolute Straftheorie
- Der Zeuge vom Hörensagen im ICTY-Statut und in der StPO
- Tatbestandliche Voraussetzungen und Schutzzwecke der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Opuskulum hat zum Ziel, den Sinn des Strafens im Völkerstrafrecht darzulegen und aus dem Konglomerat disparater Strafzwecke einen Ansatz zu erarbeiten, der zur Begründung der Strafe darreicht. Hierbei steht die Fragestellung im Mittelpunkt, ob und inwieweit die traditionellen Strafzwecke auf völkerrechtliche Verbrechen übertragbar sind, um dementsprechende Modifizierungen der Strafzwecke aufzuzeigen.
- Übertragbarkeit der klassischen Strafzwecklehre auf völkerrechtliche Verbrechen
- Modifizierung der Strafzwecke im Völkerstrafrecht
- Neuartige Strafzwecke im Völkerstrafrecht
- Legitimation einer überstaatlichen Strafgewalt
- Bedeutung der Strafzwecke im Völkerstrafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einführung in die Thematik der Strafzwecklehre im Völkerstrafrecht. Es wird die aktuelle Relevanz des Themas im Kontext von völkerstrafrechtlichen Abkommen und prominenten Verurteilungen in der jüngeren Vergangenheit beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Justiziabilität makrokrimineller Taten auf supranationaler Ebene und der Frage, ob und inwieweit die traditionellen Strafzwecke auf völkerrechtliche Verbrechen übertragbar sind.
Das zweite Kapitel analysiert die klassischen Strafzwecktheorien, ohne Wertungen vorzunehmen. Es wird auf die dichotome Wirkung der Strafe in Form der absoluten Straftheorie und der relativen Straftheorien eingegangen, wobei die absolute Theorie auf die Vergangenheit und Vergeltung abstellt, während die relativen Theorien in die Zukunft blicken und auf Prävention ausgerichtet sind.
Das dritte Kapitel behandelt die absolute Straftheorie und ihre Wurzeln im Denken von Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Es wird die Legitimation für staatliche Strafe ausschließlich an der begangenen Straftat festgemacht und die Unvereinbarkeit des Menschen als Mittel zu den Absichten eines anderen mit der ihm zukommenden Menschlichkeit hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Völkerstrafrecht, Strafzwecklehre, Vergeltung, Prävention, absolute Straftheorie, relative Straftheorien, Internationale Strafgerichte, ICTY, Jugoslawien-Tribunal, Makrokriminalität, Rechtstheorie, Poenologie, historischer Abriss, supranationale Strafgerichtsbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Strafzwecklehre im Völkerstrafrecht?
Sie untersucht, warum internationale Verbrechen bestraft werden, und wägt zwischen Vergeltung (absolut) und Prävention sowie Resozialisierung (relativ) ab.
Können nationale Strafzwecke auf das Völkerrecht übertragen werden?
Nur bedingt; völkerrechtliche Taten (Makrokriminalität) erfordern oft spezifische Zwecke wie die Wiederherstellung des Weltfriedens oder die historische Wahrheitsfindung.
Was ist ein „Zeuge vom Hörensagen“?
Ein Zeuge, der nicht aus eigener Anschauung, sondern über Berichte Dritter aussagt. Dies wird vor internationalen Tribunalen wie dem ICTY anders bewertet als im deutschen Strafrecht.
Was unterscheidet Kriegsverbrechen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Kriegsverbrechen setzen einen bewaffneten Konflikt voraus, während Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch einen systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung gekennzeichnet sind.
Wie legitimiert sich überstaatliche Strafgewalt?
Die Legitimation basiert auf dem Schutz universeller Rechtsgüter und internationalen Verträgen, die sicherstellen sollen, dass schwerste Verbrechen nicht ungestraft bleiben.
- Citar trabajo
- Andreas Mehlich (Hrsg.) (Autor), Natascha Ivonne Müller (Autor), Christian Friedrichs (Autor), 2009, Völkerstrafrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141943