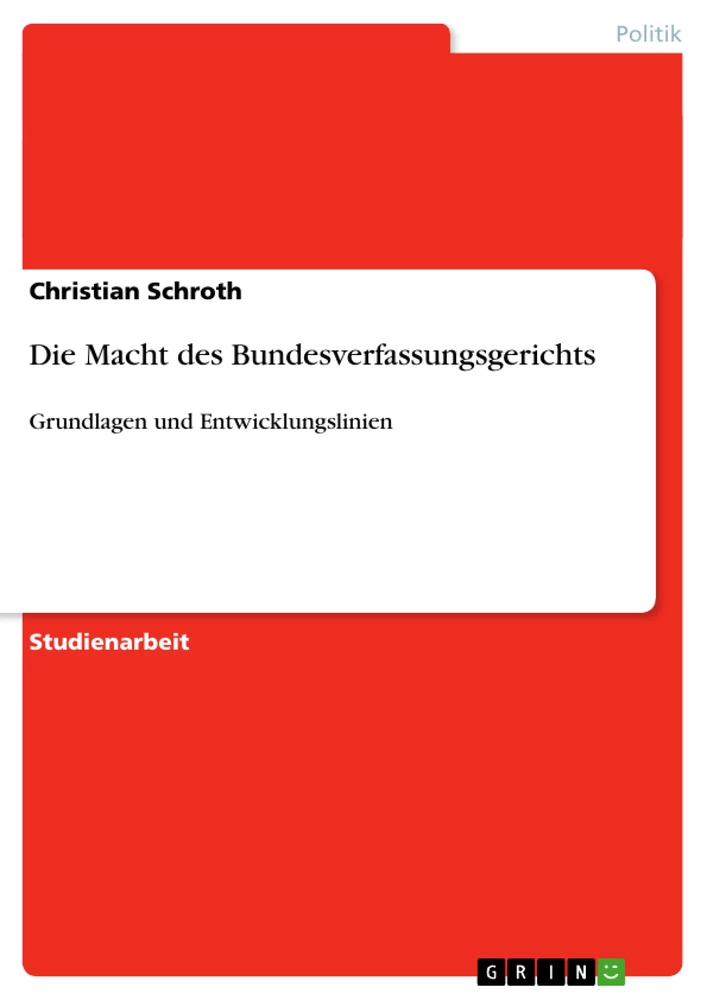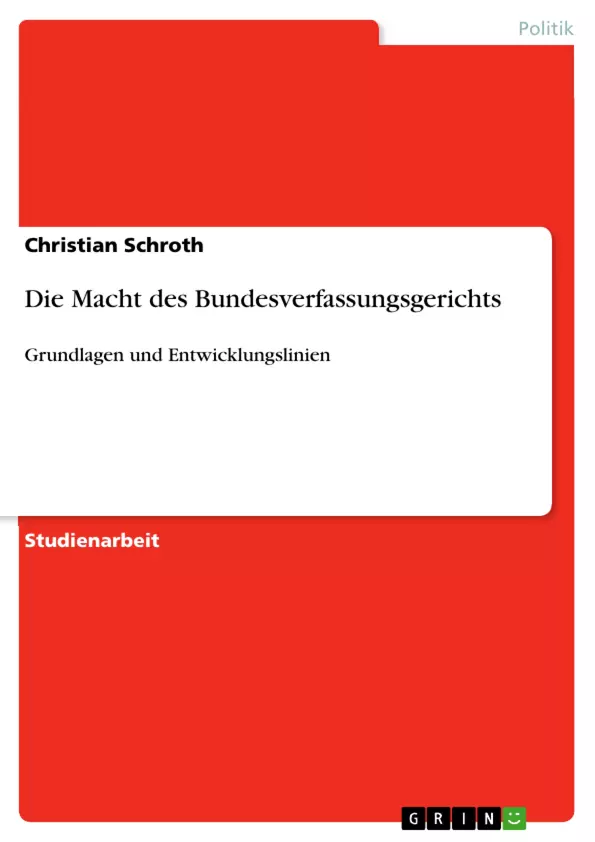Es gibt verschiedene Gründe warum sich über die Frage nach der Macht bzw. nach dem korrekten Maß von Macht des Bundesverfassungsgerichts so vortrefflich streiten lässt. Zunächst einmal liegen der Beurteilung verschiedene rechtsphilosophische Konzepte zu Grunde, die zu unterschiedlichen Schlüssen führen. Während bei den einen das Konzept der Gewaltenteilung Montesquieus dominiert, was den Gerichten jegliche Machtausübung im politischen Sinne abspricht und die Forderung nach richterlicher Bescheidung auf reine Rechtsprechung beinhaltet, betrachten andere die Sache folgendermaßen: das BVerfG sei eben kein reguläres Gericht als funktionaler Teil des Rechtsprechungsapparats, sondern eine besondere Institution einer modernen demokratischen Gesellschaft, die einen Teil der obersten Macht im Staat darstelle. Diese beiden Positionen gegenübergestellt sind die theoretische Grundlage des viel zitierten „Spannungsfelds“ zwischen Recht und Politik, in dem sich das Bundesverfassungsgericht befinde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe und Konzepte
- Macht
- Autorität
- Charisma
- Entwicklungslinien verfassungsgerichtlicher Macht
- Stellung und Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts
- Stellung als Verfassungsorgan
- Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts
- Unabhängigkeit der Verfassungsrichter
- Das Fehlen des Gerichtsvollziehers
- Aktive Ausweitung der eigenen Machtbasis des Bundesverfassungsgerichts
- Ausweitung von Zuständigkeiten
- Sondervoten und Bekanntgabe von Stimmverhältnissen
- Relativierung der Bindungswirkungen von Entscheidungen
- Inszenierung der verfassungsrichterlichen Deutungsmacht
- Vertrauen der Öffentlichkeit durch kluges Agieren
- Stellung und Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Macht des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Macht des Gerichts und analysiert dessen Entwicklung im Laufe der Zeit. Dabei werden verschiedene Konzepte der Macht, wie die von Max Weber und Hannah Arendt, herangezogen.
- Konzepte von Macht und Autorität im Kontext des BVerfG
- Entwicklung der Stellung und Aufgaben des BVerfG
- Strategien des BVerfG zur Ausweitung seiner Machtbasis
- Die Rolle des Charismas im Kontext der Institution
- Das Spannungsfeld zwischen Recht und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Macht des Bundesverfassungsgerichts ein und skizziert die unterschiedlichen rechtsphilosophischen Perspektiven auf dieses Thema. Sie thematisiert das Spannungsfeld zwischen Recht und Politik, in dem sich das BVerfG bewegt, und kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an, die in der Auseinandersetzung mit den Begriffen "Macht", "Autorität" und "Charisma" und der Analyse der Entwicklungslinien verfassungsgerichtlicher Macht besteht. Die zentrale Frage der Arbeit ist, woraus die Macht des BVerfG besteht und welchen Gefährdungen sie ausgesetzt ist.
Begriffe und Konzepte: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe „Macht“, „Autorität“ und „Charisma“ im Kontext des Bundesverfassungsgerichts. Ausgehend von Max Webers Machtdefinition wird die Macht des BVerfG als die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, beleuchtet. Die Arbeit diskutiert, ob die Entscheidungen des BVerfG Ausdruck des Gesetzes oder ein Ausdruck des eigenen Willens der Richter sind, und bezieht dabei die Konzepte der Gewaltenteilung und die Interpretation von Grundrechten mit ein. Der Begriff der Autorität wird in Bezug auf die Akzeptanz durch das Volk und die kommunikative Macht des Gerichts erörtert. Der Begriff "Charisma" wird im Hinblick auf die Institution und ihre Wirkung untersucht.
Entwicklungslinien verfassungsgerichtlicher Macht: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Macht des BVerfG aus institutioneller und aktiver Perspektive. Der institutionelle Aspekt analysiert den Machtbereich des Gerichts aufgrund seiner Stellung und Aufgaben. Der aktive Aspekt konzentriert sich auf die strategischen Handlungen des Gerichts zur Ausweitung seiner Macht. Die Arbeit beleuchtet die Umsetzung der Forderungen aus der Denkschrift von Gerhard Leibholz als wichtigen Gründungspunkt. Die anfängliche schwache Position des Gerichts und die darauf folgende aktive Gestaltung seiner Rolle im politischen System werden detailliert beschrieben. Die selbstbewusste Haltung der Verfassungsrichter über fünfzig Jahre hinweg und deren Beitrag zur zentralen und machtvollen Rolle Karlsruhes im politischen System der Bundesrepublik werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Macht, Autorität, Charisma, Gewaltenteilung, Grundrechte, Rechtsprechung, Politik, Institution, Entwicklungslinien, Legitimität, Spannungsfeld Recht und Politik, Interpretationsmacht, Definitionsmacht.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Macht des Bundesverfassungsgerichts"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Macht des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im deutschen politischen System. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Macht des Gerichts und deren Entwicklung über die Zeit, unter Berücksichtigung verschiedener Machtkonzepte (Weber, Arendt).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Konzepte von Macht und Autorität im Kontext des BVerfG, die Entwicklung der Stellung und Aufgaben des Gerichts, Strategien zur Ausweitung seiner Machtbasis, die Rolle des Charismas und das Spannungsfeld zwischen Recht und Politik.
Welche Begriffe werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Begriffe "Macht", "Autorität" und "Charisma" im Kontext des BVerfG. Max Webers Machtdefinition wird herangezogen und die Frage diskutiert, ob Entscheidungen des BVerfG Ausdruck des Gesetzes oder des Willens der Richter sind. Die Akzeptanz durch das Volk und die kommunikative Macht des Gerichts werden ebenso betrachtet.
Wie wird die Entwicklung der Macht des BVerfG dargestellt?
Die Entwicklung der Macht des BVerfG wird aus institutioneller und aktiver Perspektive betrachtet. Der institutionelle Aspekt analysiert den Machtbereich aufgrund der Stellung und Aufgaben des Gerichts. Der aktive Aspekt konzentriert sich auf strategische Handlungen zur Machtvergrößerung. Die Umsetzung der Forderungen aus der Denkschrift von Gerhard Leibholz und die aktive Gestaltung der Rolle des Gerichts im politischen System werden detailliert beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Begriffen und Konzepten (Macht, Autorität, Charisma), ein Kapitel zu den Entwicklungslinien verfassungsgerichtlicher Macht und ein Fazit. Die Einleitung skizziert die rechtsphilosophischen Perspektiven und die methodische Vorgehensweise. Die Kapitelzusammenfassungen liefern detailliertere Einblicke in die jeweiligen Inhalte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundesverfassungsgericht, Macht, Autorität, Charisma, Gewaltenteilung, Grundrechte, Rechtsprechung, Politik, Institution, Entwicklungslinien, Legitimität, Spannungsfeld Recht und Politik, Interpretationsmacht, Definitionsmacht.
Welche zentrale Frage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Frage ist, woraus die Macht des BVerfG besteht und welchen Gefährdungen sie ausgesetzt ist.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit setzt auf eine Auseinandersetzung mit den Begriffen "Macht", "Autorität" und "Charisma" und der Analyse der Entwicklungslinien verfassungsgerichtlicher Macht.
Welche Perspektiven auf Macht werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht verschiedene rechtsphilosophische Perspektiven auf Macht mit ein und berücksichtigt insbesondere die Konzepte von Max Weber und Hannah Arendt.
- Citation du texte
- Christian Schroth (Auteur), 2009, Die Macht des Bundesverfassungsgerichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141989