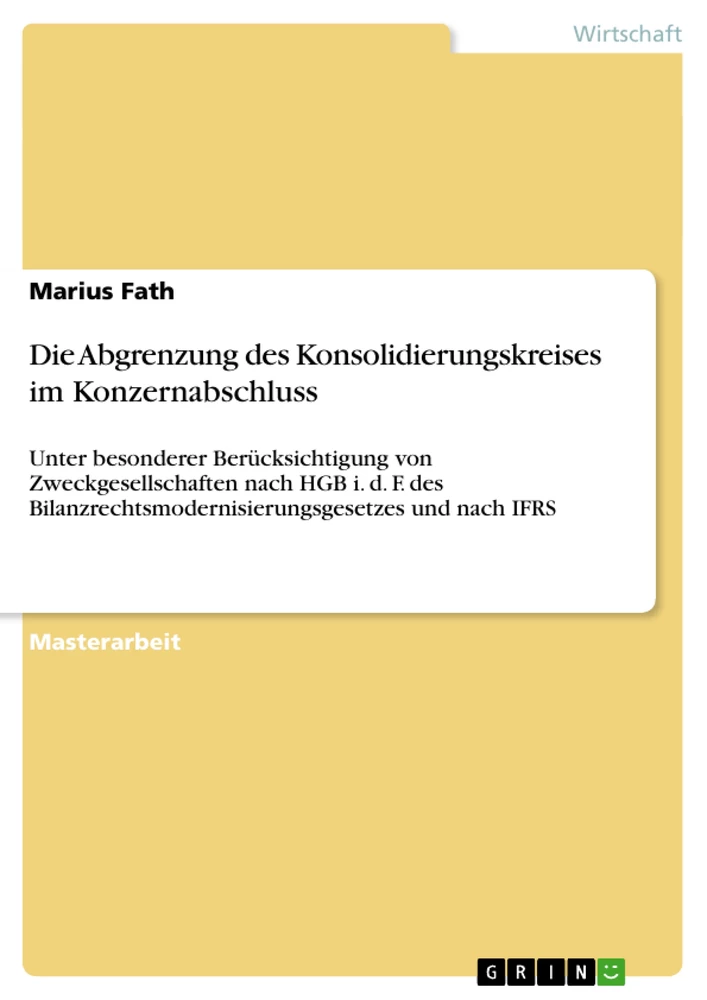Spätestens seit dem Enron-Skandal im Jahr 2001, aber insbesondere durch die anhaltende Subprime-Krise rückte die Bilanzierungspraxis in Bezug auf die Verwendung von Zweckgesellschaften in den Vordergrund. Der texanische
Konzern Enron hatte aus Finanzierungsgründen Vermögensgegenstände und Schulden auf Zweckgesellschaften ausgelagert und somit die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber den Abschlussadressaten verschleiert.
Diese bis dato gängige Praxis der Verschleierung führte dazu, dass
der Konzernabschluss für den Bilanzleser immer undurchsichtiger wurde und die tatsächliche Situation eines Konzerns nicht mehr fassbar war. Dafür gibt es mehrere Gründe. Aufgrund der immer stärker werdenden Anzahl von weltweit agierenden Unternehmen und des erhöhten Kosten- und Konkurrenzdrucks, was mit der Vergrößerung der Absatzmärkte im Zuge der Globalisierung
einhergeht, stehen Unternehmen vor einer großen Herausforderung.
Für die Expansionsbestrebungen werden liquide Mittel benötigt, welche nicht ausschließlich durch die Finanzierung der Banken gewährleistet werden können.
Auch aufgrund der restriktiveren Kreditmittelvergabe der Banken durch Basel II wurde der Einsatz von Zweckgesellschaften forciert. Dabei werden Zweckgesellschaften gezielt so gestaltet, dass die Kriterien für eine Einbeziehung in den Konsolidierungskreis nicht erfüllt sind. Der zentralen Aufgabe des
Konzernabschlusses, nämlich die Informationsfunktion, wird dadurch entgegengewirkt. Zweckgesellschaften haben dabei oftmals Vermögenswerte gehalten, deren Risikostruktur nicht mehr transparent war. Daraus ergeben sich für Zweckgesellschaft Risiken, insbesondere im Hinblick auf den Ausfall von Forderungen aus Hypothekenkrediten. Vor diesem Hintergrund wurden neue Regelungen beschlossen, welche eine Nichteinbeziehung von Zweckgesellschaften erschweren sollen. Die vorliegende Arbeit wird sich daher in den folgenden Abschnitten mit der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und den IFRS genauer beschäftigen und ihre Wirkungskreise beleuchten. Besonderer
Fokus wird dabei speziell auf die Einbeziehung von Zweckgesellschaften gelegt und der Frage nachgegangen, welche Folgen mit diesen Maßnahmen einhergehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB i. d. F. BilMoG
- 2.1 Stufenkonzept
- 2.2 Konsolidierungskreis im engeren Sinn nach HGB i. d. F. BilMoG
- 2.2.1 Konsolidierungsgebot von Tochterunternehmen
- 2.2.2 Konsolidierungswahlrechte
- 2.2.3 Anhangangaben
- 2.3 Konsolidierungskreis im weiteren Sinn nach HGB i. d. F. BilMoG
- 2.3.1 Gemeinschaftsunternehmen
- 2.3.2 Assoziierte Unternehmen
- 2.3.3 Sonstige Beteiligungen oder Anteilsbesitz
- 3 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach IFRS
- 3.1 Überblick und Verknüpfung mit dem HGB
- 3.2 Konsolidierungskreis im engeren Sinn nach IFRS
- 3.2.1 Konsolidierungsgebot von Tochterunternehmen
- 3.2.2 Konsolidierungswahlrechte
- 3.3 Konsolidierungskreis im weiteren Sinn nach IFRS
- 3.3.1 Joint Ventures
- 3.3.2 Assoziierte Unternehmen
- 3.3.3 Finanzinstrumente IAS 39
- 4 Konsolidierung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities)
- 4.1 Spezifika von Zweckgesellschaften
- 4.2 Bedeutsame Erscheinungsformen von Zweckgesellschaften
- 4.3 Konsolidierung von Zweckgesellschaften
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Abgrenzung des Konsolidierungskreises im Konzernabschluss, insbesondere im Hinblick auf Zweckgesellschaften. Sie vergleicht die Regelungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den International Financial Reporting Standards (IFRS).
- Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Regelungen in HGB und IFRS
- Spezifische Herausforderungen bei der Konsolidierung von Zweckgesellschaften
- Analyse der Kriterien zur Bestimmung der Konsolidierungspflicht
- Bewertung von Wahlrechten bei der Konsolidierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Abgrenzung des Konsolidierungskreises und erläutert die Relevanz der Arbeit im Kontext des Konzernabschlusses. Es skizziert die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit, indem es die relevanten Gesetzesgrundlagen und Rechnungslegungsstandards (HGB und IFRS) einführt. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung, um ein aussagekräftiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Konzerns zu erhalten.
2 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB i. d. F. BilMoG: Dieses Kapitel analysiert die Regeln zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach dem Handelsgesetzbuch in der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten Fassung. Es beschreibt das Stufenkonzept des HGB und untersucht detailliert die Konsolidierungspflicht von Tochterunternehmen, die Konsolidierungswahlrechte und die Berichtspflichten im Anhang. Die verschiedenen Konsolidierungsmethoden und ihre Anwendung in unterschiedlichen Konstellationen werden eingehend betrachtet. Der Einfluss des BilMoG auf die bisherige Praxis wird kritisch hinterfragt.
3 Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach IFRS: Dieses Kapitel widmet sich der Betrachtung der internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und ihrer Regelungen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises. Es stellt einen Vergleich zu den HGB-Vorschriften her und beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Fokus liegt auf dem "Control"-Konzept im IFRS und dessen Auswirkungen auf die Konsolidierungspraxis. Die Kapitel analysiert die Konsolidierungswahlrechte und die Berichterstattungspflichten im Rahmen des IFRS. Aktuelle Entwicklungen wie die ED 10 werden kurz angesprochen.
4 Konsolidierung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities): Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der besonderen Herausforderung der Konsolidierung von Zweckgesellschaften (SPE). Es beschreibt die spezifischen Merkmale von SPEs und untersucht verschiedene Erscheinungsformen, wie Asset-Backed Securities-Gesellschaften und Leasingobjektgesellschaften. Die Kapitel analysiert die Kriterien für die Konsolidierung von SPEs sowohl nach HGB als auch nach IFRS. Dabei werden die jeweiligen Indikatoren zur Bestimmung der Beherrschung und die Auslegung dieser Indikatoren im Detail diskutiert. Die Problematik der Anwendung der Rechnungslegungsstandards auf diese speziellen Unternehmensformen wird eingehend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Konsolidierungskreis, Konzernabschluss, Handelsgesetzbuch (HGB), Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), International Financial Reporting Standards (IFRS), Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen, assoziierte Unternehmen, Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities), Konsolidierungswahlrechte, Control-Konzept, Equity-Methode, Anhangangaben.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Abgrenzung des Konsolidierungskreises im Konzernabschluss, insbesondere im Hinblick auf Zweckgesellschaften. Sie vergleicht die Regelungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den International Financial Reporting Standards (IFRS).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Regelungen in beiden Rechnungslegungsstandards, die spezifischen Herausforderungen bei der Konsolidierung von Zweckgesellschaften, die Kriterien zur Bestimmung der Konsolidierungspflicht und die Bewertung von Wahlrechten bei der Konsolidierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung, die Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB i.d.F. BilMoG, die Abgrenzung nach IFRS, die Konsolidierung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities) und ein Fazit mit Ausblick. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Was wird im Kapitel zur Abgrenzung nach HGB i.d.F. BilMoG behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Stufenkonzept des HGB, die Konsolidierungspflicht von Tochterunternehmen, Konsolidierungswahlrechte, Anhangangaben und den Einfluss des BilMoG auf die bisherige Praxis. Verschiedene Konsolidierungsmethoden und deren Anwendung werden eingehend betrachtet.
Was wird im Kapitel zur Abgrenzung nach IFRS behandelt?
Dieses Kapitel vergleicht die IFRS-Regelungen mit den HGB-Vorschriften, beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede, fokussiert auf das "Control"-Konzept und dessen Auswirkungen, analysiert Konsolidierungswahlrechte und Berichterstattungspflichten im Rahmen des IFRS und erwähnt aktuelle Entwicklungen.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels über Zweckgesellschaften?
Dieses Kapitel befasst sich mit den spezifischen Merkmalen von Zweckgesellschaften (SPE), verschiedenen Erscheinungsformen (z.B. Asset-Backed Securities-Gesellschaften), den Kriterien für deren Konsolidierung nach HGB und IFRS, der Diskussion der Indikatoren zur Bestimmung der Beherrschung und der Problematik der Anwendung der Rechnungslegungsstandards auf SPEs.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Konsolidierungskreis, Konzernabschluss, Handelsgesetzbuch (HGB), Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), International Financial Reporting Standards (IFRS), Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen, assoziierte Unternehmen, Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities), Konsolidierungswahlrechte, Control-Konzept, Equity-Methode, Anhangangaben.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der klaren und präzisen Abgrenzung des Konsolidierungskreises, um ein aussagekräftiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Konzerns zu erhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der Komplexität von Zweckgesellschaften.
- Quote paper
- Marius Fath (Author), 2009, Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises im Konzernabschluss , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142012