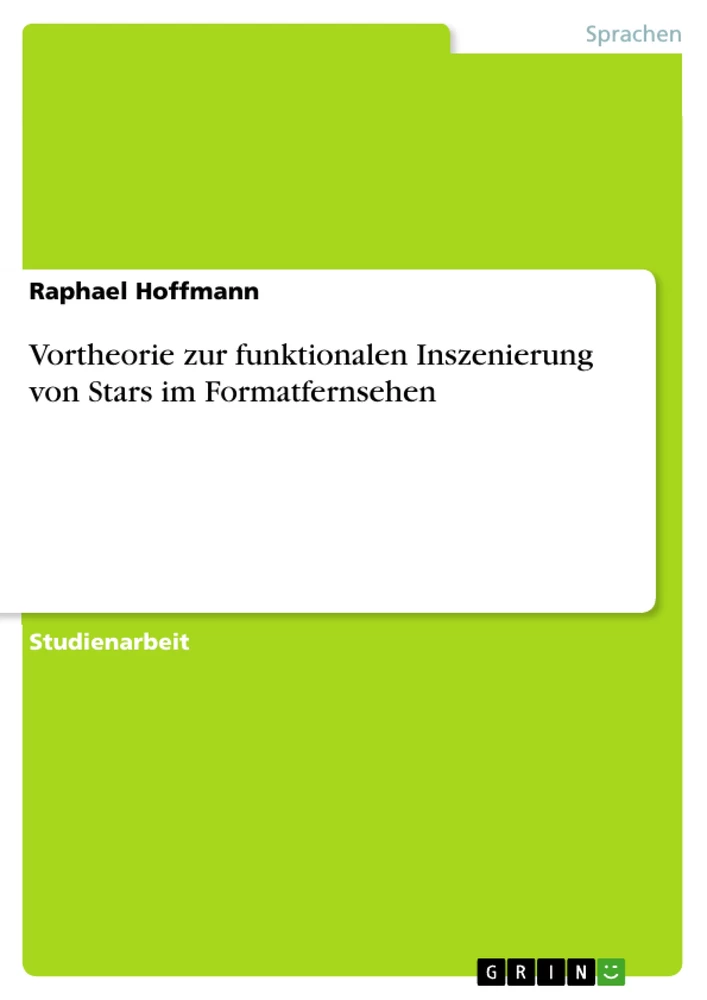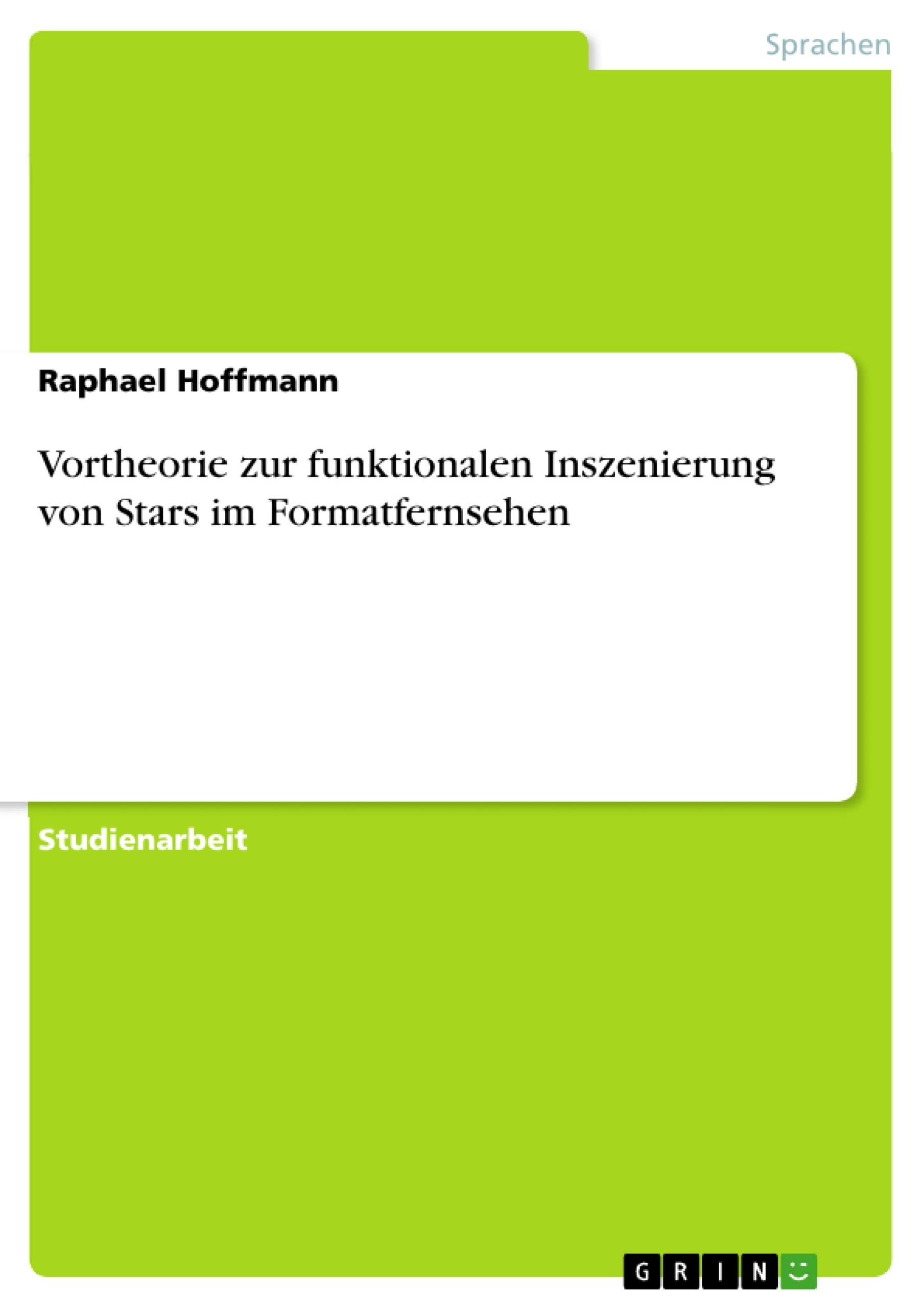Werke von Autoren, welche die rhetorische Oratorperspektive als Herangehensweise an diese Thematik wählten, findet man kaum. Wenn der Star gegenüber dem Publikum fungiert, verbietet es sich aber, allein den Blickwinkel des Stars einzunehmen. Umgekehrt reicht es nicht, den Star mit den Augen des Publikums zu betrachten.
Die (psychologischen) Kategorien ,,Aufmerksamkeit’’ und ,,Identität’’ zeugen von meiner Grundannahme, dass das Phänomen ,,Star’’ kein Mysterium ist (wenngleich es Publikum und Star als ein solches erscheinen mag). Der Star ist demnach kein außergewöhnlicher Mensch, er ist vielmehr eine von den Medien inszenierte Person, die dem Publikum im Image erfahrbar wird (Kapitel III a). Eine definitorische Charakterisierung des Stars erübrigt sich von selbst, indem den thematisch medialen Abschnitten empirisch begründete Überlegungen zur Aufmerksamkeitsökonomie vorausgeschickt werden: Nicht das Startum als solches ist letztlich interessant, sondern die Funktion des Stars.
Es zeigt sich nebenbei, dass mit den Kategorien ,,Aufmerksamkeit’’ und ,,Identität’’ nicht nur – das ist Ziel der Arbeit – eine theoretische Grundlage für die rhetorisch-mediale Inszenierung von Stars im Formatfernsehen gebildet werden kann (Kapitel IV b), sondern auch subjektive Erlebnisberichte von Star und Publikum erklärt werden können (Kapitel III b). Es handelt sich um vortheoretische Überlegungen, da der Prozess der Prominenzierung (bzw. Inszenierung) als solcher unbehandelt bleibt. Auch habe ich es unterlassen, näher auf soziologisch-mediale Theorien einzugehen (etwa auf das Thema ,,Agenda-Setting’’), um den Fokus voll und ganz auf die Hauptthematik richten zu können: Die Funktion des thematischen Star-Bezugs im Formatfernsehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Identität und Aufmerksamkeit als rhetorische Operatoren
- a. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsbindung
- b. Rhetorik: Zusammenspiel von sozial-tatsächlichem Identitätsbild und Meinungen
- III. Image und Star als funktionale Größen in den Massenmedien
- a. Image als Aufmerksamkeits-Austauschvakuum
- b. Der Star als Sprunghilfe zwischen Format und Alltagswelt
- IV. Der identische Vergleich als Problem: Formatidee und Alltagswelt
- a. Zum Grund-Telos des Formatfernsehen
- b. Provokation und Issuebildung: Der Star als inszenierte Formatkonstante
- V. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, eine theoretische Grundlage für die rhetorisch-mediale Inszenierung von Stars im Formatfernsehen zu schaffen. Sie untersucht, wie die Kategorien "Aufmerksamkeit" und "Identität" die Inszenierung und Wahrnehmung von Stars beeinflussen.
- Die Funktion von "Aufmerksamkeit" und "Identität" als rhetorische Operatoren im Kontext von Stars im Formatfernsehen.
- Die Rolle des "Image" als Aufmerksamkeits-Austauschvakuum.
- Die Verbindung zwischen Stars und der Alltagswelt.
- Der "identische Vergleich" als ein Mittel der Inszenierung.
- Die Relevanz von Stars für das Formatfernsehen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Frage nach der Definition des Begriffs "Star" und untersucht die Schwierigkeiten, das Phänomen "Star" wissenschaftlich zu erfassen. Sie betont die Relevanz der rhetorischen Oratorperspektive für die Analyse des Verhältnisses zwischen Star und Publikum.
II. Identität und Aufmerksamkeit als rhetorische Operatoren
a. Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsbindung
Dieser Abschnitt beleuchtet den Widerspruch zwischen dem knappen Gut "Aufmerksamkeit" und der scheinbar unbegrenzten Zahl von Objekten, denen wir Aufmerksamkeit schenken. Er verwendet Siegfried J. Schmidts Überlegungen zur Aufmerksamkeitsbindung, um die Beziehung zwischen sozialer Aufmerksamkeit und individueller Aufmerksamkeitsbindung zu erklären.
b. Rhetorik: Zusammenspiel von sozial-tatsächlichem Identitätsbild und Meinungen
Dieser Abschnitt führt das Konzept des "sozial-tatsächlichen Identitätsbildes" ein, das die Beziehung zwischen Identifikation und Meinungen im Kontext von Stars erklärt. Dabei dient die "Kuchen-Metapher" als Illustration für die relative Größe von Identitätsstücken im Verhältnis zueinander.
III. Image und Star als funktionale Größen in den Massenmedien
a. Image als Aufmerksamkeits-Austauschvakuum
Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung des "Image" als ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu binden und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf andere Objekte zu lenken.
b. Der Star als Sprunghilfe zwischen Format und Alltagswelt
Dieser Abschnitt analysiert die Rolle von Stars als Vermittler zwischen dem Formatfernsehen und der Alltagswelt. Er untersucht, wie Stars dazu beitragen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen und zu halten.
IV. Der identische Vergleich als Problem: Formatidee und Alltagswelt
a. Zum Grund-Telos des Formatfernsehen
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem "Grund-Telos" des Formatfernsehen und den Funktionen von Stars im Kontext des Formats.
b. Provokation und Issuebildung: Der Star als inszenierte Formatkonstante
Dieser Abschnitt erörtert die Rolle von Stars als "inszenierte Formatkonstanten" und untersucht, wie sie zur Provokation und Issuebildung beitragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen "Aufmerksamkeit", "Identität", "Rhetorik", "Stars", "Image", "Formatfernsehen", "Provokation", "Issuebildung" und "Identischer Vergleich". Sie untersucht die Funktion von Stars im Kontext von Aufmerksamkeit und Identität und analysiert die rhetorischen Strategien, die zur Inszenierung von Stars im Formatfernsehen eingesetzt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernhypothese der Arbeit über Stars im Formatfernsehen?
Die Arbeit geht davon aus, dass Stars keine „Mysterien“ sind, sondern medial inszenierte Personen, deren Funktion über die Kategorien „Aufmerksamkeit“ und „Identität“ erklärt werden kann.
Was bedeutet „Image als Aufmerksamkeits-Austauschvakuum“?
Das Image dient als Werkzeug, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu binden und gleichzeitig als Projektionsfläche für den Austausch von Werten und Meinungen zwischen Star und Zuschauer zu fungieren.
Welche Rolle spielen Stars für das Formatfernsehen?
Stars dienen als „Sprunghilfe“ zwischen der künstlichen Welt des TV-Formats und der Alltagswelt des Publikums. Sie schaffen Identifikationspunkte und sichern die Aufmerksamkeitsbindung.
Was illustriert die „Kuchen-Metapher“ in diesem Kontext?
Sie veranschaulicht das Zusammenspiel von sozial-tatsächlichem Identitätsbild und Meinungen, indem sie zeigt, wie verschiedene Identitätsanteile im Verhältnis zueinander gewichtet werden.
Wie tragen Stars zur Issuebildung und Provokation bei?
Als inszenierte Formatkonstanten werden Stars gezielt eingesetzt, um durch Provokation Themen (Issues) zu setzen, die die öffentliche Aufmerksamkeit steigern und Diskussionen anregen.
- Citar trabajo
- Raphael Hoffmann (Autor), 2008, Vortheorie zur funktionalen Inszenierung von Stars im Formatfernsehen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142255