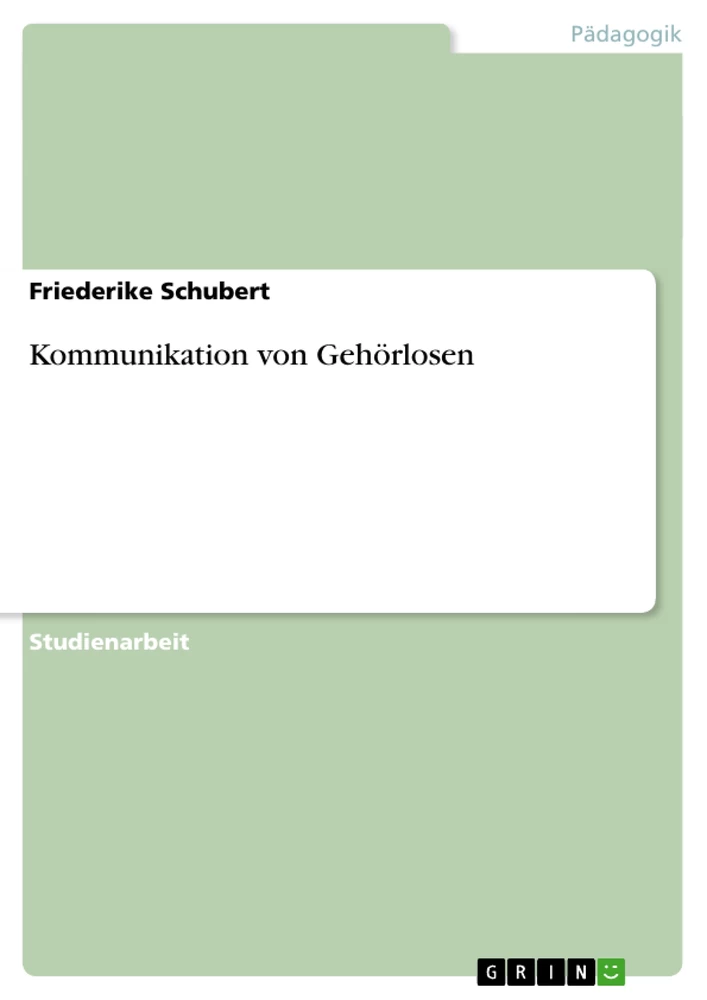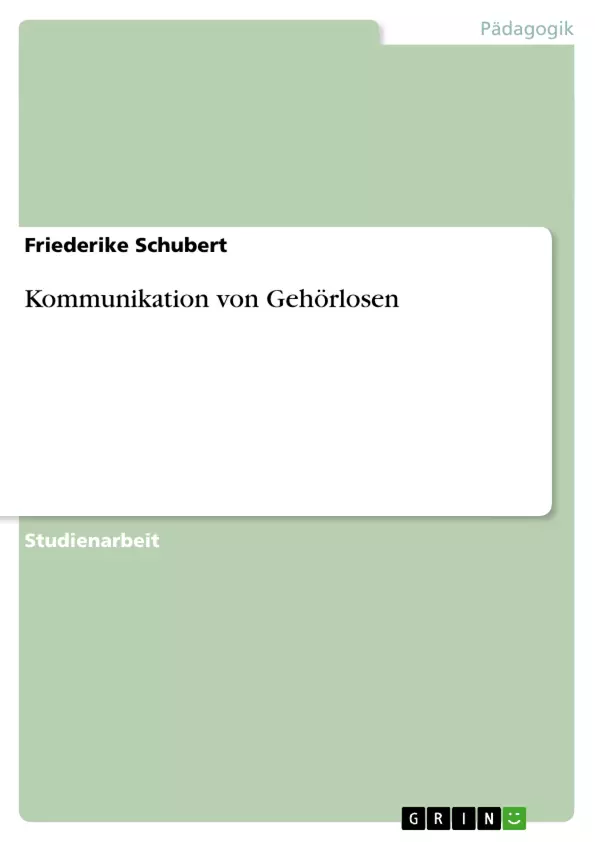Wenn wir uns im Zug von jemanden verabschieden wollen und durch ein geschlossenes
Fenster kommunizieren möchten, merken wir bald, wie beschränkt unsere Möglichkeiten
sind, uns dem anderen mitzuteilen. Da wird gewunken, lautlos gerufen, mit dem Kopf
genickt, oder eine Kusshand gemacht, aber trotz gutem Sichtkontakt kommt nur eine
behelfsmäßige Verständigung zustande.Wenn uns die gesprochene Sprache nicht zur
Verfügung steht, fällt unser Austausch an Informationen sehr rudimentär aus.
Wie sieht das aber bei Menschen aus, die von Geburt an oder durch eine Krankheit gehörlos
sind? Welche Ursachen gibt es dafür und welche Auswirkungen hat das auf die
Verständigung?
In meiner Hausarbeit möchte ich zunächst allgemein über Gehörlosigkeit schreiben und dann
zur Gebärdensprache übergehen- auf ihre Merkmale, Grenzen und eventuelle
Anerkennungsschwierigkeiten. „Bezeichnung für die vollständige Unfähigkeit, Höreindrücke zu empfangen oder zu
registrieren. Die Gehörlosigkeit ist entweder angeboren oder geht auf Ertaubung zurück. Sie
wird verursacht durch organische Schäden des Ohres oder durch Schäden derjenigen
Gehirnbereiche, die die Sinnesempfindungen des Ohres auswerten.“ ¹
Als gehörlos gelten also Menschen, die infolge einer schweren Schädigung des Gehörs auch
bei Einsatz technischer Hörhilfen keine oder nur sehr begrenzte Höreindrücke haben
In Deutschland leben etwa 60.000 Gehörlose. Das sind ca. 0,1% der Bevölkerung. Jedes Jahr
werden in Deutschland ca. 600 Kinder taub geboren. (vgl. medicine worldwide, 2002)
1 Vgl. Fachgebärdenlexikon Psychologie, Stichwort: Gehörlosigkeit
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Gehörlosigkeit"
- Definition
- mögliche Ursachen
- Auswirkungen der Gehörlosigkeit
- Die Kommunikation von Gehörlosen
- Einteilung unterschiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten
- Die Deutsche Gebärdensprache
- Pro und Kontra der Gebärdensprache
- Gebärden in der Geschichte der Gehörlosenpädagogik
- Vorteile der Deutschen Gebärdensprache
- Ihre Grenzen
- Bilinguale Gehörlosenpädagogik
- Zusammenfassung/ Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Kommunikation von Gehörlosen, insbesondere mit der Verwendung der Gebärdensprache. Die Arbeit untersucht die Definition und die möglichen Ursachen der Gehörlosigkeit, die Auswirkungen auf die Kommunikation und die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, die Gehörlosen zur Verfügung stehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Vorteile und Grenzen der Deutschen Gebärdensprache im Kontext der Gehörlosenpädagogik und der Diskussion über die bilinguale Gehörlosenpädagogik.
- Definition und Ursachen der Gehörlosigkeit
- Auswirkungen der Gehörlosigkeit auf die Kommunikation
- Die Deutsche Gebärdensprache als Kommunikationsmittel für Gehörlose
- Vorteile und Grenzen der Gebärdensprache in der Gehörlosenpädagogik
- Bilinguale Gehörlosenpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Kommunikation bei fehlender Sprache anhand des Beispiels eines Zugabteils mit geschlossenem Fenster dar. Die Arbeit fokussiert auf die Kommunikation von Menschen, die von Geburt an oder durch Krankheit gehörlos sind. Ziel ist es, die Ursachen, Auswirkungen und Kommunikationsmöglichkeiten von Gehörlosen sowie die Bedeutung der Gebärdensprache zu beleuchten.
,,Gehörlosigkeit"
2.1 Definition
Der Abschnitt definiert Gehörlosigkeit als die vollständige Unfähigkeit, Höreindrücke zu empfangen oder zu registrieren, die durch organische Schäden des Ohres oder Schäden in den entsprechenden Gehirnarealen verursacht wird. Es werden die Merkmale von Gehörlosigkeit erläutert und die Anzahl der Gehörlosen in Deutschland angegeben.
2.2 Mögliche Ursachen
Die Ursachen für Hörschäden und Gehörlosigkeit werden nach dem Zeitpunkt des Auftretens in pränatale, perinatale und postnatale Ursachen unterteilt. Die Tabelle zeigt verschiedene Ursachen, die zu Gehörlosigkeit führen können.
2.3 Auswirkungen der Gehörlosigkeit
Dieser Abschnitt beleuchtet die weitreichende Auswirkung der Gehörlosigkeit auf die Kommunikation, da Sprachlaute akustisch nicht wahrgenommen werden können. Es wird der fehlende kommunikative Austausch zwischen Eltern und gehörlosen Kindern betont, der für die Gesamtentwicklung des Kindes von großer Bedeutung ist.
Die Kommunikation von Gehörlosen
3.1 Einteilung unterschiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten
Dieser Abschnitt geht auf die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten ein, die Gehörlosen zur Verfügung stehen.
3.2 Die Deutsche Gebärdensprache
Der Abschnitt beschreibt die Deutsche Gebärdensprache (DGS) als eine eigenständige Sprache mit eigener Grammatik und Syntax.
Pro und Kontra der Gebärdensprache
4.1 Gebärden in der Geschichte der Gehörlosenpädagogik
Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Verwendung von Gebärden in der Gehörlosenpädagogik.
4.2 Vorteile der Deutschen Gebärdensprache
Hier werden die Vorteile der DGS für die Kommunikation und den Spracherwerb von Gehörlosen aufgezeigt.
4.3 Ihre Grenzen
Dieser Abschnitt behandelt die Grenzen der DGS im Hinblick auf die Kommunikation mit hörenden Menschen.
4.4 Bilinguale Gehörlosenpädagogik
Der Abschnitt diskutiert die bilinguale Gehörlosenpädagogik, bei der sowohl die DGS als auch die Lautsprache vermittelt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Kommunikation von Gehörlosen, insbesondere mit der Verwendung der Deutschen Gebärdensprache. Zentrale Themen sind die Definition und Ursachen der Gehörlosigkeit, die Auswirkungen auf die Kommunikation, die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten von Gehörlosen sowie die Vorteile und Grenzen der DGS im Kontext der Gehörlosenpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Gehörlosigkeit definiert?
Gehörlosigkeit bezeichnet die vollständige Unfähigkeit, Höreindrücke zu empfangen, verursacht durch organische Schäden am Ohr oder in den Gehirnbereichen, die Sinnesempfindungen auswerten.
Was sind typische Ursachen für Gehörlosigkeit?
Ursachen werden in pränatale (vor der Geburt), perinatale (während der Geburt) und postnatale (nach der Geburt durch Krankheit oder Unfall) Gründe unterteilt.
Was ist die Deutsche Gebärdensprache (DGS)?
Die DGS ist eine eigenständige, vollwertige Sprache mit einer eigenen Grammatik und Syntax, die nicht einfach eine Abbildung der Lautsprache ist.
Was versteht man unter bilingualer Gehörlosenpädagogik?
Hierbei werden sowohl die Gebärdensprache als auch die Schriftsprache bzw. Lautsprache vermittelt, um den Kindern den Zugang zu beiden Welten (Gehörlose und Hörende) zu ermöglichen.
Wie viele Gehörlose leben in Deutschland?
In Deutschland leben etwa 80.000 Gehörlose, was ungefähr 0,1 % der Bevölkerung entspricht.
- Citation du texte
- Friederike Schubert (Auteur), 2002, Kommunikation von Gehörlosen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14232