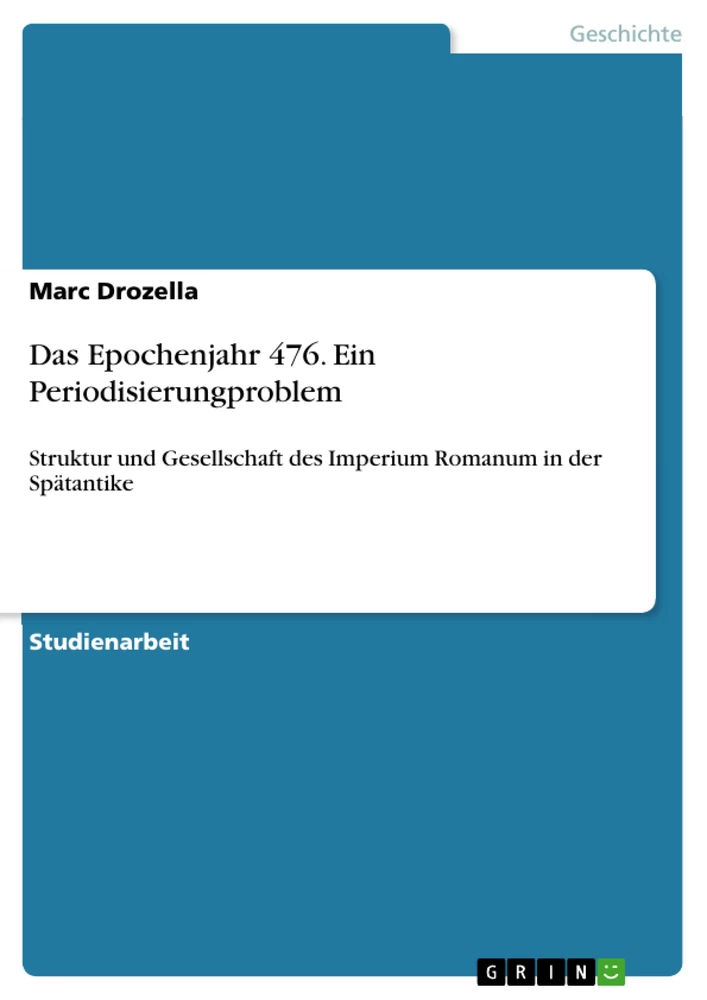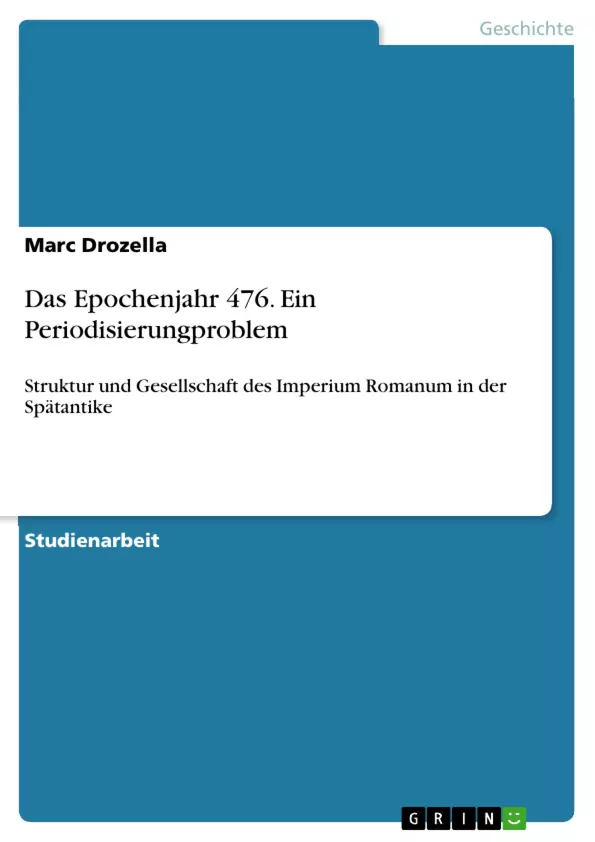Seit es die wissenschaftliche Disziplin der Geschichtsforschung gibt, stehen auch Historiker vor dem Problem, das Vergangene anhand von Ereignissen, Entwicklungen, Personen und vielen anderen Kriterien einteilen zu wollen. Eine Einteilung der Geschichte in Epochen macht in vielerlei Hinsicht Sinn. Indem Ereignisse, Entwicklungen und Personen in unterschiedliche geschichtliche Epochen eingeteilt werden, kann man sie besser einander zuordnen, zueinander in Verhältnisse setzen oder aber sie voneinander trennen. Ein Überblick, vor allem aber eine Verständigung über die Weltgeschichte, wird durch die Einteilung der Ereignisse in Epochen erleichtert. Doch die Einteilung der Geschichte in weltgeschichtliche Epochen ist immer eine willkürliche Einteilung. Kein Geschichtsschreiber hat den späteren Geschichtsforschern die Epochenbildung abgenommen. Eine Einteilung der Geschichte in Epochen geschieht immer nachträglich und ist maßgeblich abhängig davon, welche Kriterien man anlegt.
Die Weltgeschichte wird bisher in drei große Epochen eingeteilt: Die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. Über diese drei Epochen an sich sind sich alle heutigen Historiker einig. Wo jedoch welche Epoche endet und welche Epoche beginnt, ist Gegenstand zum Teil heftiger Diskussionen. In dieser Arbeit ist lediglich die Grenze zwischen der Antike und dem Mittelalter von Interesse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Zusammenhang
- 2.1 Die Lage
- 2.2 Beginnender Zusammenbruch - die Reiche im Reich
- 2.3 Intrigen beenden eine Dynastie
- 2.4 Der letzte Kaiser im Westen
- 3. Die Quellen und ihre Autoren
- 3.1 Jordanes' Gotengeschichte
- 3.2 Marcellinus Comes' Chroniken
- 4. Das Problem der Periodisierung
- 4.1 Alfred Baron von Gutschmid, 1886
- 4.2 Otto Seeck, 1920
- 4.3 Alexander Graf Schenk von Stauffenberg, 1948
- 4.4 Hermann Aubin, 1951
- 4.5 Paul Egon Hübinger, 1952
- 4.6 Friedrich Vittinghoff, 1958
- 4.7 Ernst Kornemann, 1977
- 4.8 Laszlo Varady, 1978
- 4.9 Chester G. Starr, 1983
- 4.10 Alexander Demandt, 1984
- 4.11 Averil Cameron, 1993
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um das Jahr 476 n. Chr. als Epochenjahr zwischen Antike und Mittelalter. Ziel ist es, verschiedene historische Perspektiven und Argumentationen zur Periodisierung zu beleuchten und zu analysieren.
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Jahres 476 n. Chr. als Wendepunkt in der Geschichte.
- Die Rolle der Quellen und ihrer Autoren bei der Konstruktion historischer Narrative.
- Die Entwicklung der Geschichtswissenschaftlichen Meinungen zur Epochenabgrenzung.
- Die Bedeutung des Zusammenbruchs des Weströmischen Reiches für die Periodisierung.
- Der Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Veränderungen auf die historische Deutung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt die Grundlage der Arbeit dar, indem sie die Notwendigkeit der Epochenbildung in der Geschichtswissenschaft erklärt und die Problematik der willkürlichen Festlegung von Epochen trennenden Jahren erläutert. Sie fokussiert sich auf die Debatte um die Grenze zwischen Antike und Mittelalter, wobei das Jahr 476 n. Chr. als traditioneller, aber umstrittener Scheidepunkt im Mittelpunkt steht. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die Herangehensweise an das Thema.
2. Historischer Zusammenhang: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die politische und militärische Lage im spätantiken Rom, insbesondere im Westen. Es beschreibt den zunehmenden Druck durch germanische und hunnische Stämme, die Angriffe auf die römischen Grenzen und den schrittweisen Zerfall der römischen Macht im Westen. Der Fokus liegt auf der zunehmenden "Barbarisierung" des römischen Heeres und dem Verlust der Kontrolle über die Peripherie des Reiches. Ereignisse wie der Einfall der Westgoten unter Alarich in Rom 410 werden als Beispiele für die wachsende Instabilität des Weströmischen Reiches angeführt.
3. Die Quellen und ihre Autoren: Hier wird die Quellenlage für die Ereignisse des Jahres 476 n. Chr. und die damit verbundene Periodisierungsdebatte untersucht. Der Text hebt hervor, dass die verfügbaren Quellen begrenzt sind und sich hauptsächlich auf die Werke von Jordanes und Marcellinus Comes stützen. Die Arbeit deutet an, dass diese Autoren keine direkten Zeitzeugen waren und möglicherweise ähnliche Quellen verwendeten, was die Interpretation der Ereignisse beeinflusst.
4. Das Problem der Periodisierung: Das Kernstück der Arbeit analysiert die unterschiedlichen Meinungen von Historikern verschiedener Epochen über die Festlegung der Grenze zwischen Antike und Mittelalter. Es wird eine Auswahl an Autoren von Gutschmid im 19. Jahrhundert bis zu zeitgenössischen Historikern vorgestellt, deren unterschiedliche Argumentationen und Ansätze im Detail diskutiert werden. Diese Darstellung zeigt die Entwicklung des historischen Verständnisses und der Methoden der Periodisierung.
Schlüsselwörter
Spätantike, Weströmisches Reich, 476 n. Chr., Periodisierung, Epochenjahr, Antike, Mittelalter, Geschichtswissenschaft, Quellenkritik, Jordanes, Marcellinus Comes, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Debatte um das Jahr 476 n. Chr. als Epochenjahr zwischen Antike und Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die historische Debatte um das Jahr 476 n. Chr. als vermeintliche Zäsur zwischen Antike und Mittelalter. Sie untersucht die unterschiedlichen Perspektiven und Argumentationen von Historikern verschiedener Epochen bezüglich der Periodisierung dieser geschichtlichen Epoche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter die unterschiedlichen Interpretationen des Jahres 476 n. Chr., die Rolle der Quellen und ihrer Autoren (Jordanes, Marcellinus Comes), die Entwicklung der geschichtswissenschaftlichen Meinungen zur Epochenabgrenzung, den Einfluss des Zusammenbruchs des Weströmischen Reiches und den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Veränderungen auf die historische Deutung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Werke von Jordanes und Marcellinus Comes, wobei die begrenzte und indirekte Natur dieser Quellen hervorgehoben wird. Die Interpretation der Ereignisse wird durch die kritische Auseinandersetzung mit diesen Quellen beeinflusst.
Welche Historiker werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert eine Auswahl an Historikern, deren Meinungen zur Periodisierung zwischen Antike und Mittelalter im Detail analysiert werden. Dies reicht von Alfred von Gutschmid (1886) bis zu zeitgenössischen Historikern wie Averil Cameron (1993). Ihre unterschiedlichen Argumentationen und Ansätze werden verglichen und kontrastiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Zusammenhang (mit Fokus auf den Untergang des Weströmischen Reiches), ein Kapitel zur Quellenkritik (Jordanes und Marcellinus Comes), ein Kernkapitel zur Periodisierungsdebatte und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Navigation.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Debatte um das Jahr 476 n. Chr. als Epochenjahr zu beleuchten und verschiedene historische Perspektiven und Argumentationen zu analysieren. Es geht darum, die Komplexität der Periodisierung und den Einfluss der Quellenlage auf die historische Interpretation aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spätantike, Weströmisches Reich, 476 n. Chr., Periodisierung, Epochenjahr, Antike, Mittelalter, Geschichtswissenschaft, Quellenkritik, Jordanes, Marcellinus Comes, Historiographie.
- Arbeit zitieren
- Marc Drozella (Autor:in), 2008, Das Epochenjahr 476. Ein Periodisierungproblem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142340