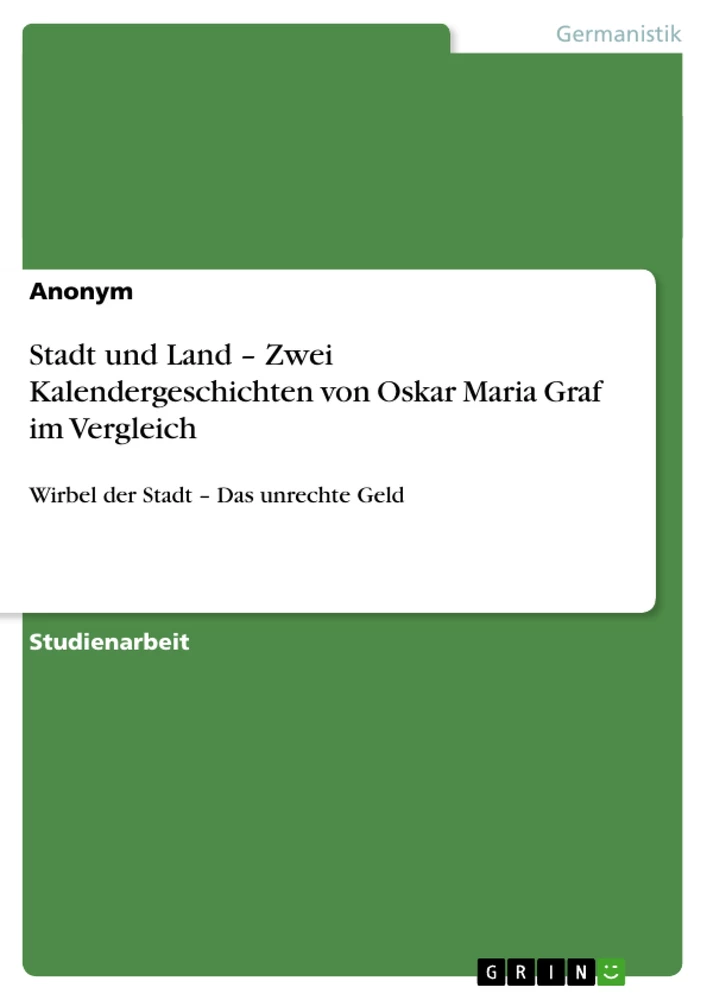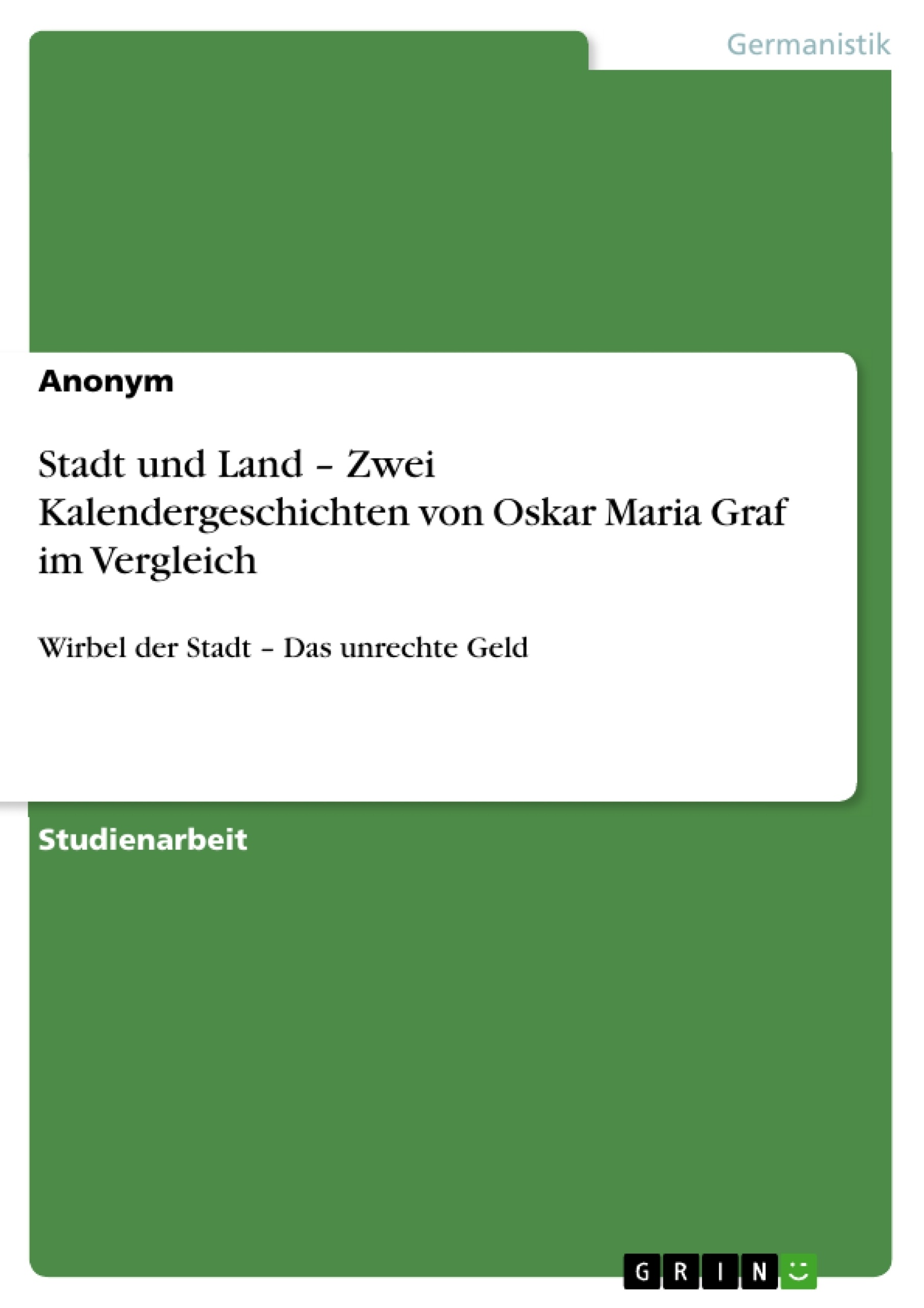Oskar Maria Graf zählt wie Bertolt Brecht zu den Wegbereitern, die bewusst die Kalendergeschichte vom traditionellen Medium des Kalenders befreit haben. Im Vordergrund seiner Kalendergeschichten stand die Thematik seiner Stücke, weniger die äußerlicher Form und die Zwänge des Mediums. Die Möglichkeit, dass Graf Autoren nachfolgender Generationen, z.B. die der Kurzgeschichte, mit seiner Art der Umsetzung von Inhalt und Stoff maßgeblich beeinflusst hat, darf nicht ausgeschlossen werden. Oskar Maria Graf hat es geschafft in dieser Gattung Akzente zu setzen, die weit über die traditionellen Vorstellungen hinausgehen. Nicht ohne Grund urteilte Lion Feuchtwanger über Grafs Kalendergeschichten: „Mehrere unter ihnen gehören zu dem Besten, was die Gattung überhaupt hervorgebracht hat“.
Inhaltsverzeichnis
- Graf der „,Eigenbrötler”
- Vergleich zweier Kalendergeschichten
- Inhaltliche und thematische Aspekte
- Äußere Form
- Erzählsituation, Erzählperspektive und Mittelbarkeit
- Erzählzeit, erzählte Zeit bzw. Zeitraffung und Zeitdehnung
- Reihenfolge bzw. Vorausdeutung und Rückwendung
- Sprache
- Einordnung in die Gattung der Kalendergeschichte
- Graf als Vorreiter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dient als Einführung in Oskar Maria Grafs Kalendergeschichten. Durch den Vergleich zweier Geschichten werden Grafs Form, Thematik, Stil und Erzählweise näher beleuchtet.
- Die Kontrastierung von Land und Stadt
- Moralische Aspekte im Kontext von Geld, Gewinn und Reichtum
- Die Entwicklung des Begriffs der Kalendergeschichte im 20. Jahrhundert
- Der Einfluss von Zeit und Geschwindigkeit auf die Wahrnehmung der Welt
- Die Darstellung von Figuren und Ereignissen in kurzen, episodenhaften Sequenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Geschichte Das unrechte Geld erzählt von einem alten Paar, den Perivlats, die jährlich mit ihrer Drehorgel und Moritatplakaten ein Dorf besuchen. Der Häusler Ramminger gewinnt durch einen Lotteriegewinn einen beträchtlichen Geldbetrag, der Neid und Aufruhr in der Dorfgemeinschaft verursacht. Die Perivlats, die vor Ort Zeuge dieser Entwicklung werden, lehnen ein Angebot von Ramminger ab, an seinem Gewinn beteiligt zu werden, da sie das Geld als „unrecht" empfinden. Die Geschichte verdeutlicht die Moralvorstellungen einer abgeschiedenen Dorfgemeinschaft und stellt das Thema des Geldes und dessen Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen in den Vordergrund.
Die Geschichte Wirbel der Stadt erzählt vom Besuch eines ländlichen Ehepaares in der Stadt. Durch kurze, schnelle Szenen wird das hektische Treiben und die Vielfältigkeit der Stadtbewohner dargestellt. Moralische Konflikte und Themen wie Anonymität, Schnelllebigkeit und der Verfall der Sitten werden in den Mittelpunkt gestellt. Der Kontrast zwischen dem gemächlichen Dorfleben und dem hektischen Stadtleben wird deutlich, und die Geschichte verdeutlicht die unterschiedlichen Tempi und Rhythmen des Lebens in beiden Lebensräumen.
Schlüsselwörter
Kalendergeschichte, Oskar Maria Graf, Land und Stadt, Moral, Geld, Gewinn, Neid, Hektik, Anonymität, Zeit, Erzähltechnik, Vergleich, Kontrast.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Kalendergeschichten von Oskar Maria Graf aus?
Graf befreite die Gattung von traditionellen Zwängen und nutzte sie als modernes Medium für soziale und moralische Themen.
Worum geht es in der Geschichte „Das unrechte Geld“?
Sie thematisiert Neid und moralische Konflikte in einer Dorfgemeinschaft, die durch einen plötzlichen Lotteriegewinn ausgelöst werden.
Wie wird der Kontrast zwischen Stadt und Land dargestellt?
In „Wirbel der Stadt“ wird die Hektik und Anonymität der Stadt dem gemächlichen, aber oft moralisch engen Dorfleben gegenübergestellt.
Welchen Einfluss hatte Graf auf die Kurzgeschichte?
Durch seine innovative Umsetzung von Stoffen gilt Graf als wichtiger Wegbereiter für spätere Generationen von Kurzgeschichtenautoren.
Was sagte Lion Feuchtwanger über Grafs Werk?
Feuchtwanger urteilte, dass Grafs Kalendergeschichten zu dem Besten gehören, was diese literarische Gattung hervorgebracht hat.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2005, Stadt und Land – Zwei Kalendergeschichten von Oskar Maria Graf im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142352