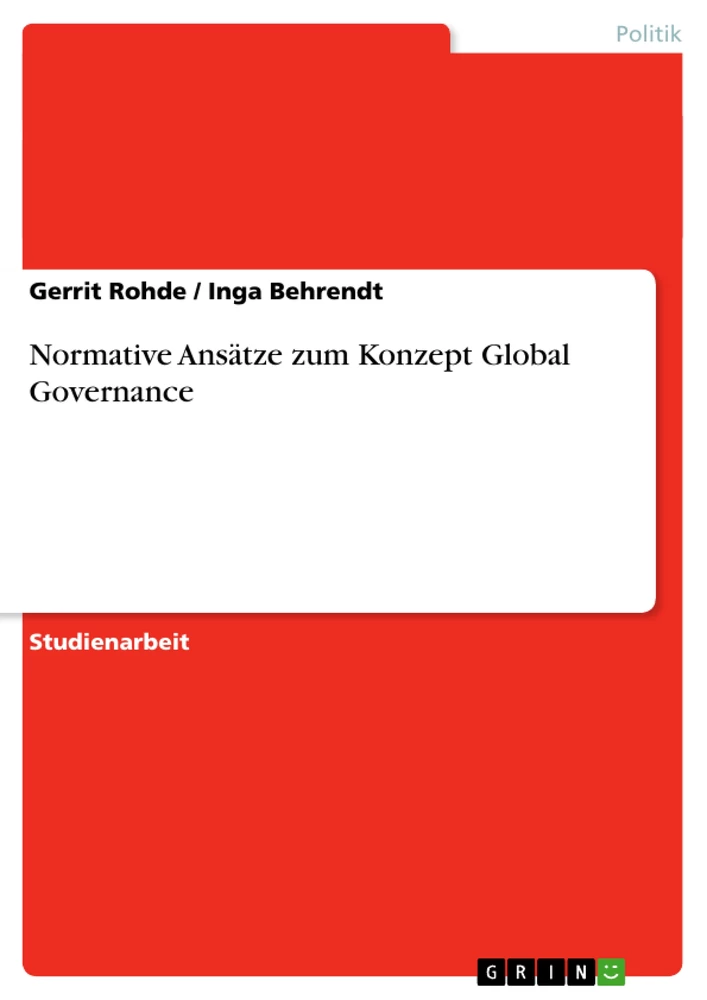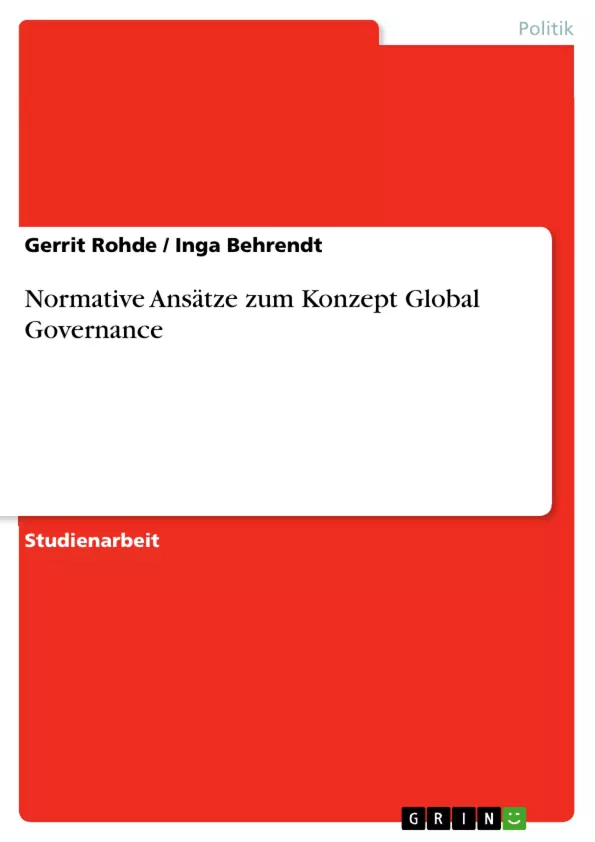Im Zuge der Globalisierung, die nach dem Ende des Kalten Krieges immer stärker an Fahrt aufnahm, muss sich die Weltbevölkerung neuen Herausforderungen und Problemen stellen. Die Mechanismen des Welthandels, des Weltfinanzmarktes, sowie des internationalen Kommunikations- und Informationssektors zeigen unter anderem, dass geografische Entfernungen und Grenzen eine immer geringere Rolle spielen. Handelshemmnisse werden abgebaut und erleichtern den immer komplexer und schneller werdenden internationalen Handel - die Welt rückt näher zusammen. Das Handeln eines Staates wird mehr und mehr mit dem Blick über die Schulter, oder besser, mit dem Blick über die Landesgrenzen hinaus durchgeführt. Eine scheinbar nationale Krise kann sich global auswirken, da inzwischen eine massive Interdependenz der Staaten existiert. Um nur kurz ein Beispiel zu nennen: Der letzte Irakkrieg und der damit verbundene Kampf um die irakischen Ölvorkommen, das schwarze Gold des Nahen Ostens, führte dazu, dass die Ölpreise weltweit anstiegen. Auch der so genannte Treibhauseffekt und die damit verbundenen Umweltkatastrophen sind ein globales Problem, dessen Auswirkungen nur global bekämpft werden können. Die traditionelle Außenpolitik der Nationalstaaten kann das nicht mehr leisten. Seit dem Ende des Kalten Krieges entwickelt sich immer konkreter der Gedanke, die Welt als ein Ganzes zu sehen und nicht als einen Flickenteppich aus vielen kleinen Staaten, die neben ihrer eigenen Politik und der Lösung „hausgemachter“ Probleme nebenbei versuchen, auch weltweit zu agieren. Die Welt wurde als Staatenwelt gesehen, in der Staaten die Hauptakteure darstellten. Andere Akteursgruppen wurden außer Acht gelassen. Dabei sieht es mittlerweile ganz anders aus. Transnationale Unternehmen haben die Weltwirtschaft klar in ihrer Hand, international vernetzte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) besitzen Beobachterstatus bei UN-Organisationen und nehmen an Weltkonferenzen teil. Sie sind global orientiert und könnten als der Beginn einer Welt-Bürgerschaft gesehen werden. Ihre Arbeit wird durch die Unterstützung (oft finanziell) der Bevölkerung und nicht durch die des Staates ermöglicht und legitimiert.
Um die Herausforderungen und Probleme der Zukunft zu bewältigen, ist eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen, sowie privaten Akteuren notwenig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was heißt Global Governance?
- Aufbau der Global Governance-Struktur - Die „,6 Säulen“
- Welthandelsordnung
- Weltwettbewerbsordnung
- Weltwährungsordnung
- Weltsozialordnung
- Weltumweltordnung
- Weltfriedensordnung
- Die Kommission für globale Ordnungspolitik
- Der Rat für Wirtschaftliche Sicherheit
- Wachsende wirtschaftliche Dependenzen
- Armut durch wirtschaftliche Diskriminierung.
- Ökologische Ökonomie
- Neugründung des RWS
- Aufgaben und Ziele
- Struktur und Zusammensetzung.
- Textkritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Global Governance und analysiert dessen Bedeutung und Entwicklung in der heutigen Welt. Sie untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich durch die zunehmende Interdependenz der Staaten ergeben, und betrachtet verschiedene Ansätze zur Gestaltung einer globalen Ordnung.
- Das Wesen und die Definition von Global Governance
- Die Rolle der „6 Säulen“ in der Gestaltung einer Weltordnungspolitik
- Die Bedeutung von internationalen Organisationen und Regimen für die Global Governance
- Die Herausforderungen, die durch die unterschiedlichen Wohlstandsniveaus der Staaten entstehen
- Der Zusammenhang zwischen Global Governance und dem erweiterten Sicherheitsbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Globalisierung und die Notwendigkeit einer neuen Form der Zusammenarbeit zwischen Staaten und anderen Akteuren dar. Das Kapitel „Was heißt Global Governance?“ definiert den Begriff und seine Bedeutung in der heutigen Welt. Im Kapitel „Aufbau der Global Governance-Struktur - Die „,6 Säulen““ werden die sechs Säulen der Global Governance - Welthandelsordnung, Weltwettbewerbsordnung, Weltwährungsordnung, Weltsozialordnung, Weltumweltordnung und Weltfriedensordnung - vorgestellt und ihre Bedeutung erläutert.
Das Kapitel „Die Kommission für globale Ordnungspolitik“ widmet sich der Entstehung und den Zielen der Commission on Global Governance. Es beleuchtet die Bedeutung der „menschlichen Sicherheit“ im Kontext der globalen Herausforderungen. Das Kapitel „Der Rat für Wirtschaftliche Sicherheit“ beschäftigt sich mit den wachsenden wirtschaftlichen Dependenzen, der Armut durch wirtschaftliche Diskriminierung und der Bedeutung der ökologischen Ökonomie.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Global Governance, Weltordnungspolitik, „6 Säulen“, Interdependenz der Staaten, internationale Organisationen, internationale Regime, menschliche Sicherheit, erweiterter Sicherheitsbegriff, wirtschaftliche Dependenzen, Armut, ökologische Ökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept "Global Governance"?
Es bezeichnet ein System der Weltordnungspolitik, das auf der Zusammenarbeit zwischen staatlichen, nicht-staatlichen und privaten Akteuren basiert, um globale Herausforderungen zu bewältigen.
Was sind die "6 Säulen" der Global Governance?
Die Struktur umfasst die Welthandels-, Weltwettbewerbs-, Weltwährungs-, Weltsozial-, Weltumwelt- und Weltfriedensordnung.
Warum reicht die traditionelle Außenpolitik nicht mehr aus?
Aufgrund massiver Interdependenzen (z.B. beim Ölpreis oder Klimawandel) können nationale Krisen globale Auswirkungen haben, die ein einzelner Staat nicht mehr allein lösen kann.
Welche Rolle spielen Nichtregierungsorganisationen (NGOs)?
NGOs agieren als global orientierte Akteure mit Beobachterstatus bei der UN und legitimieren ihre Arbeit oft direkt durch die Unterstützung der Weltbürgerschaft.
Was ist die Aufgabe des Rates für Wirtschaftliche Sicherheit?
Er soll wirtschaftliche Diskriminierung und Armut bekämpfen sowie eine ökologische Ökonomie im Kontext wachsender globaler Abhängigkeiten fördern.
Was versteht man unter "menschlicher Sicherheit"?
Dies ist ein erweiterter Sicherheitsbegriff, der über militärische Aspekte hinausgeht und den Schutz des Individuums vor Armut, Umweltkatastrophen und sozialer Ungerechtigkeit umfasst.
- Arbeit zitieren
- Diplom Politologe Gerrit Rohde (Autor:in), Inga Behrendt (Autor:in), 2005, Normative Ansätze zum Konzept Global Governance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142358