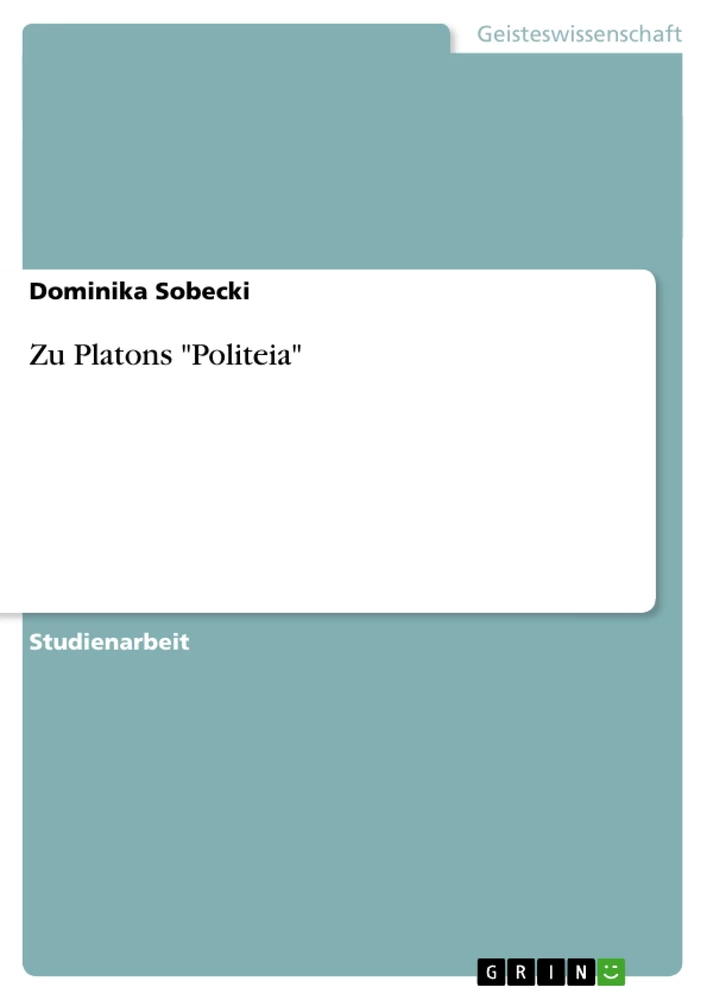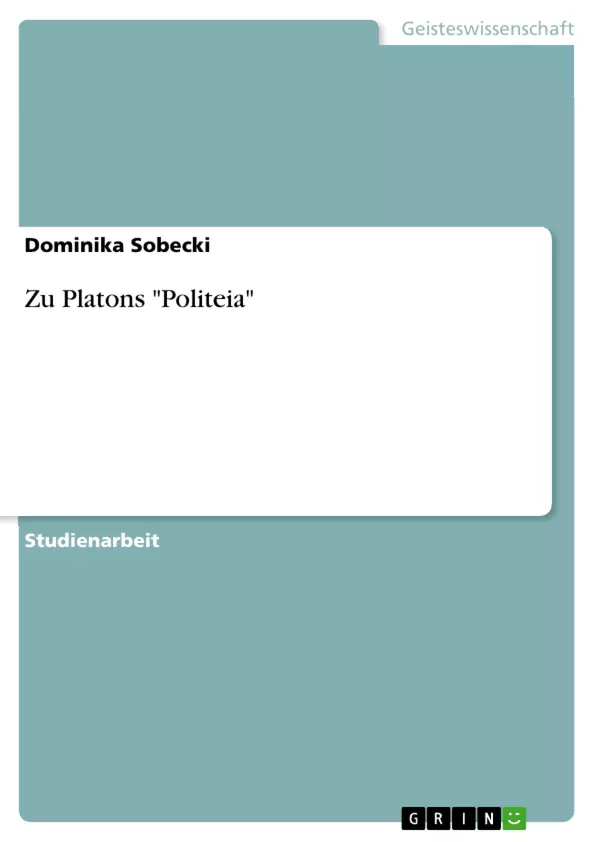Take-Home-Klausr. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden folgende Fragestellungen gelöst: A. Welches ist die leitende Fragestellung der Politeia? B. Geben Sie eine kurze Darstellung des gedanklichen Aufbaus der Politeia. C. Geben Sie eine Darstellung der Seelenkonzeption Platons in der Politeia.D. Wie verhalten sich Seelenkonzept und Gemeinschaftsverfassung zueinander? E. Interpretieren Sie das Sonnengleichnis und das Liniengleichnis. F. Geben Sie eine Darstellung der Verfassungen, der ihnen entsprechenden Menschentypen und des Verfassungswandels (543a-576b). G. Stellen Sie in Grundzügen Platons Dichterkritik dar (595a-608b).
Inhaltsverzeichnis
- A. Welches ist die leitende Fragestellung der Politeia?
- B. Geben Sie eine kurze Darstellung des gedanklichen Aufbaus der Politeia.
- C. Geben Sie eine Darstellung der Seelenkonzeption Platons in der Politeia.
- D. Wie verhalten sich Seelenkonzept und Gemeinschaftsverfassung zueinander?
- E. Interpretieren Sie das Sonnengleichnis und das Liniengleichnis.
- F. Geben Sie eine Darstellung der Verfassungen, der ihnen entsprechenden Menschentypen und des Verfassungswandels (543a-576b).
- G. Stellen Sie in Grundzügen Platons Dichterkritik dar (595a-608b).
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Platons Politeia und untersucht die zentrale Fragestellung nach dem Wesen der Gerechtigkeit und warum sie der Ungerechtigkeit vorzuziehen ist. Die Arbeit analysiert den gedanklichen Aufbau der Politeia und beleuchtet Platons Seelenkonzeption, die als Grundlage für die Beschreibung des idealen Staates dient. Des Weiteren werden die Beziehung zwischen Seelenkonzept und Staatsverfassung, die Interpretation der Gleichnisse und die Kritik an der Dichtkunst behandelt.
- Wesen der Gerechtigkeit
- Seelenkonzeption Platons
- Aufbau der Politeia
- Beziehung zwischen Seele und Staat
- Platons Kritik an der Dichtkunst
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: In diesem Kapitel wird die leitende Fragestellung der Politeia vorgestellt: Was ist Gerechtigkeit und warum ist sie der Ungerechtigkeit vorzuziehen? Platon lässt Sokrates diese Frage anhand der Beschreibung der menschlichen Seele und des Staatswesens beantworten.
- Kapitel 2: Das zweite Kapitel beschreibt den gedanklichen Aufbau der Politeia. Es werden die verschiedenen Definitionen der Gerechtigkeit sowie die These, dass Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit vorzuziehen sei, diskutiert.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel wird Platons Vorstellung vom Aufbau der menschlichen Seele präsentiert. Es wird die dreigeteilte Seele beschrieben, die aus dem Denkbaren, dem Begehrlichen und dem Eifrigen besteht. Platon argumentiert, dass das Vernünftige über die Gesamtheit der Seele herrschen sollte.
- Kapitel 4: Der vierte Teil der Arbeit befasst sich mit dem gerechten Staat. Es werden die Kriterien zur Realisierung des gerechten Staates genannt, wobei das Grundlegende die Philosophenherrschaft ist.
- Kapitel 5: In diesem Kapitel wird Platons Philosophen- und Philosophiekonzeptionen erläutert. Um zu verdeutlichen, dass der gerechte Staat und der gerechte Mensch die glücklichsten sind, werden sie in einen Vergleich zu vier weiteren Staatsformen und den ihnen entsprechenden Menschentypen gestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Politeia, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Seelenkonzeption, Staat, Philosophenherrschaft, Dichterkritik, Gleichnisse, Staatsformen, Menschentypen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Fragestellung in Platons "Politeia"?
Die Hauptfrage lautet: Was ist Gerechtigkeit, und warum ist ein gerechtes Leben dem ungerechten vorzuziehen?
Wie ist die menschliche Seele laut Platon aufgebaut?
Platon entwirft ein dreigeteiltes Seelenkonzept bestehend aus dem Vernünftigen (Denkbaren), dem Muthaften (Eifrigen) und dem Begehrlichen.
Was versteht Platon unter der "Philosophenherrschaft"?
Für Platon ist der ideale Staat nur möglich, wenn Philosophen die Herrschaft übernehmen, da nur sie die Idee des Guten schauen und weise regieren können.
Welche Bedeutung haben das Sonnen- und das Liniengleichnis?
Diese Gleichnisse dienen der Veranschaulichung von Platons Erkenntnistheorie und dem Stufenbau der Wirklichkeit, von der bloßen Meinung bis zum wahren Wissen.
Warum kritisiert Platon die Dichtkunst?
Platon sieht in der Dichtung eine bloße Nachahmung der Wirklichkeit, die von der Wahrheit wegführt und die Emotionen der Bürger auf eine Weise beeinflusst, die dem Staat schaden könnte.
- Arbeit zitieren
- Dominika Sobecki (Autor:in), 2008, Zu Platons "Politeia", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142388