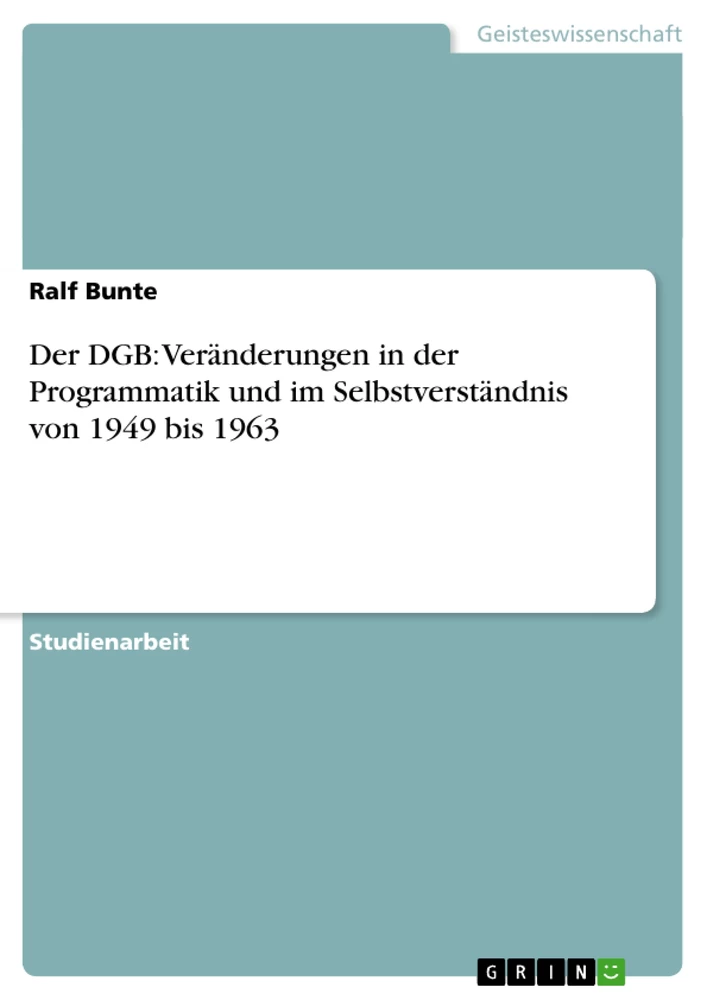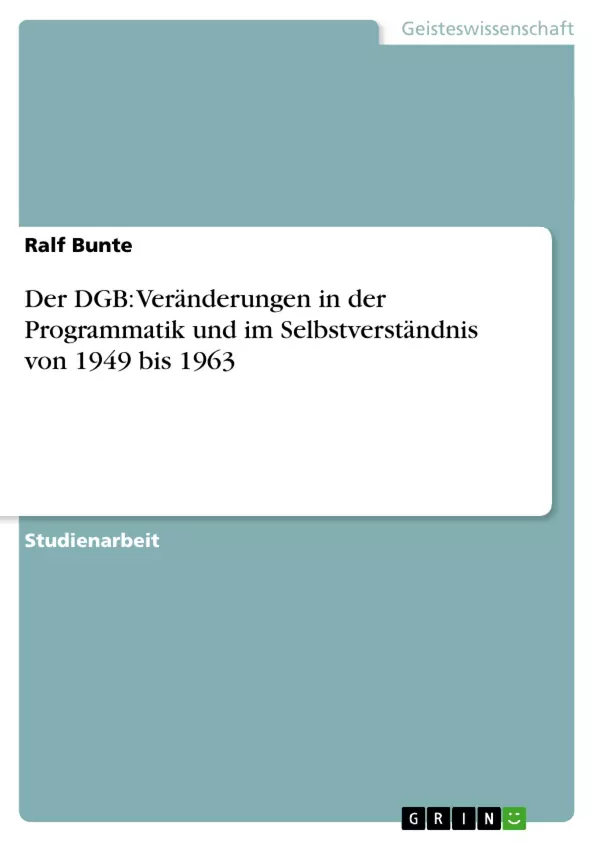Die konservative Kritik an den Gewerkschaften hat sich seit Beginn der 60er Jahre in ihren prinzipiellen Inhalten kaum geändert. Den Gewerkschaften wird vorgeworfen, daß sie als Gegenmacht zur bestehenden Gesellschaftsordnung angetreten seien, nämlich um die Staatsführung durch planwirtschaftliche Vernichtung des kapitalistischen Unternehmertums zu übernehmen. Von ihnen drohe die Gefahr einer syndikalistischen und kollektivistischen Wirtschaft und Gesellschaft.
Progressive Kritiker argumentieren dagegen, daß die Gewerkschaften zunehmend zu einem Instrument der Einordnung der Arbeitnehmer in die gegebene politisch-ökonomische Machtverteilung würden und zur Stabilisierung des kapitalistischen Systems beitragen. Diese Systemstabilisierung werde durch die Verteilung von Gratifikationen an die Gewerkschaftsmitglieder vollzogen, indem insbesondere „Vollversicherungen“ für Streiks und Aussperrungen angeboten würden.
Analysierte man die von 1949 bis 1963 wichtigsten programmatischen Äußerungen des DGB – insbesondere das Grundsatzprogramm von 1949, das Aktionsprogramm von 1955 sowie das neuere Grundsatzprogramm von 1963 – im Hinblick auf die genannten Aussagen der Kritiker, dann ließe sich leicht feststellen, auf welche Äußerungen sich diese beziehen.
Die konservativen Kritiker würden vor allem das Münchner Grundsatzprogramm von 1949 heranziehen, um ihre These von der „Übernahme der Staatsführung“ durch die Gewerkschaften mittels der „planwirtschaftlichen Vernichtung des kapitalistischen Unternehmertums zu belegen“.
Die Kritik progressiver Kreise würde sich dagegen auf das Aktionsprogramm von 1955 und vor allem auf das Grundsatzprogramm von 1963 stützen. Aus diesen Programmen ließe sich vermutlich recht eindeutig die „Einordnung der Arbeitnehmer in die gegebene politisch-ökonomische Machtverteilung“ ableiten.
Jeder der genannten Kritiker unterstellt den Gewerkschaften damit ein anderes Selbstverständnis, das aus der jeweils aktuellen Programmatik resultiert. Die Frage, die uns in diesem Aufsatz beschäftigen wird lautet deshalb: Welches Selbstverständnis der Gewerkschaften läßt sich aus den Programmen des DGB herauslesen und welchen Wandlungen war es im Laufe der Zeit unterworfen?
Inhaltsverzeichnis
- Hinweis an den Leser
- Definitionen
- 1. Zur Kritik an der Rolle der Gewerkschaften: Eine Einleitung
- 2. Historische Bedingungen für den Aufbau der westdeutschen Gewerkschaften nach dem Zweiten Weltkrieg
- a) Die westlichen Siegermächte
- b) Gesellschaftliche und politische Determinanten des Neuaufbaus
- 3. Der organisatorische Neuaufbau
- a) Politische Faktoren
- b) Zwischenschritte auf dem Weg zum DGB
- 4. Die Neuordnungsvorstellungen des DGB
- a) Das Grundsatzprogramm von 1949
- b) Das Scheitern der Neuordnungsvorstellungen
- 5. Anpassung an veränderte Bedingungen
- a) Das Aktionsprogramm von 1955
- b) Das neue Grundsatzprogramm von 1963
- 6. Fazit: Die Veränderungen im Selbstverständnis des DGB
- Literatur
- a) Primär
- b) Sekundär
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Veränderungen in der Programmatik und im Selbstverständnis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zwischen 1949 und 1963. Sie untersucht, wie der DGB auf die sich verändernden politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen in der frühen Bundesrepublik reagierte und wie sich diese Veränderungen in seiner programmatischen Ausrichtung und seinem Selbstverständnis widerspiegelten.
- Der Aufbau des DGB im Kontext der Nachkriegsbedingungen
- Die programmatischen Zielsetzungen des DGB in den Jahren 1949 bis 1963
- Die Anpassung des DGB an veränderte Bedingungen, insbesondere die Wirtschaftswunderjahre und die Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft
- Die Entwicklung des Selbstverständnisses des DGB in Bezug auf die Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft
- Der Einfluss von keynesianischen Wirtschaftskonzepten auf die Programmatik des DGB
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Rolle der Gewerkschaften in der westdeutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg ein und stellt die Kritik an deren Rolle dar. Kapitel 2 beleuchtet die historischen Bedingungen für den Aufbau des DGB, indem es sowohl die Rolle der westlichen Siegermächte als auch die gesellschaftlichen und politischen Determinanten des Neuaufbaus analysiert. In Kapitel 3 wird der organisatorische Neuaufbau des DGB betrachtet, wobei die politischen Faktoren und die Zwischenschritte auf dem Weg zum DGB im Mittelpunkt stehen. Kapitel 4 widmet sich den Neuordnungsvorstellungen des DGB, insbesondere dem Grundsatzprogramm von 1949 und dem Scheitern seiner Zielsetzungen. Kapitel 5 behandelt die Anpassung des DGB an veränderte Bedingungen, wobei das Aktionsprogramm von 1955 und das neue Grundsatzprogramm von 1963 im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), dessen Programmatik und Selbstverständnis im Kontext der frühen Bundesrepublik. Weitere wichtige Begriffe sind die Gewerkschaftsbewegung, die Nachkriegsordnung, die Sozialen Marktwirtschaft, Keynesianismus, die Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft und die Veränderung der politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich das Selbstverständnis des DGB zwischen 1949 und 1963?
Der DGB entwickelte sich von radikalen Neuordnungsvorstellungen (1949) hin zu einer Einordnung in die Soziale Marktwirtschaft und einer systemstabilisierenden Rolle (1963).
Was war der Kern des Münchner Grundsatzprogramms von 1949?
Das Programm forderte eine grundlegende Neuordnung der Wirtschaft, weg vom Kapitalismus hin zu planwirtschaftlichen Elementen und einer stärkeren Mitbestimmung.
Warum scheiterten die frühen Neuordnungsvorstellungen der Gewerkschaften?
Das Scheitern lag an den politischen Realitäten der Ära Adenauer, dem Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft (Wirtschaftswunder) und den Vorgaben der westlichen Siegermächte.
Welche Kritik üben progressive Kreise am DGB?
Progressive Kritiker werfen dem DGB vor, durch die Verteilung von Gratifikationen die Arbeitnehmer lediglich in das bestehende kapitalistische System zu integrieren, anstatt es zu verändern.
Was kennzeichnet das Grundsatzprogramm von 1963?
Es markiert die endgültige Akzeptanz der bestehenden Gesellschaftsordnung und legt den Fokus auf Lohnpolitik und soziale Sicherheit innerhalb des Systems.
- Quote paper
- Ralf Bunte (Author), 2001, Der DGB: Veränderungen in der Programmatik und im Selbstverständnis von 1949 bis 1963, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14245