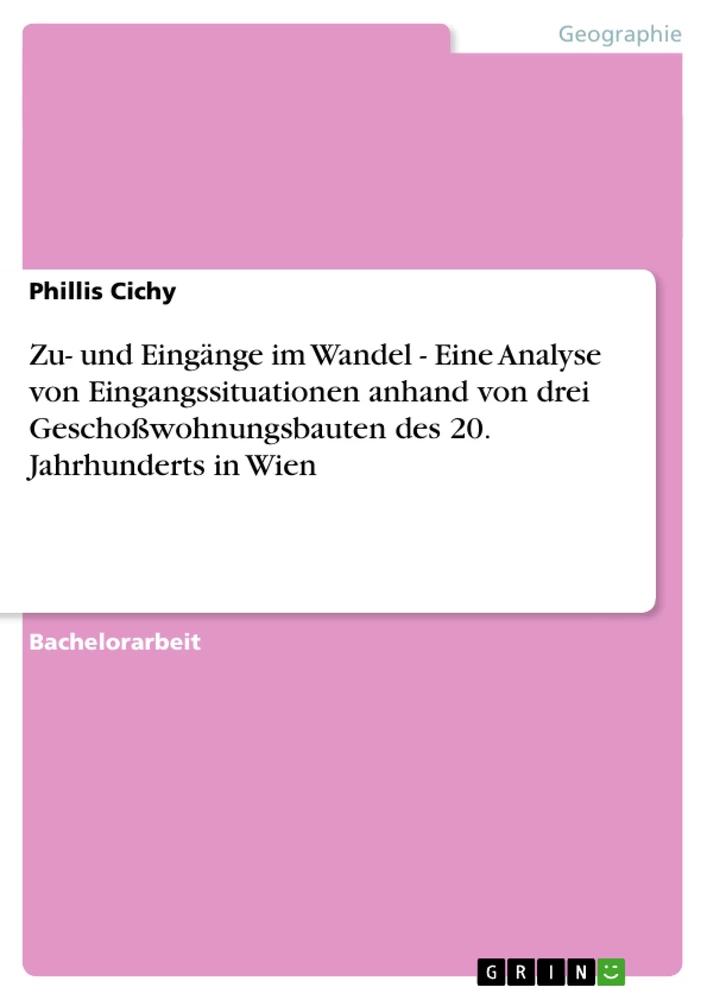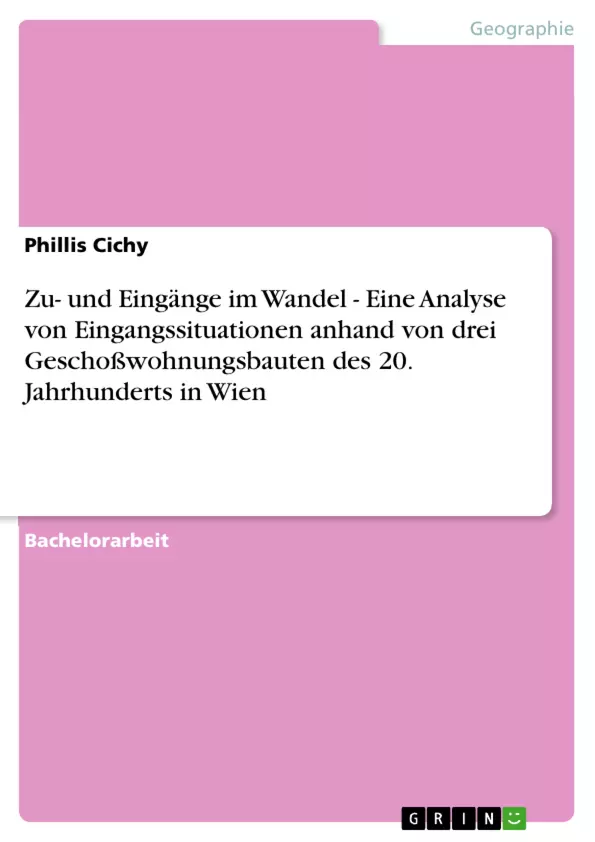Die Arbeit analysiert drei unterschiedlichen Geschoßwohnungsbauten hinsichtlich ihrer Erschließung (äußere und innere) und versucht ihren Wandel bzw. ihre Entwicklung den Bauphasen und ihren Ideologien gegenüberzustellen.
Eingangssituationen sind einem stetigen Wandel unterlaufen. Zu- und Eingänge von
Siedlungsbauten weisen untereinander Ähnlichkeiten auf, entwickeln sich aber,
aufgrund neuer Nutzungsmöglichkeiten und architektonischer Ausdifferenzierungen,
weiter. Durch ihre Gestaltungen entstehen unterschiedliche äußere Eindrücke, die
wiederum den Zeitgeist, in der die Siedlung entstand, einfängt und zum Ausdruck bringt.
Kompakte Wohnsiedlungen, die aufgrund ihrer gleichförmigen Architektur als
Einheit gesehen werden, vermitteln durch ausgeprägte Wege- und
Erschließungsformen unterschiedliche Raumeindrücke.
Diese sind, je nach
Entstehungszeit, von den damals vorherrschenden Bauideologien geprägt. Der Karl-
Marx-Hof drückt mit seinen Eingängen das propagandarisierte Wehrhafte der damaligen
Zeit aus, während die Nachkriegsjahre und die Zeit des Wiederaufbaues von
standardisierten Gemeindebauten wie der Weinberg-Görgensiedlung geprägt waren.
Die zeitgenössische Architektur am Beispiel der Gartensiedlung Ottakring hingegen
bringt durch ihre vielseitige reihenhausähnliche Bauweise wiederum neue Typen der
Erschließung hervor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- 1.1 Zielsetzung und Forschungsfragen
- 1.2 Methoden
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- Eingänge als Raumbildner
- 2.1 Raum begreifen - Der Raumbegriff
- 2.2 Der WegRaum als Zugang zum Eingang
- 2.3 Die EingangsSchwelle
- Eingangssituationen im Wohnbau
- 3.1 Bedeutung und Funktion von Zu- und Eingängen
- 3.2 RaumErschließung - Analyse der Geschosswohnungsbauten
- 3.2.1 Der Karl-Marx-Hof der 1920er Jahre
- 3.2.2 Siedlung Görgengasse 26/Weinberggasse 46 aus den 1960er Jahren
- 3.2.3 Gartensiedlung Ottakring aus den Jahren 1999/2000
- Ergebnisse und Diskussion
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung von Zu- und Eingängen in Wiener Geschosswohnungsbauten des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Bedeutung und Funktion von Eingangssituationen zu beschreiben und deren Entwicklung im Laufe der Zeit nachzuvollziehen. Die Analyse konzentriert sich auf die Gestaltung, die Erschließungssysteme und den Zusammenhang mit dem umliegenden Freiraum.
- Bedeutung und Funktion von Zu- und Eingängen im Wohnbau
- Entwicklung der Eingangssituationen im 20. Jahrhundert
- Zusammenhang zwischen Eingangsgestaltung und städtebaulichem Kontext
- Analyse unterschiedlicher Erschließungssysteme
- Räumliche Wahrnehmung und die Rolle der "Schwelle"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation und formuliert die Forschungsfrage nach der Entwicklung von Zu- und Eingängen im Wiener Wohnbau des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit argumentiert, dass Eingangssituationen nicht nur funktionale, sondern auch repräsentative und identitätsstiftende Aspekte für Wohnsiedlungen besitzen. Die Forschungsfrage wird durch die Analyse dreier Wiener Wohnbauten aus unterschiedlichen Epochen beantwortet.
Eingänge als Raumbildner: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit und behandelt den Raumbegriff, den Übergang als "Schwelle" und die Bedeutung von Eingängen als verbindende und trennende Elemente. Die Analyse der "Schwelle" als Übergang zwischen Innen und Außen wird detailliert ausgeführt. Der Fokus liegt auf der räumlichen und gestalterischen Wirkung von Eingängen.
Eingangssituationen im Wohnbau: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung und Funktion von Zu- und Eingängen im Wohnbau. Es wird die Raumerschließung an drei Beispielen – dem Karl-Marx-Hof, der Siedlung Görgengasse/Weinberggasse und der Gartensiedlung Ottakring – untersucht und die jeweiligen Gestaltungsmerkmale im Kontext ihrer Entstehungszeit erläutert. Die Kapitel analysiert die architektonischen und funktionalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Beispiele und deren Einfluss auf die Raumerfahrung der Bewohner.
Schlüsselwörter
Zu- und Eingänge, Wohnbau, Wien, 20. Jahrhundert, Raumerschließung, Eingangsgestaltung, Freiraum, Schwelle, Architektur, Siedlungsbau, Karl-Marx-Hof, Görgengasse/Weinberggasse, Gartensiedlung Ottakring, Raumwahrnehmung, Identifikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Analyse der Entwicklung von Zu- und Eingängen in Wiener Geschosswohnungsbauten des 20. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung von Zu- und Eingängen in Wiener Geschosswohnungsbauten des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Bedeutung, Funktion und Gestaltung von Eingangssituationen sowie deren Entwicklung im Laufe der Zeit und dem Zusammenhang mit dem umliegenden Freiraum.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Bedeutung und Funktion von Eingangssituationen und verfolgt deren Entwicklung im 20. Jahrhundert. Sie analysiert die Gestaltung, die Erschließungssysteme und den Zusammenhang mit dem umliegenden Freiraum. Die Forschungsfrage wird durch die Analyse dreier Wiener Wohnbauten aus unterschiedlichen Epochen beantwortet.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit analysiert drei Wiener Wohnbauten aus unterschiedlichen Epochen des 20. Jahrhunderts: den Karl-Marx-Hof (1920er Jahre), die Siedlung Görgengasse 26/Weinberggasse 46 (1960er Jahre) und die Gartensiedlung Ottakring (1999/2000). Die Analyse konzentriert sich auf die architektonischen und funktionalen Merkmale der Eingangssituationen und deren Einfluss auf die Raumerfahrung der Bewohner.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Bedeutung und Funktion von Zu- und Eingängen im Wohnbau; Entwicklung der Eingangssituationen im 20. Jahrhundert; Zusammenhang zwischen Eingangsgestaltung und städtebaulichem Kontext; Analyse unterschiedlicher Erschließungssysteme; Räumliche Wahrnehmung und die Rolle der "Schwelle".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung; Eingänge als Raumbildner; Eingangssituationen im Wohnbau; Ergebnisse und Diskussion; Schlussfolgerungen. Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation und formuliert die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel legt den theoretischen Grundstein und behandelt den Raumbegriff und die "Schwelle". Das dritte Kapitel analysiert die drei Beispielbauten. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden abschließend zusammengefasst.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert drei Wiener Wohnbauten: den Karl-Marx-Hof (1920er Jahre), die Siedlung Görgengasse 26/Weinberggasse 46 (1960er Jahre) und die Gartensiedlung Ottakring (1999/2000). Diese Beispiele repräsentieren unterschiedliche Epochen und Architekturstile des 20. Jahrhunderts.
Was ist die Bedeutung der "Schwelle" in dieser Arbeit?
Die "Schwelle" wird als wichtiger Übergang zwischen Innen und Außen betrachtet und detailliert analysiert. Sie spielt eine zentrale Rolle für die räumliche und gestalterische Wirkung von Eingängen und wird als verbindendes und trennendes Element untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zu- und Eingänge, Wohnbau, Wien, 20. Jahrhundert, Raumerschließung, Eingangsgestaltung, Freiraum, Schwelle, Architektur, Siedlungsbau, Karl-Marx-Hof, Görgengasse/Weinberggasse, Gartensiedlung Ottakring, Raumwahrnehmung, Identifikation.
- Quote paper
- Phillis Cichy (Author), 2007, Zu- und Eingänge im Wandel - Eine Analyse von Eingangssituationen anhand von drei Geschoßwohnungsbauten des 20. Jahrhunderts in Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142545