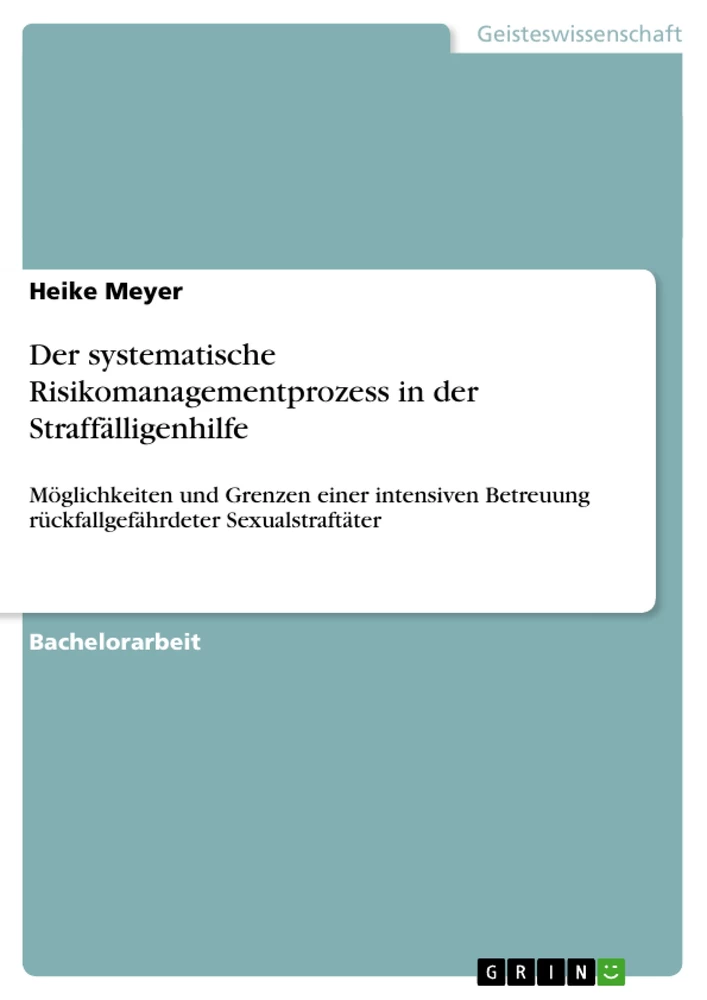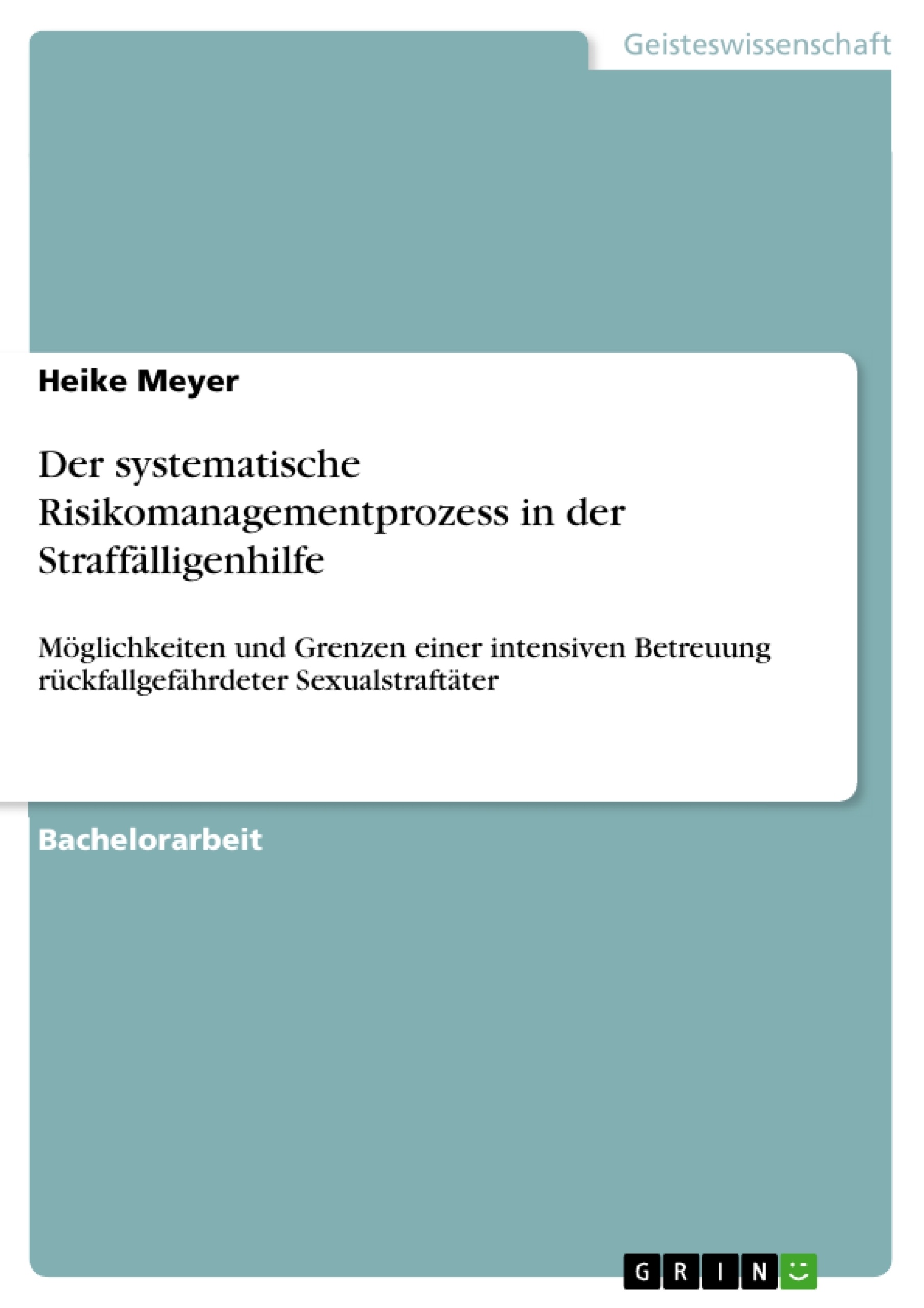Die so genannte „Nothing-Works“-These beherrscht seit langer Zeit die Diskussionen und hat den positiven Sinn von Behandlungs- und Präventionsprogrammen stark zugesetzt. Zeitgleich geht eine Zunahme der Straflust in der Bevölkerung mit einer punitiven Tendenz in der Kriminalpolitik einher, mit der Folge der kontinuierlichen Verschärfung des Erwachsenen- sowie Jugend-strafrechts (vgl. THOMAS u. a. 2006: 80 ff.). Insbesondere betrifft es die Delikte der Vergewaltigung mit und ohne Todesfolge sowie den sexuellen Kindesmissbrauch. Ludwig-Mayerhofer spricht in diesem Zusammenhang von der Entwicklung einer sektoralen Punitivität – einer Strafverschärfung bei spezifischen Taten und Tätergruppen (vgl. LUDWIG-MAYERHOFER 2000: 145). „Zunehmende staatliche Repression und wachsende ‚Lust auf Strafe’ sind offensichtlich zwei parallele Prozesse und Entwicklungen, die sich in allen post-modernen Gesellschaften beobachten lassen. Politiker und deren Parteien fügen und unterwerfen sich diesem Prozess, instrumentalisieren ihn, wenn sie ihn nicht sogar schüren.“(SACK 2006).
Neue kriminalpolitische Ziele führen zu neuen sicherheitspolitischen Bewertungen. Forschungsprojekte konzentrieren sich verstärkt auf die Aspekte der Rückfallgefährdung und der Identifikation von Risikofaktoren bei Sexualstraftätern. Auch in der staatlichen Straffälligenhilfe wurden die bisherigen Rahmenbedingun-gen zunehmend aufgeweicht und in Frage gestellt. Die Veränderungen betreffen die Professionalisierung, Privatisierung, Neustrukturierung und die Infragestellung des Resozialisierungszieles. Insbesondere beim Resozialisierungsziel ist eine neue Schwerpunktsetzung sichtbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Gesellschaftlicher Umgang mit Sexualstraftätern
- Forschungsstand und Problemaufriss
- Thesen
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen des Risikomanagements
- Relevanz und Entwicklung des Risikomanagements
- Ursprung und geschichtlicher Abriss
- Risikoquellen und Risikoarten
- Risikomanagement als Prozess
- Phasen, Methoden und Instrumente
- Risikopolitik
- Risikoidentifikation und Risikoanalyse
- Risikobewertung
- Risikobegrenzung und Risikosteuerung
- Risikoüberwachung
- Risikokommunikation
- Risikomanagement in öffentlichen Trägern
- Voraussetzungen
- Typische Ziele
- Typische Risiken
- Umsetzungsstrategien
- Risikoquellen in der Straffälligenhilfe
- Bewährungshilfe und Führungsaufsicht
- Voraussetzungen für ein Risikomanagement
- Der Mensch als „Risikofaktor“
- Der Bewährungshelfer
- Professionelles Handeln
- Die Manipulation des Bewährungshelfers
- Der rückfallgefährdete Sexualstraftäter
- Klassifizierung von Sexualstraftätern
- Faktoren zur Risikobestimmung
- Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit
- Bewertung
- Analysen bestehender Modelle
- England
- HEADS, Bayern
- KSKS, Kiel
- SURE, Hamburg
- ISIS, Sachsen
- ARGUS, Hessen
- KURS, Niedersachsen
- Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem systematischen Risikomanagementprozess in der Straffälligenhilfe, insbesondere im Kontext der Betreuung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen einer intensiven Betreuung in diesem Bereich aufzuzeigen. Dabei werden die besonderen Herausforderungen und Risiken des Themas beleuchtet.
- Relevanz und Entwicklung des Risikomanagements in der Straffälligenhilfe
- Risikoquellen und -faktoren im Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern
- Analyse bestehender Modelle zur Risikobewertung und -steuerung
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen einer intensiven Betreuung
- Ethische und rechtliche Aspekte des Risikomanagements in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung des Risikomanagements in der Straffälligenhilfe. Sie stellt den Forschungsstand dar und formuliert die zentralen Thesen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Risikomanagements, inklusive seiner Entwicklung, Phasen, Methoden und Instrumente. Kapitel 3 fokussiert auf die Anwendung des Risikomanagements in öffentlichen Trägern, indem es Voraussetzungen, Ziele, Risiken und Umsetzungsstrategien betrachtet. Kapitel 4 widmet sich den spezifischen Risikoquellen in der Straffälligenhilfe, insbesondere im Zusammenhang mit der Betreuung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter. Hier werden die Rolle des Bewährungshelfers und die Faktoren zur Risikobestimmung bei Sexualstraftätern analysiert. Kapitel 5 analysiert verschiedene, in Deutschland etablierte Modelle zur Risikobewertung und -steuerung für Sexualstraftäter.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Straffälligenhilfe, Sexualstraftäter, Rückfallprognose, Risikobewertung, Risikobegrenzung, Bewährungshelfer, Intensivbetreuung, Intervention, Prävention, Ethische Aspekte, Rechtliche Aspekte, Modellanalyse, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Nothing-Works"-These in der Kriminologie?
Diese These besagt, dass Behandlungs- und Präventionsprogramme für Straffällige wirkungslos seien, was zu einer verstärkten Forderung nach repressiven Strafen geführt hat.
Welche Rolle spielt der Bewährungshelfer im Risikomanagement?
Der Bewährungshelfer muss professionell handeln, Risikofaktoren erkennen und gleichzeitig die Gefahr der Manipulation durch den Klienten minimieren.
Welche Modelle zur Risikobewertung von Sexualstraftätern gibt es in Deutschland?
Die Arbeit analysiert verschiedene Modelle wie HEADS (Bayern), KSKS (Kiel), SURE (Hamburg), ISIS (Sachsen), ARGUS (Hessen) und KURS (Niedersachsen).
Was sind zentrale Faktoren zur Bestimmung der Rückfallwahrscheinlichkeit?
Dazu gehören die Klassifizierung des Täters, spezifische Risikofaktoren der Tatbegehung sowie die Wirksamkeit bisheriger Interventionen.
Wie hat sich die Kriminalpolitik gegenüber Sexualstraftätern verändert?
Es gibt eine Tendenz zur "sektoralen Punitivität", also einer gezielten Strafverschärfung bei spezifischen Tätergruppen, und eine stärkere Gewichtung der öffentlichen Sicherheit gegenüber der Resozialisierung.
- Quote paper
- Heike Meyer (Author), 2009, Der systematische Risikomanagementprozess in der Straffälligenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142685