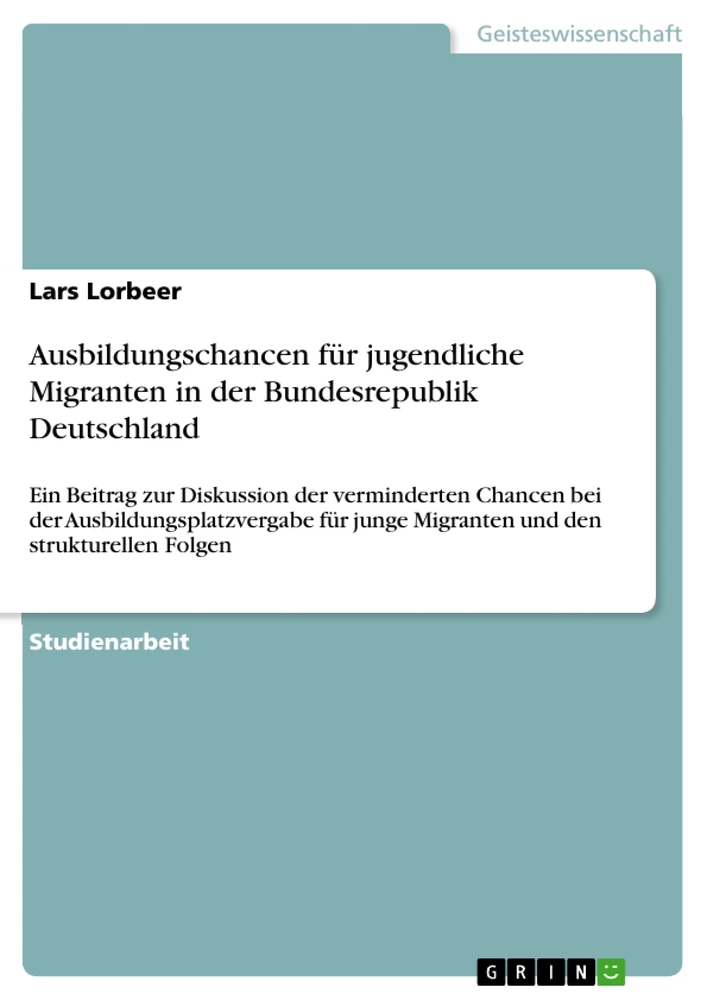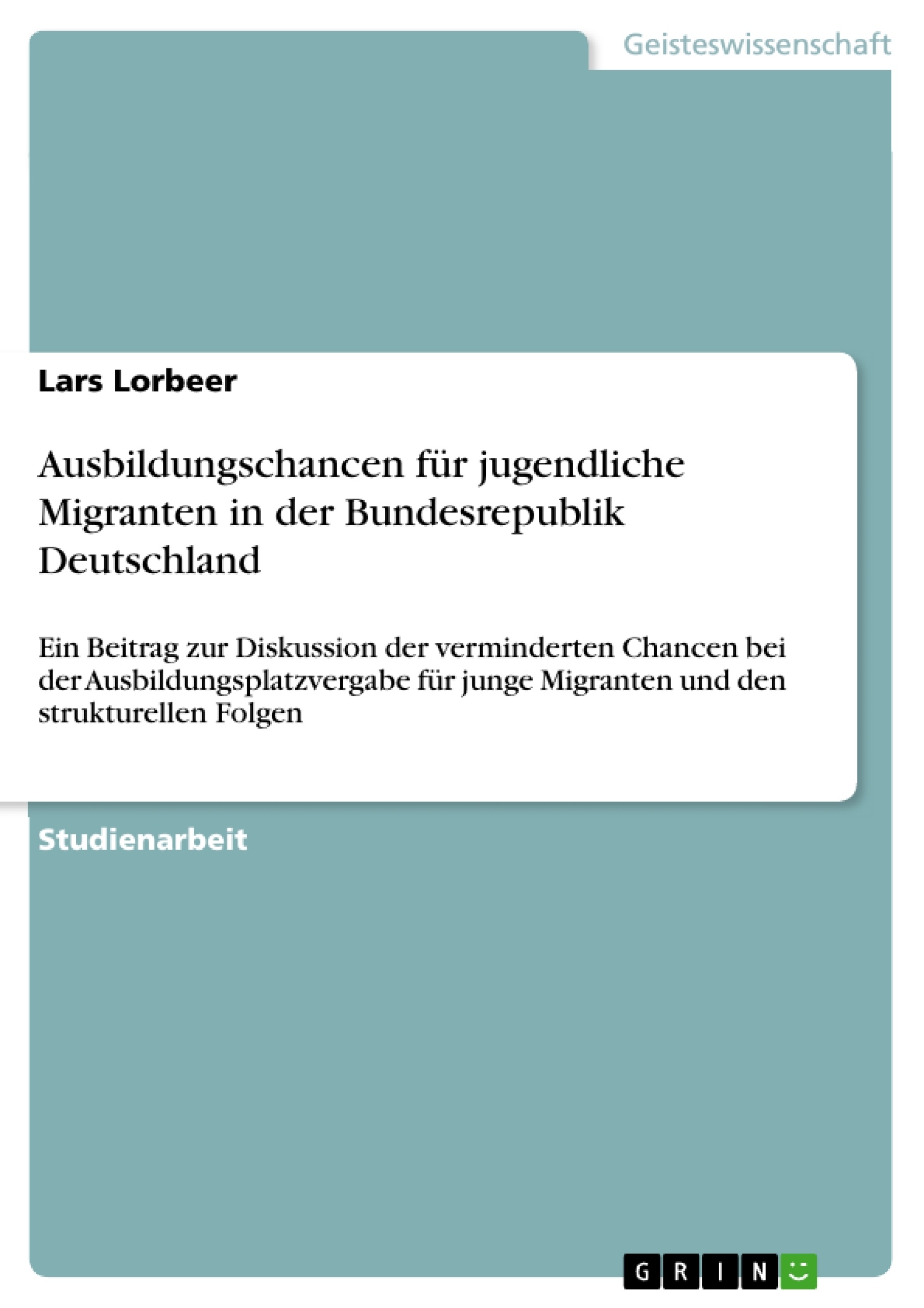Immer häufiger treffen in Deutschland Menschen unterschiedlicher Ethnien, Kulturen und Religionen aufeinander, müssen miteinander leben und voneinander lernen. Es wurden verschiedene Kommissionen gegründet, um die Integration dieser Menschen zu fördern, Probleme zu erörtern und um Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ein Bericht der „Unabhängigen Kommission Zuwanderung“ enthält folgende Aussagen: „Deutschland braucht Zuwanderinnen und Zuwanderer. Die Steuerung der Zuwanderung nach Deutschland und die Integration der Zugewanderten werden zu den wichtigsten politischen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte gehören.“
Dieser großen Aufgabe der Integration muss sich jedes Land stellen, welches Zuwanderung wünscht und zulässt, denn Zuwanderung und Integration bilden eine Einheit. Eine gelungene Integration bedeutet aber, für die in Deutschland lebenden Ausländer und Zuwanderer eine gleichberechtigte Teilnahme am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben gewährleisten zu können. Entscheidend ist hierbei, dass die Ausländer und Zuwanderer ihre kulturellen Identitäten nicht aufzugeben brauchen.
Letztendlich entscheiden faire Zugangschancen zu den zentralen Institutionen wie z. B. Schule und Ausbildungsplatz einer Gesellschaft, ob jemand integriert und somit als gleichberechtigter Bürger anerkannt ist. Durch die Beseitigung von Hindernissen und die Bekämpfung von Diskriminierung spezieller Menschengruppen kann eine Integration gefördert werden. Da jedoch viele Migranten mit Familien kommen, sind auch die Familien zu integrieren, insbesondere die Kinder. Der Erfolg im Bildungssystem, in der beruflichen Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt ist für die jungen Migranten entscheidend für ihre spätere berufliche Zukunft und ihre Lebenschancen.
==
Vgl. BiB: Bevölkerung. Fakten – Trends – Ursachen – Erwartungen – Die wichtigsten Fragen, S.15.
Vgl. ebd., S.17.
Vgl. Häußermann, Hartmut/Kapphan, Andreas: Integrationspolitik der Städte – ein Paradigmenwechsel. S.17.
Vgl. ebd., S.17.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausbildungssystem in Deutschland
- Das duale Schulsystem in Deutschland
- Zugangschancen junger Migranten zu einer beruflichen Ausbildung
- Jugendliche Migranten ohne Berufsabschluss
- Die Selektion von Auszubildenden mit Migrationshintergrund durch die Betriebe
- Kompetenz in der Schule
- Kultur und Familie
- Sprachliche Kompetenz
- Strukturelle Folgen für die Gesellschaft
- Erfolgschancen von jugendlichen Migranten beim Bewerbungsverfahren
- Verbleib von Migranten ohne einen betrieblichen Ausbildungsplatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ausbildungschancen von jugendlichen Migranten in der Bundesrepublik Deutschland und untersucht die strukturellen Folgen der verminderten Chancen bei der Ausbildungsplatzvergabe für junge Migranten. Im Zentrum steht die Frage, welche Herausforderungen und Hindernisse für Migranten im deutschen Ausbildungssystem existieren und wie diese die Integration und den beruflichen Erfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beeinflussen.
- Das duale Ausbildungssystem in Deutschland und die Zugangsanforderungen für Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Die Rolle von Sprache, Kultur und schulischer Kompetenz bei der Selektion von Auszubildenden durch Unternehmen
- Strukturelle Folgen für die Gesellschaft: Die Auswirkungen von fehlenden Ausbildungsplätzen auf die Integration und den beruflichen Werdegang von Migranten
- Chancengleichheit und Diskriminierung im deutschen Bildungssystem
- Die Integration von Familien und Kindern in den deutschen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der Integration von Migranten in Deutschland und hebt die Bedeutung von Bildung und Berufsausbildung für den Erfolg im deutschen Gesellschaftssystem hervor. Der erste Teil der Arbeit beleuchtet das duale Ausbildungssystem in Deutschland, die Herausforderungen für Schulabgänger und die besonderen Schwierigkeiten, denen Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle begegnen.
Der zweite Teil analysiert die Selektion von Auszubildenden durch die Betriebe und fokussiert auf die Rolle von sprachlichen und kulturellen Faktoren, sowie schulischer Kompetenz bei der Beurteilung von Bewerbern. Es werden die Herausforderungen aufgezeigt, die sich aus den unterschiedlichen Erwartungen von Migranten und Unternehmen ergeben.
Der dritte Teil der Arbeit untersucht die strukturellen Folgen der geringen Ausbildungschancen für jugendliche Migranten. Hier werden die Auswirkungen auf die Integration und den beruflichen Werdegang von Migranten beleuchtet. Der Text beleuchtet zudem die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, insbesondere auf die Chancen für eine gelungene Integration.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern Integration, Ausbildungschancen, Migranten, duales Ausbildungssystem, Chancengleichheit, Diskriminierung, sprachliche Kompetenz, kulturelle Faktoren, schulische Kompetenz, Integration von Familien, strukturelle Folgen, Berufsbildung, Bildungspolitik und die deutsche Gesellschaft. Die Arbeit bezieht sich dabei auf aktuelle Statistiken, Studien und Forschungsergebnisse zu den Themen Migration, Integration und Ausbildung in Deutschland. Ein wichtiger Bezugspunkt ist das BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung), dessen Studien zur Integration von Migranten wichtige Einblicke in die Problematik liefern.
- Quote paper
- Lars Lorbeer (Author), 2009, Ausbildungschancen für jugendliche Migranten in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142741