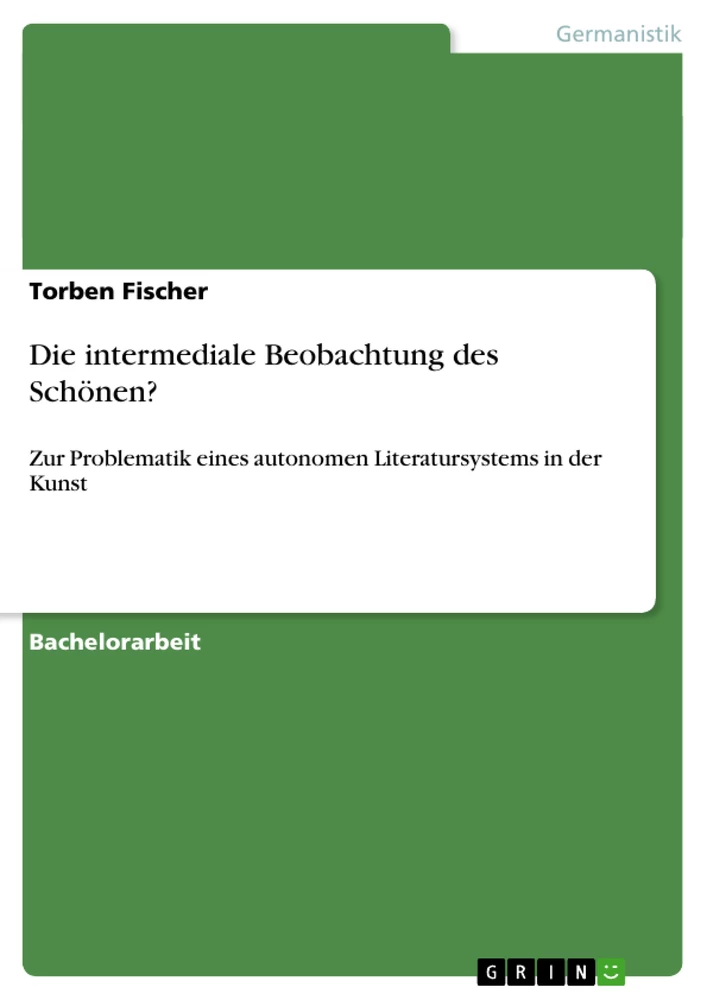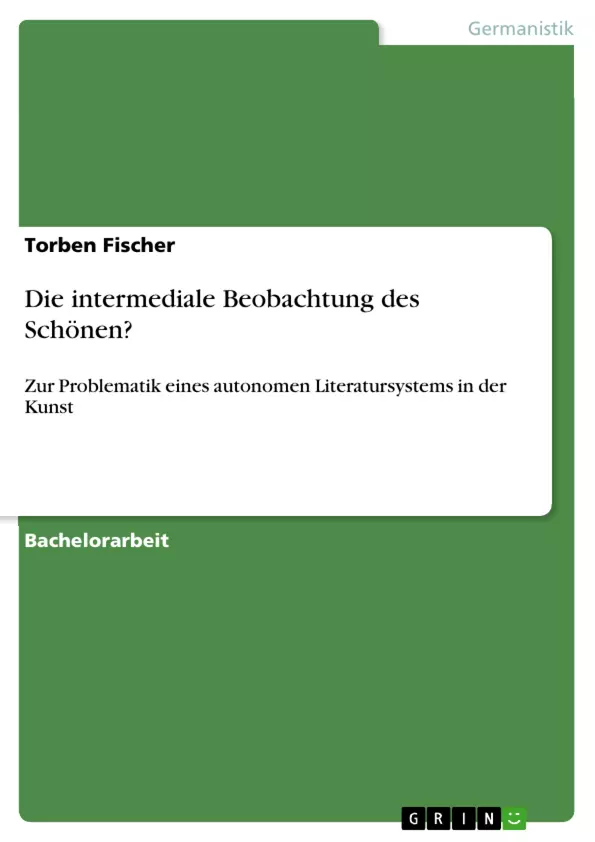Als sogenannte „Supertheorie“ hat die Systemtheorie Niklas Luhmanns wie kaum eine andere soziologische Theorie die Geistes- und Sozialwissenschaften der letzten 30 Jahre geprägt. Auch die Literaturwissenschaft hat seit Anfang der 1980er Jahre mit einiger Anstrengung versucht, sich dem Phänomen der Literatur auf systemtheoretischem Wege zu nähern – mit mäßigem Erfolg. So konstatierte Oliver Sill im Jahr 2001, dass die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung im Zeichen der Systemtheorie knapp zwei Jahrzehnte später „kaum über das Anfangsstadium hinaus gelangt war“ und „im Dschungel systemtheoretischer Konzepte“ den eigenen Gegenstandstandsbereich, nämlich „Literatur bzw. literarisches Handeln“ aus den Augen zu verlieren drohte. An dieser Feststellung hat sich bis zum heutigen Tage nicht viel geändert. Trotz zahlreicher Beiträge, Sammelbände (u. a. Schmidt 1993, de Berg/Prangel 1997, Fohrmann/Müller 1996) und diverser theoretischer Ausdifferenzierungen hat die systemtheoretische Literaturwissenschaft in den letzten Jahren stark an Attraktivität und Relevanz eingebüßt. Dies liegt nicht zuletzt an dem hohen Abstraktionsmoment der Theorie sozialer Systeme, die eine Applizierbarkeit systemtheoretischen Denkens auf literarische Texte als Form kommunikativen Handelns nicht ohne Schwierigkeiten zulässt. Die einstige Hoffnung systemtheoretischer Literaturwissenschaftler, mit der Systemtheorie ein Konzept vorzufinden, welches die Auflösung der Literaturwissenschaft in eine allgemeine Kulturtheorie aufzuhalten vermag und ein Begriffs-Setting bereitstellt, das es einerseits ermöglicht, universell die Möglichkeitsbedingungen für Literatur zu definieren und andererseits spezifisch genug ist, um Literatur und literarische Texte integrierend einzubinden, scheint begraben. Allein die kontrovers geführte Diskussion um eine adäquate Codierung und eine schlüssige funktionale Analyse des Literatursystems zeigt, dass in der systemtheoretisch orientierten Forschung bis heute nur eines sicher ist: „dass nichts sicher ist“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die (erfolglose) Suche nach dem Literatursystem.
- 2. Systemtheoretische Grundlagen....
- 3. Literatur als soziales System?
- 3.1. Die Ausgangslage: Luhmanns Ausführungen zur Kunst..
- 3.2. Symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium
- 3.3. Binäre Codierung.
- 3.4. Funktion und Leistung
- 3.5. Zwischenfazit: Literatur als intermedialer Bestandteil des Kunstsystems?
- 4. Literatur als Vollzug des symbolisch generalisierten Kommunikations-mediums „Kunstwerk“ im Mehrebenenmodell des Kunstsystems.
- 4.1. Literatur als intermedialer Bestandteil des Kunstsystems.
- 4.2. Exkurs: Goethes „Werther“ als literarische Spezialkommunikation im Kunstsystem
- 5. Schlussbetrachtung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit nimmt sich zum Ziel, die Frage nach dem Systemcharakter von Literatur neu zu stellen und zu untersuchen, ob Literatur tatsächlich als autopoietisches Sozialsystem mit eigener Funktionalität und binärer Codierung bezeichnet werden kann. Sie analysiert die systemtheoretischen Grundlagen von Niklas Luhmann und setzt diese in Bezug zu den bisherigen Forschungsansätzen der systemtheoretischen Literaturwissenschaft.
- Die Eignung der Systemtheorie für die Analyse von Literatur
- Die Frage nach der funktionellen Autonomie der Literatur
- Die Identifizierung einer binären Codierung für das Literatursystem
- Die Rolle von Literatur im Kunstsystem und die Medium/Form-Beziehung
- Die Relevanz von textimmanenten Analysen in der systemtheoretischen Literaturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Literatursystems im Rahmen der Systemtheorie dar und führt in die Forschungsfrage ein. Kapitel 2 skizziert die systemtheoretischen Grundlagen, während Kapitel 3 die Frage nach der literarischen Autonomie im Kunstsystem untersucht. Kapitel 4 fokussiert auf Literatur als Vollzug des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums „Kunstwerk“ und analysiert Goethes „Werther“ als Beispiel für literarische Spezialkommunikation. Die Schlussbetrachtung zieht ein Resümee und diskutiert die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse für die systemtheoretische Literaturwissenschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen der Systemtheorie, insbesondere mit den Konzepten der Autopoiesis, der funktionellen Autonomie und der binären Codierung. Sie untersucht die Anwendung dieser Konzepte auf die Literatur und ihre Positionierung im Kunstsystem. Darüber hinaus werden die Medium/Form-Beziehung, die textimmanente Analyse und die intermediale Beobachtung als zentrale Themen aufgegriffen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Literatursystem in Niklas Luhmanns Systemtheorie?
Die Arbeit untersucht, ob Literatur als autopoietisches Teilsystem des Kunstsystems betrachtet werden kann, das durch eigene Funktionen und Codierungen definiert ist.
Wie lautet die binäre Codierung der Kunst laut Luhmann?
Die klassische Codierung in der Kunsttheorie wird oft als „schön/hässlich“ diskutiert, wobei die Systemtheorie dies funktionaler als Passung oder Nicht-Passung im Medium betrachtet.
Warum ist die systemtheoretische Literaturwissenschaft schwierig anzuwenden?
Dies liegt am hohen Abstraktionsgrad der Theorie, der eine direkte Übertragung auf konkrete literarische Texte oft erschwert.
Welche Rolle spielt Goethes „Werther“ in dieser Analyse?
Der „Werther“ wird als Beispiel für literarische Spezialkommunikation innerhalb des Kunstsystems analysiert, um die Theorie praktisch zu prüfen.
Was bedeutet „intermediale Beobachtung“?
Es beschreibt die Analyse von Literatur als Bestandteil eines größeren Kunstsystems, das verschiedene Medien (Text, Bild, Musik) übergreifend beobachtet.
- Arbeit zitieren
- Torben Fischer (Autor:in), 2009, Die intermediale Beobachtung des Schönen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142884