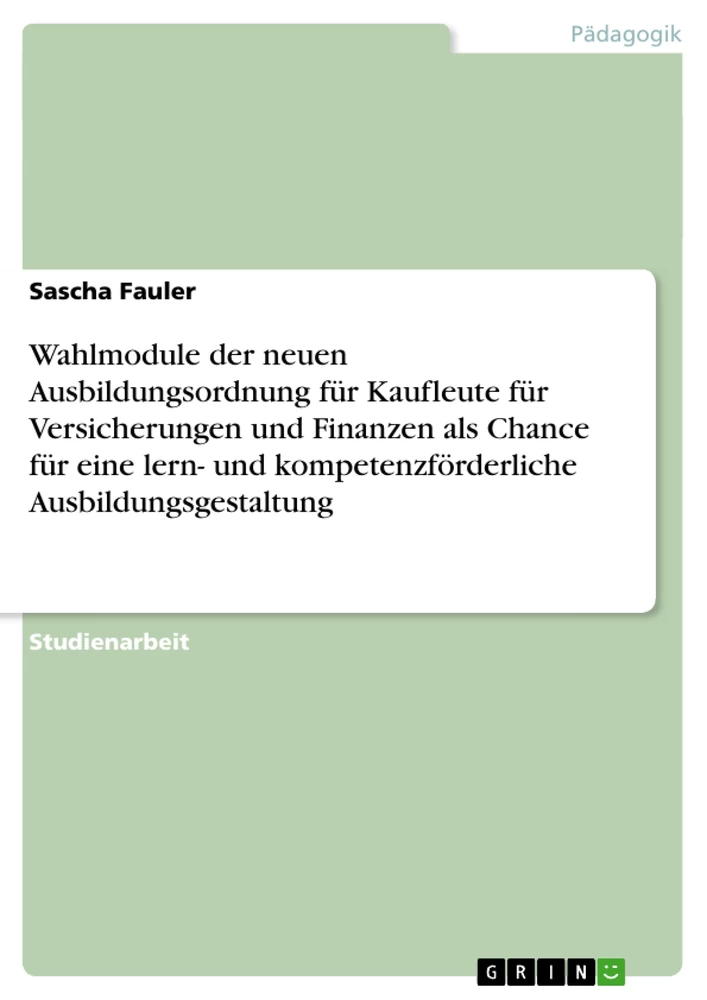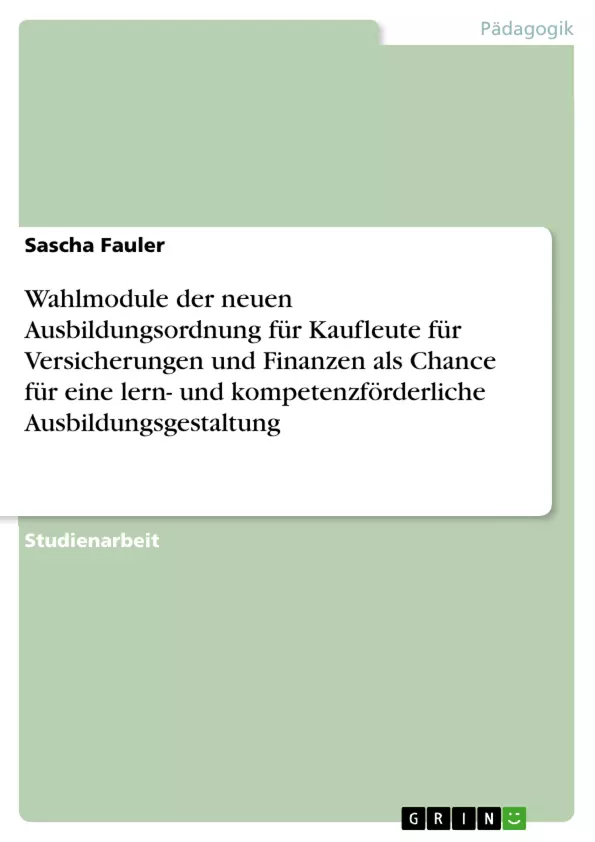Am 1. August 2006 trat die neue Ausbildungsordnung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen in Kraft. Hierdurch wurden Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme der bisherigen Ausbildung sowie der Früherkennung des künftigen Qualifikationsbedarfs,
die durch die Zukunftswerkstatt Versicherungen des BWV, einer KWB-Studie als auch einer BIBB-Evaluation erhoben wurden, umgesetzt.
Noch als sich die neue AO im Beschlussverfahren befand, wurden schon negative Szenarien für die Berufsausbildung in der Versicherungswirtschaft ausgemalt. Viele sprachen als Folge der neuen AO davon, dass einige Ausbildende der Versicherungswirtschaft dadurch nicht mehr ausbildungsfähig blieben. Andere behaupteten, es handele sich lediglich um ‚alten Wein in neuen Schläuchen’. Derartige und andere Prophezeiungen
trugen unter den Ausbildern zu einer gewissen Verunsicherung bei. Chancen, die diese neue AO hinsichtlich lern- und kompetenzförderlicher Ausbildungsgestaltung bietet, wurde von Seiten der Verantwortlich kommuniziert, was aber insgesamt auf
taube Ohren zu stoßen schien. Ob nun diese Chancen, knapp drei Jahre nach Inkrafttreten der neuen AO, dennoch ergriffen
wurden bzw. welchen Einfluss sie de facto auf eine lern- und kompetenzförderliche Ausbildungsgestaltung haben, gilt es in dieser Arbeit zu untersuchen. Dabei soll aus Rücksicht auf den Umfang dieser Arbeit der Fokus auf die Ausbildungsmethoden
bzw. Lernformen gerichtet werden. Dafür wird zunächst der Begriff der Ausbildung näher beleuchtet sowie Möglichkeiten zur lern- und kompetenzförderlichen Ausbildungsgestaltung vorgestellt und anschließend ein Abgleich zwischen alten und neuen Rahmenbedingungen auf Basis der Ausbildungsordnungen
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (neu) und Versicherungskaufmann/-frau (alt) aufgezeigt. Danach widmet sich diese Arbeit den Effekten, die die Wahlmodule auf die Ausbildungsgestaltung und die Rolle des Ausbilders haben. Insbesondere für diesen Teil wurde eine kleine, selbst entwickelte empirische Befragung durchgeführt. Letztlich bietet die Schlussbetrachtung eine Zusammenfassung im Hinblick auf das Ziel der zugrunde liegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung mit Problemstellung
- Grundlagen der Untersuchung
- Berufsausbildung im System der Betrieblichen Bildungsarbeit
- Lern- und kompetenzförderliche Ausbildungsgestaltung
- Änderung der Ausbildungsbedingungen durch die Wahlmodule
- Effekte der Wahlmodule
- Chancen einer lern- und kompetenzförderlichen Ausbildungsgestaltung
- Auswirkungen auf die Rolle des Ausbilders
- Änderungen in der Empirie
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wahlmodule der neuen Ausbildungsordnung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen mit der Fachrichtung Versicherung im Hinblick auf ihre Eignung für eine lern- und kompetenzförderliche Ausbildungsgestaltung.
- Die Rolle der Wahlmodule in der Ausbildungsordnung
- Die Auswirkungen der Wahlmodule auf die Lern- und Kompetenzförderung
- Die Chancen und Herausforderungen einer lern- und kompetenzförderlichen Ausbildungsgestaltung
- Die Rolle des Ausbilders im Kontext der Wahlmodule
- Empirische Befunde zur Umsetzung der Wahlmodule in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung mit Problemstellung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Wahlmodule für die Ausbildung von Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen. Die Problemstellung der Arbeit wird hier dargelegt.
- Grundlagen der Untersuchung: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung, wie die Bedeutung von Berufsausbildung im System der Betrieblichen Bildungsarbeit, die Prinzipien einer lern- und kompetenzförderlichen Ausbildungsgestaltung sowie die Auswirkungen der Wahlmodule auf die Ausbildungsbedingungen.
- Effekte der Wahlmodule: Dieses Kapitel analysiert die Effekte der Wahlmodule auf die Ausbildungsgestaltung. Es werden Chancen einer lern- und kompetenzförderlichen Ausbildungsgestaltung, Auswirkungen auf die Rolle des Ausbilders und empirische Befunde zur Umsetzung der Wahlmodule in der Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Berufsausbildung, Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Wahlmodule, Lern- und Kompetenzförderung, Ausbildungsgestaltung, Ausbilderrolle, Empirie, Betriebliche Bildungsarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte sich 2006 in der Ausbildung für Versicherungen und Finanzen?
Mit der neuen Ausbildungsordnung wurde das Berufsbild modernisiert, um künftigen Qualifikationsbedarfen gerecht zu werden. Ein Kernelement war die Einführung von Wahlmodulen zur Spezialisierung.
Welchen Zweck haben die Wahlmodule?
Wahlmodule ermöglichen es Auszubildenden und Betrieben, Schwerpunkte zu setzen (z. B. Vertrieb oder Innendienst). Dies fördert eine praxisnahe und kompetenzorientierte Ausbildung.
Wie fördern die Wahlmodule die Kompetenzentwicklung?
Sie verlangen eigenständigeres Lernen und ermöglichen eine tiefere Auseinandersetzung mit spezifischen Fachgebieten, was die Handlungskompetenz der angehenden Kaufleute stärkt.
Welche Rolle hat der Ausbilder unter der neuen Ordnung?
Der Ausbilder wandelt sich stärker zum Lernbegleiter und Coach, der die Auszubildenden bei der Bearbeitung der komplexeren Wahlmodule unterstützt und Lernprozesse moderiert.
Gab es Kritik an der neuen Ausbildungsordnung?
Anfangs gab es Befürchtungen, dass kleinere Betriebe durch die Komplexität der neuen Struktur nicht mehr ausbildungsfähig seien oder es sich nur um "alten Wein in neuen Schläuchen" handele.
- Quote paper
- Sascha Fauler (Author), 2009, Wahlmodule der neuen Ausbildungsordnung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen als Chance für eine lern- und kompetenzförderliche Ausbildungsgestaltung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142891