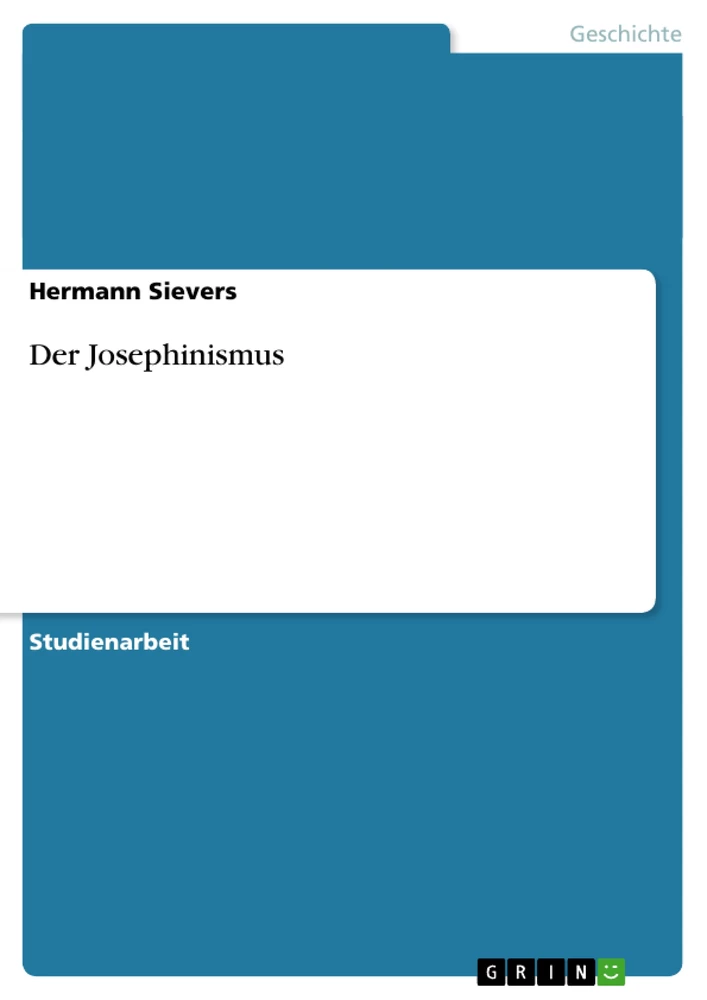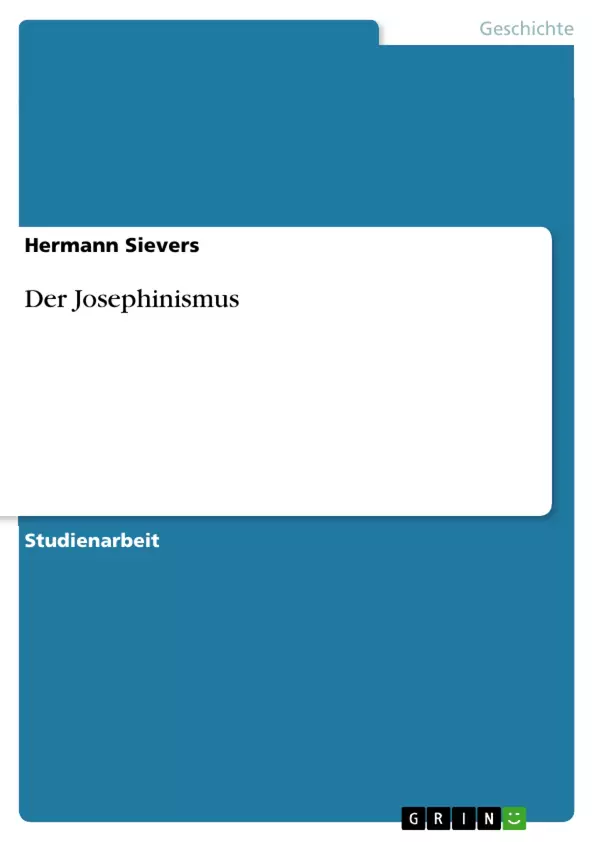Als die drei herausragenden Beispiele des Aufgeklärten Absolutismus gelten im Allgemeinen das Preußen Friedrich II., das Russland Katharinas II. und die Habsburgermonarchie Joseph II. Während die beiden erstgenannten Monarchen nahezu einmütig mit dem Epitheton der oder die „Große“ versehen worden sind, blieb diese Ehre dem Habsburger verwehrt. Der Grund hierfür ist wohl eher in dem relativen Versagen Josephs auf militärischem Gebiet zu suchen, als in irgendeinem anderen Aspekt seiner Herrschaft. Jedoch gibt es auch in seinem Fall etwas, das auf von ihm erbrachte außergewöhnliche Leistungen, ob man sie nun positiv oder negativ bewertet, hinweist und somit auch ihm eine Hervorhebung seiner Person innerhalb der Geschichte sichert. Sein Name ist Ursprung des Begriffs ‘Josephinismus’ und seine Person eng verbunden mit diesem Phänomen. Auf die Frage, was der Josephinismus sei, gibt es keine eindeutige Antwort. Die vorliegenden Deutungen sind in ihrem Ansatz bisweilen sehr verschieden. "Weder die Bestrebungen, den ‘Josephinismus’ mit dem österreichischen Staatskirchentum des 18. Jahrhunderts oder mit dem inneren Aufbruch zu einer katholischen Reform, einem ‘Reformkatholizismus’, zu identifizieren, noch die Ansicht, der ‘Josephinismus’ sei eine kultur- wie geistesgeschichtliche Bewegung, die eine Weltanschauung bewirkte, konnten sich in ihrer Einseitigkeit durchsetzen."
Abgesehen von den unterschiedlichen Ansichten, bleibt es dennoch eine Tatsache, dass man bei einer Untersuchung des Aufgeklärten Absolutismus österreichischer Art unweigerlich auf das Phänomen des Josephinismus stößt.
Die leitende Fragestellung dieser Arbeit lautet:
Kann der Josephinismus mit dem Aufgeklärten Absolutismus (bezüglich Österreichs) gleichgesetzt werden?
Ich werde im ersten Abschnitt meiner Arbeit auf die Entstehung des Begriffes ‘Josephinismus’ eingehen. Der zweite Abschnitt soll einen kleinen Überblick über die Deutungen des Josephinismus im 20. Jahrhundert geben, die von verschiedenen Historikern vorgenommen worden sind. Im Folgenden wird mit Hilfe dieser Deutungen eine Festlegung des gegenwärtigen Begriffes ‘Josephinismus’ anvisiert. Der dritte Abschnitt gibt einen Überblick über die Reformen der theresianisch-josephinischen Epoche unter besonderer Hervorhebung der kirchenpolitischen Maßnahmen. Auf Wirkunken des Josephinismus werde ich im vierten Abschnitt eingehen. Letztlich werde ich im Schlussteil meiner Arbeit mich ausschließlich der Beantwortung der Hauptfrage zuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Der Josephinismus in ursprünglicher Bedeutung
- 2.2 Josephinismus aus gegenwärtiger Perspektive
- 2.3 Reformen des Josephinismus
- 2.4 Reaktion auf die Reformen des Josephinismus
- 3. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff "Josephinismus" und seine Bedeutung im Kontext des aufgeklärten Absolutismus in Österreich. Sie beleuchtet die Entstehung des Begriffs, seine unterschiedlichen Interpretationen im Laufe der Geschichte und die Reformen der josephinischen Epoche. Die zentrale Frage lautet: Kann der Josephinismus mit dem aufgeklärten Absolutismus (bezüglich Österreich) gleichgesetzt werden?
- Entstehung und ursprüngliche Bedeutung des Begriffs "Josephinismus"
- Entwicklung und unterschiedliche Interpretationen des Josephinismus im 20. Jahrhundert
- Reformen der theresianisch-josephinischen Epoche, insbesondere im kirchenpolitischen Bereich
- Wirkungen des Josephinismus
- Zusammenhang zwischen Josephinismus und aufgeklärtem Absolutismus in Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Gleichsetzung von Josephinismus und aufgeklärtem Absolutismus in Österreich. Sie betont die relative Unbekanntheit des Begriffs Josephinismus und seine unterschiedlichen Interpretationen. Der Autor skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die einzelnen Kapitel mit ihren jeweiligen Schwerpunkten an. Die Einleitung etabliert den Kontext der Arbeit innerhalb eines Seminars zum Thema "Der Absolutismus" und verdeutlicht die Notwendigkeit, den Begriff Josephinismus zu definieren, um die zentrale Forschungsfrage beantworten zu können. Sie betont den umstrittenen Charakter der Bezeichnung "Aufgeklärter Absolutismus" für die theresianisch-josephinische Epoche.
2.1 Der Josephinismus in ursprünglicher Bedeutung: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung des Begriffs "Josephinismus". Es wird aufgezeigt, dass der Begriff erst in den 1830er Jahren, lange nach Joseph II.s Tod, geprägt wurde und ursprünglich in einem pejorativen Kontext verwendet wurde, hauptsächlich von der klerikalen Partei. Im Gegensatz dazu wird der Gebrauch des Adjektivs "josephinisch" bereits während der Regierungszeit Josephs II. belegt, jedoch ohne die spätere ideologische Konnotation. Das Kapitel beleuchtet die späte Entstehung des Substantivs und die anfänglich negative Konnotation, die im Gegensatz zur heutigen neutraleren Verwendung steht. Der Autor kritisiert die unzureichende Auseinandersetzung mit dem Ursprung des Begriffs in der historischen Forschung.
2.2 Josephinismus aus gegenwärtiger Perspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Interpretationen des Begriffs "Josephinismus" im 20. Jahrhundert. Es wird deutlich, dass im Gegensatz zur ursprünglichen, negativ konnotierten Verwendung, der Begriff heute neutraler interpretiert wird. Das Kapitel zitiert Helmut Reinalter, der den Josephinismus als spezifisch österreichische Form einer allgemeinen gesellschaftlichen, politischen und kulturell-geistigen Bewegung des 18. Jahrhunderts beschreibt. Diese Zusammenfassung unterstreicht den Wandel in der Interpretation des Begriffs und hebt die Notwendigkeit einer präzisen Definition hervor, um ihn im Kontext des aufgeklärten Absolutismus zu verstehen. Die unterschiedlichen Perspektiven werden als Ausgangspunkt für eine differenzierte Analyse des Phänomens Josephinismus präsentiert.
Schlüsselwörter
Josephinismus, Aufgeklärter Absolutismus, Österreich, Reformen, Kirchenpolitik, 18. Jahrhundert, Historische Interpretation, Begriffsentwicklung, Theresianisch-josephinische Epoche.
Häufig gestellte Fragen zum Text über den Josephinismus
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Josephinismus. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text untersucht den Begriff "Josephinismus", seine Entstehung, seine verschiedenen Interpretationen im Laufe der Geschichte und seine Bedeutung im Kontext des aufgeklärten Absolutismus in Österreich. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann der Josephinismus mit dem aufgeklärten Absolutismus (bezüglich Österreich) gleichgesetzt werden?
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind die Entstehung und ursprüngliche Bedeutung des Begriffs "Josephinismus", seine Entwicklung und unterschiedlichen Interpretationen im 20. Jahrhundert, die Reformen der theresianisch-josephinischen Epoche (insbesondere im kirchenpolitischen Bereich), die Wirkungen des Josephinismus und der Zusammenhang zwischen Josephinismus und aufgeklärtem Absolutismus in Österreich.
Wie wird der Begriff "Josephinismus" im Text definiert und interpretiert?
Der Text beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs "Josephinismus". Er zeigt, dass der Begriff erst lange nach Joseph II.s Tod geprägt wurde und ursprünglich pejorativ von der klerikalen Partei verwendet wurde. Im 20. Jahrhundert wird er neutraler interpretiert. Der Text betont die Notwendigkeit einer präzisen Definition, um den Josephinismus im Kontext des aufgeklärten Absolutismus zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu der ursprünglichen Bedeutung des Josephinismus, seiner gegenwärtigen Perspektive, seinen Reformen und der Reaktion darauf) und einen Schlussteil. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau vor. Kapitel 2.1 untersucht den Ursprung des Begriffs, Kapitel 2.2 seine heutige Interpretation und die folgenden Unterkapitel die Reformen und deren Folgen. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen (obwohl der Inhalt des Schlussteils im vorliegenden Text nicht detailliert beschrieben ist).
Welche Rolle spielt der aufgeklärte Absolutismus im Text?
Der aufgeklärte Absolutismus bildet den zentralen Kontext für die Untersuchung des Josephinismus. Der Text untersucht den Zusammenhang zwischen beiden und stellt die Frage nach ihrer Gleichsetzung in Österreich. Der umstrittene Charakter der Bezeichnung "Aufgeklärter Absolutismus" für die theresianisch-josephinische Epoche wird ebenfalls thematisiert.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text nennt explizit Helmut Reinalter als Quelle für die Interpretation des Josephinismus im 20. Jahrhundert. Weitere Quellen werden nicht direkt benannt, aber der Text verweist auf die historische Forschung und deren unzureichende Auseinandersetzung mit dem Ursprung des Begriffs.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist aufgrund seines akademischen Aufbaus und der detaillierten Auseinandersetzung mit dem Thema wahrscheinlich für Studenten, Wissenschaftler und alle Interessierten gedacht, die sich eingehender mit dem Josephinismus und dem aufgeklärten Absolutismus in Österreich auseinandersetzen möchten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die Schlüsselwörter sind Josephinismus, Aufgeklärter Absolutismus, Österreich, Reformen, Kirchenpolitik, 18. Jahrhundert, Historische Interpretation, Begriffsentwicklung, Theresianisch-josephinische Epoche.
- Citation du texte
- Hermann Sievers (Auteur), 2006, Der Josephinismus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143015