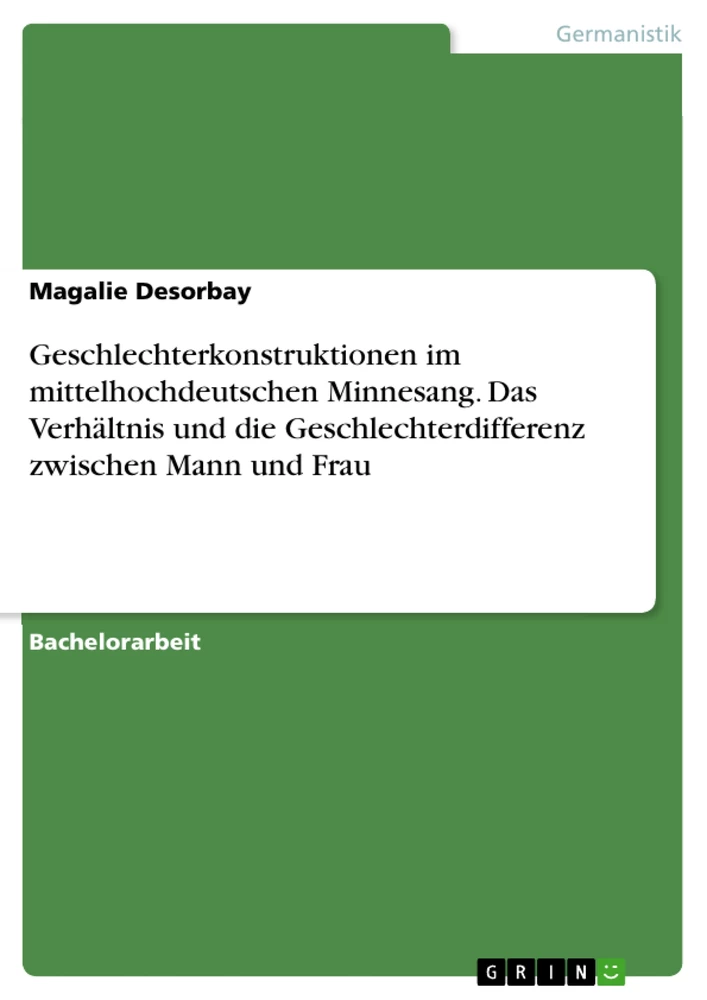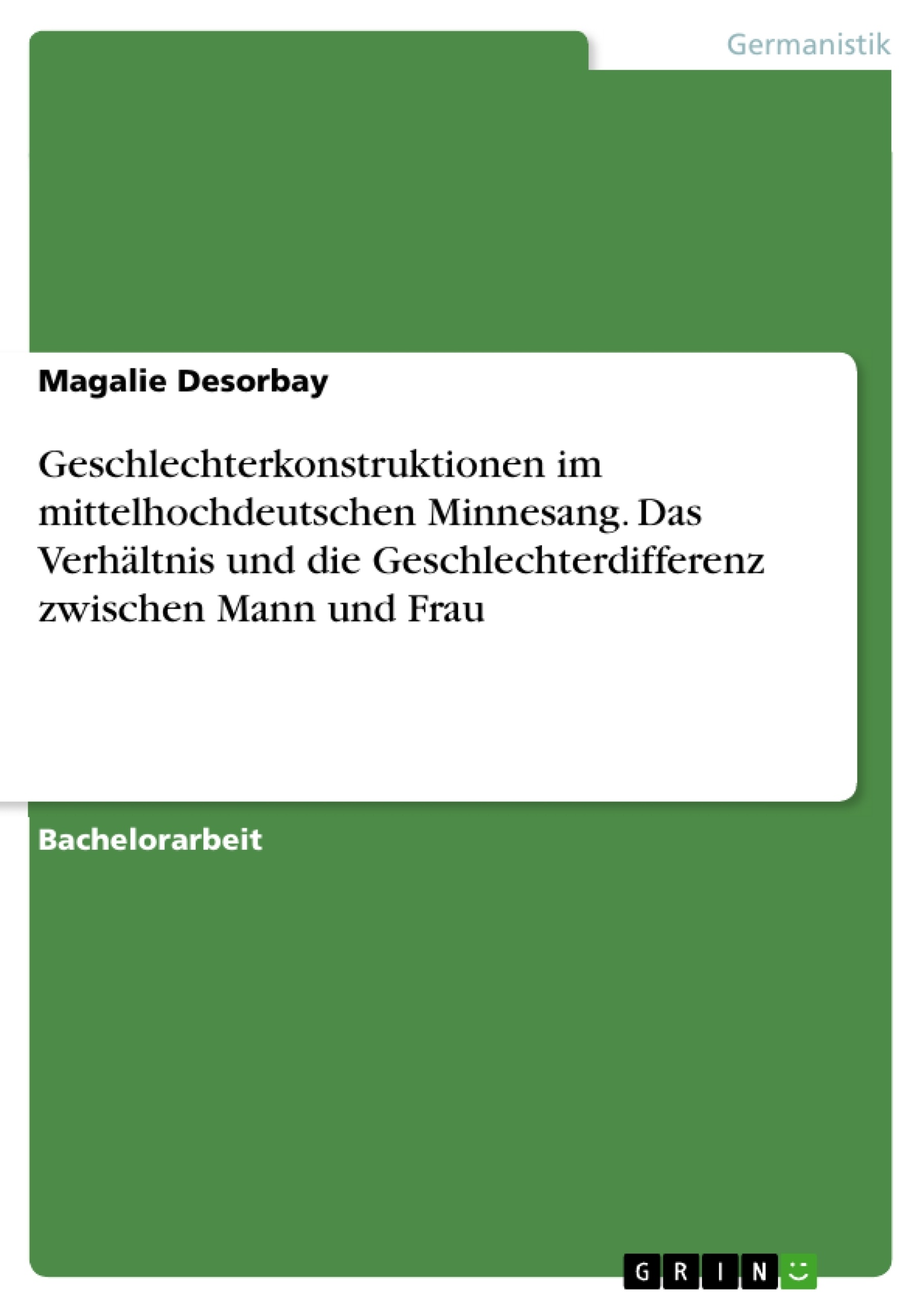Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Sozialhistorie und der Literatur des Mittelalters. Die Mediävistik bezeichnet die "Lehre vom Mittelalter" (lateinisch medium aevum "mittleres Zeitalter"). Unter dem Begriff Mittelalter versteht man die Zeitspanne zwischen der Antike und der Neuzeit, die sich von 500 bis 1500 erstreckte. Das Mittelalter übte in der Folge eine große Faszination auf die Menschen aus und wird somit auch heute noch, zum Beispiel in Filmen, in das alltägliche Leben integriert. Allerdings war es auch eine düstere Zeit, in der viele Kriege das Land verwüsteten, was die Dichter in ihren Werken jedoch ausklammerten um sich ausdrücklich auf die Moral und das gesellschaftliche Miteinander zu konzentrieren. Somit haben die Dichter in einer "[...] Epoche des Abstiegs und des Verfalls [...]" ihre Werke in eine idealisierte Vergangenheit kontextualisiert.
Als wichtige Überlieferungen gelten deutsche literarische Texte, zu denen "[...] hochfiktionale Texte, wie Minnelieder und höfische Epen, [...] lehrhafte Dichtungen, politische Spruchdichtung, Reimchroniken und ähnliche Werke, die direkt auf außerliterarische Wirklichkeit Bezug nehmen", gehören. Bildliche Darstellungen, zum Beispiel in Form von Handschriftenminiaturen, zählen ebenso zu den wichtigen Überlieferungen. Klöster und Adelshöfe dienten als Überlieferungsorte und Produktionsstätte. Die Dichter erreichten ihr höfisches Publikum in Festsälen am Hof. Beim Minnesang handelte es sich um eine Vortragskunst, wobei man allerdings zwischen dem gesungenen mündlichen Vortrag und der Tradierung der Texte unterscheiden muss.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen das Verhältnis und die Geschlechterdifferenz zwischen Mann und Frau im mhd. Minnesang. Die Arbeit ist in drei große Teile eingeteilt. Der erste Teil beinhaltet Einführungen in den Minnesang und die Gender Studies. Der zweite Teil geht auf die Sozialhistorie des Mittelalters ein und arbeitet die Differenzen zwischen Männern und Frauen im Mittelalter heraus. Den eigentlichen Hauptteil bildet der Punkt über die Positionierung der Geschlechter im mhd. Minnesang, wobei es um das asymmetrische Geschlechterverhältnis in der Rollenlyrik und die beiden Konzepte der Hohen und der Niederen Minne geht. Hierbei werden auch einige Texte von bedeutenden Vertretern der verschiedenen Richtungen näher betrachtet. Ein Fazit und eine Liste der verwendeten Literatur schließen die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung in den Minnesang
- 2.1 Phasen des Minnesangs
- 2.1.1 Donauländischer Minnesang
- 2.1.2 Rheinischer Minnesang
- 2.1.3 Klassischer Minnesang
- 2.1.4 Später Minnesang
- 3. Gender Studies
- 4. Sozialhistorie des Mittelalters
- 4.1 Sexus und Gender
- 4.2 Die Bibel als Grundlage
- 4.3 Humoralpathologie
- 4.4 Weibliche und männliche Schönheit
- 4.5 Das Blickregime
- 5. Positionierung der Geschlechter im mhd. Minnesang
- 5.1 Hohe Minne
- 5.1.1 Der Mann als Minnediener
- 5.1.2 Die Idealisierung der Frau
- 5.1.3 Reinmar
- 5.1.4 Ich wirbe umb allez daz ein man (Reinmar von Hagenau)
- 5.2 Niedere Minne
- 5.2.1 Die Gleichberechtigung von Mann und Frau
- 5.2.2 Neidhart – Lyrik
- 5.2.3 Walther von der Vogelweide
- 5.2.4 Unter den Linden (Walther von der Vogelweide)
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung und die Rolle von Geschlechterkonstruktionen im mittelhochdeutschen Minnesang. Sie beleuchtet die soziale und historische Kontexte der Zeit, insbesondere die Geschlechterrollen und die Idealisierung der Frau in der höfischen Kultur. Die Arbeit analysiert auch die verschiedenen Arten der Minne und ihre Auswirkungen auf die Darstellung von Mann und Frau in der Literatur.
- Die Rolle von Geschlecht und Gender im mittelhochdeutschen Minnesang
- Die soziale und historische Kontexte der Geschlechterrollen im Mittelalter
- Die verschiedenen Arten der Minne und ihre Darstellung in der Literatur
- Die Idealisierung der Frau und die Position des Mannes im Minnesang
- Die Darstellung der Frau im Kontext der hohen und niederen Minne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Geschlechterkonstruktionen im mhd. Minnesang ein und gibt einen Überblick über die Forschungsmethodik und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 bietet eine Einführung in den Minnesang, seine Entwicklung und die wichtigsten Vertreter dieser Gattung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Relevanz der Gender Studies für die Analyse des Minnesangs. Kapitel 4 beleuchtet die Sozialhistorie des Mittelalters und die relevanten Aspekte wie Sexus und Gender, die Bibel als Grundlage, die Humoralpathologie, die weibliche und männliche Schönheit und das Blickregime.
Kapitel 5 stellt die Positionierung der Geschlechter im mhd. Minnesang in den Vordergrund. Hierbei wird die Hohe Minne mit ihrer Idealisierung der Frau und der Rolle des Mannes als Minnediener untersucht, sowie die Niedere Minne, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau thematisiert. Darüber hinaus werden wichtige Vertreter der verschiedenen Richtungen des Minnesangs, wie Reinmar von Hagenau und Walther von der Vogelweide, mit ihren Werken analysiert.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit widmet sich den Themen Geschlechterkonstruktionen, Minnesang, mittelhochdeutsche Literatur, Sozialhistorie des Mittelalters, Gender Studies, Hohe und Niedere Minne, Idealisierung der Frau, Rollenlyrik und wichtige Vertreter des Minnesangs wie Reinmar von Hagenau und Walther von der Vogelweide.
- Citar trabajo
- Magalie Desorbay (Autor), 2017, Geschlechterkonstruktionen im mittelhochdeutschen Minnesang. Das Verhältnis und die Geschlechterdifferenz zwischen Mann und Frau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1430214