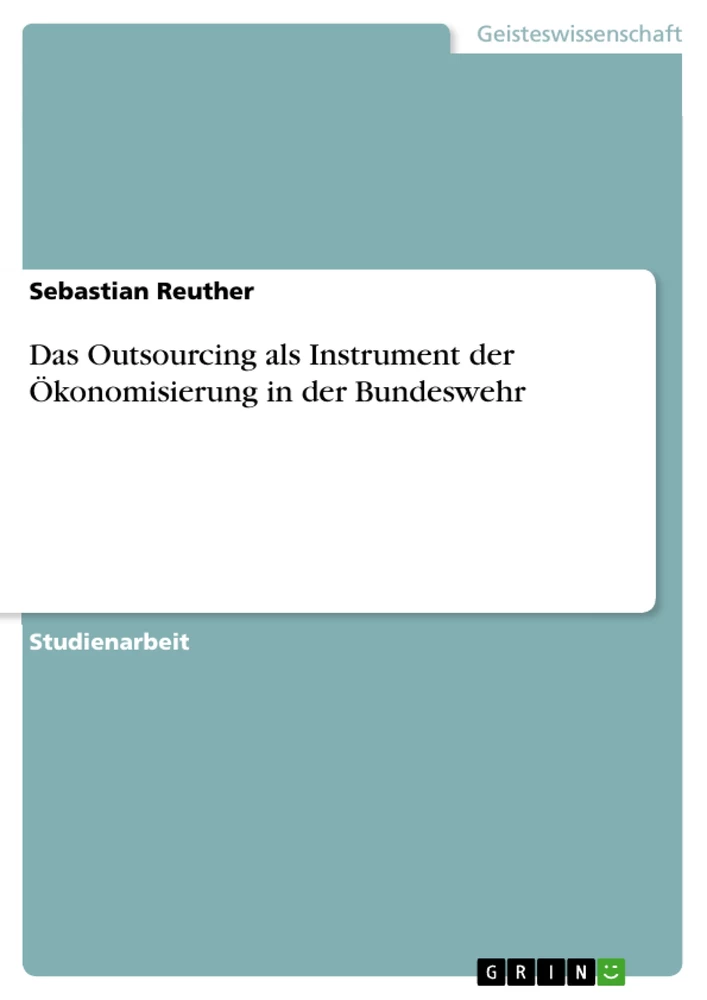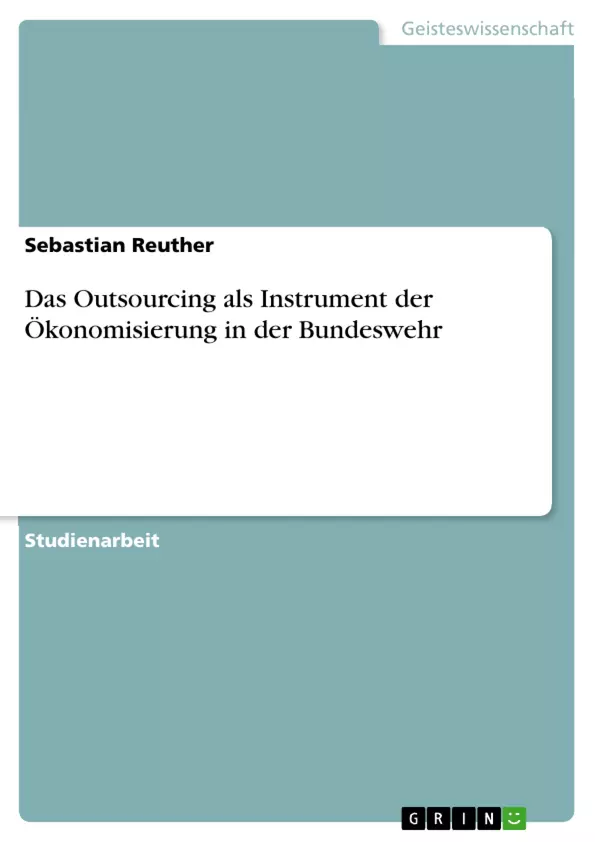In nahezu allen westlichen Ländern wurden nach dem Ende des Ost-West-Konflikts die Streitkräfte reduziert, so auch in der Bundesrepublik Deutschland. Dies führte die Bundeswehr auf dem Wege weg von einer reinen Verteidigungsarmee gemäß Artikel 87a GG, hin zu einer Interventionsarmee mit erweitertem Aufgabenspektrum. Die damit verbundenen höheren Ausgaben und ein stagnierender Verteidigungshaushalt, machten ab Mitte der 90er Jahre eine Neuausrichtung notwendig. Bis 2010 soll das gesamte militärische Personal 250.000 Soldaten und 75.000 zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen umfassen. (vgl. BmVg 2004: 39) Hier zeigt sich schon ein beachtlicher Stellenabbau, bestand bis 1992 allein das Heer aus 345 000 Soldaten. (vgl. Seliger 2006: 9)
Hinsichtlich der Privatisierungen wird davon ausgegangen, dass bis zu 40 Prozent des Verteidigungshaushaltes von jährlich ungefähr 25 Mrd. Euro auf privatisierungsfähige Bereiche, das heißt vor allem auf nicht-militärische Bereiche entfallen.
(vgl. Heintzen 2006: 26) Beispiele aus den Streitkräften anderer Länder, in denen schon seit längerem und in einem größeren Umfang Privatisierungen durchgeführt wurden und immer noch durchgeführt werden, zeigen wie sich das Auslagern von Teilbereichen aus dem Aufgabenfeld einer Armee positiv, in einigen Beispielen aber auch negativ auswirken kann. Besteht schon in der Diskrepanz, zwischen privatwirtschaftlichem Handeln (rentabilitätsorientiert) und klassischem Verwaltungshandeln staatlicher Einrichtungen (am öffentlichen Interesse ausgerichtet), Potential für Interessenkonflikte. Des Weiteren „droht zahlreichen Staaten angesichts des zunehmenden Engagements in internationalen Operationen und in Anbetracht der steigenden Komplexität der Kriegsführung eine Überdehnung ihrer militärischen Kapazitäten.“ (Clement 2005: 7) „Wir stellen die meisten Soldaten im Rahmen der NATO – Operation in Afghanistan. Die Bundeswehr nähert sich einem Grenzbereich an. Mehr geht nicht.“ (Jung 2006: 23) In Deutschland sind Privatisierungen im Bereich der „Staatsaufgabe Sicherheit“ außerhalb der Streitkräfte schon seit längerem anzutreffen, Personen- und Gepäckkontrollen an Flughäfen oder der Einsatz von Privaten Sicherheitsunternehmen zur Überwachung öffentlicher Räume (wie zur 2006 in Deutschland stattgefundenen Fußballweltmeisterschaft) können als Beispiele aus der Praxis genannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zusammenarbeit von Staat und freier Wirtschaft
- 2.1. Der Begriff des Outsourcing als Instrument der Betriebswirtschaft
- 2.2. Public-Private-Partnerships und ihre Formen
- 3. Verfassungsrechtlicher Rahmen
- 4. Umsetzung der Privatisierungsvorhaben
- 4.1. Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH
- 4.2. Liegenschaftsmanagment
- 4.3. LHBw und LHD
- 4.4. Bw Fuhrpark Service GmbH
- 5. Public-Private-Partnerships in den Streitkräften Großbritanniens
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Outsourcing als Instrument der Ökonomisierung in der Bundeswehr. Sie untersucht die Zusammenarbeit von Staat und freier Wirtschaft in diesem Kontext, insbesondere die Rolle von Public-Private-Partnerships (PPP).
- Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat und freier Wirtschaft
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Outsourcing im Verteidigungsbereich
- Die Umsetzung von Privatisierungsvorhaben in der Bundeswehr
- Der Vergleich mit dem Umgang mit Privatisierung in den Streitkräften Großbritanniens
- Die Auswirkungen des Outsourcings auf die Abhängigkeit der Bundeswehr von privaten Marktakteuren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Outsourcings in der Bundeswehr im Kontext der Verteidigungspolitik und der Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Bundeswehr vor. Kapitel 2 erläutert die Zusammenarbeit von Staat und freier Wirtschaft und definiert den Begriff des Outsourcings als Instrument der Betriebswirtschaft. Darüber hinaus werden verschiedene Formen von Public-Private-Partnerships (PPP) und die damit verbundenen Herausforderungen diskutiert. Kapitel 3 behandelt den verfassungsrechtlichen Rahmen für das Outsourcing im Verteidigungsbereich. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Umsetzung von Privatisierungsvorhaben in der Bundeswehr, wobei verschiedene Beispiele wie die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH oder das Liegenschaftsmanagement vorgestellt werden. Kapitel 5 vergleicht die Umstrukturierungen in den Streitkräften Großbritanniens mit den Entwicklungen in der Bundeswehr.
Schlüsselwörter
Outsourcing, Ökonomisierung, Bundeswehr, Public-Private-Partnerships, Privatisierung, Verteidigungshaushalt, Staatsaufgaben, Verfassungsrecht, Streitkräfte Großbritanniens, Abhängigkeit von privaten Marktakteuren.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Outsourcing im Kontext der Bundeswehr?
Es beschreibt die Auslagerung nicht-militärischer Aufgaben (wie Fuhrpark oder Bekleidung) an private Unternehmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.
Welche Rolle spielen Public-Private-Partnerships (PPP)?
PPP-Modelle wie die Bw Fuhrpark Service GmbH sind Kooperationen zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft zur Erbringung öffentlicher Leistungen.
Warum wurde die Bundeswehr ab Mitte der 90er Jahre ökonomisiert?
Sinkende Verteidigungshaushalte bei gleichzeitig steigenden Kosten für Auslandseinsätze machten eine effizientere Mittelverwendung notwendig.
Welche verfassungsrechtlichen Grenzen gibt es beim Outsourcing?
Die Arbeit untersucht, inwieweit hoheitliche Aufgaben der Sicherheit privatisiert werden dürfen, ohne Artikel 87a des Grundgesetzes zu verletzen.
Welche Risiken birgt die Privatisierung militärischer Bereiche?
Ein Hauptrisiko ist die wachsende Abhängigkeit der Streitkräfte von privaten Marktakteuren und potenzielle Interessenkonflikte zwischen Rentabilität und Gemeinwohl.
- Citar trabajo
- Sebastian Reuther (Autor), 2006, Das Outsourcing als Instrument der Ökonomisierung in der Bundeswehr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143038