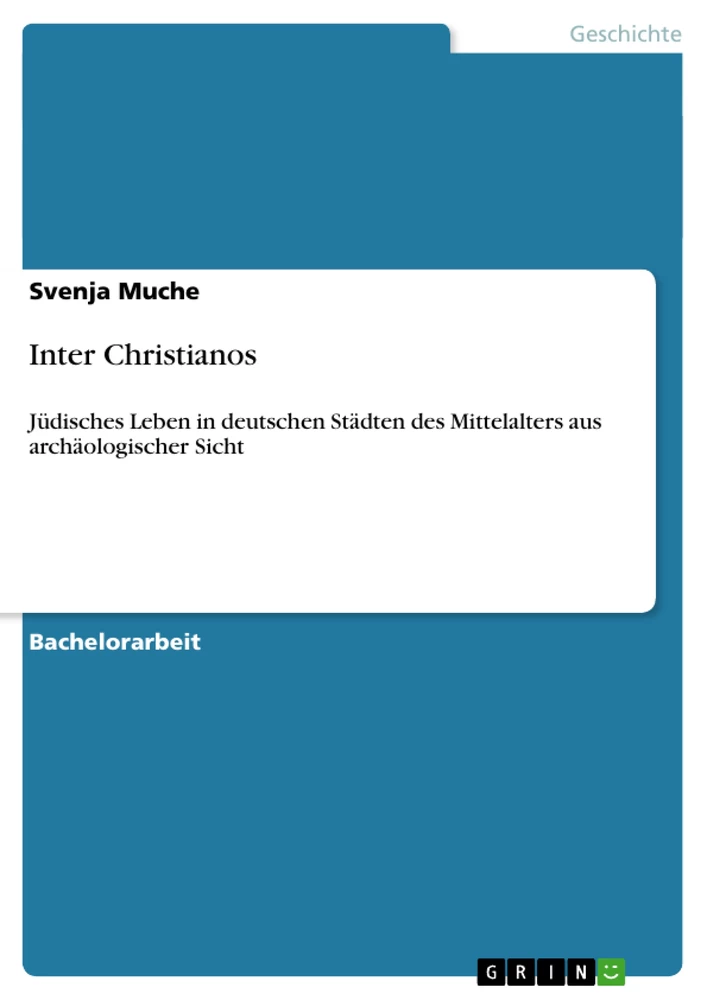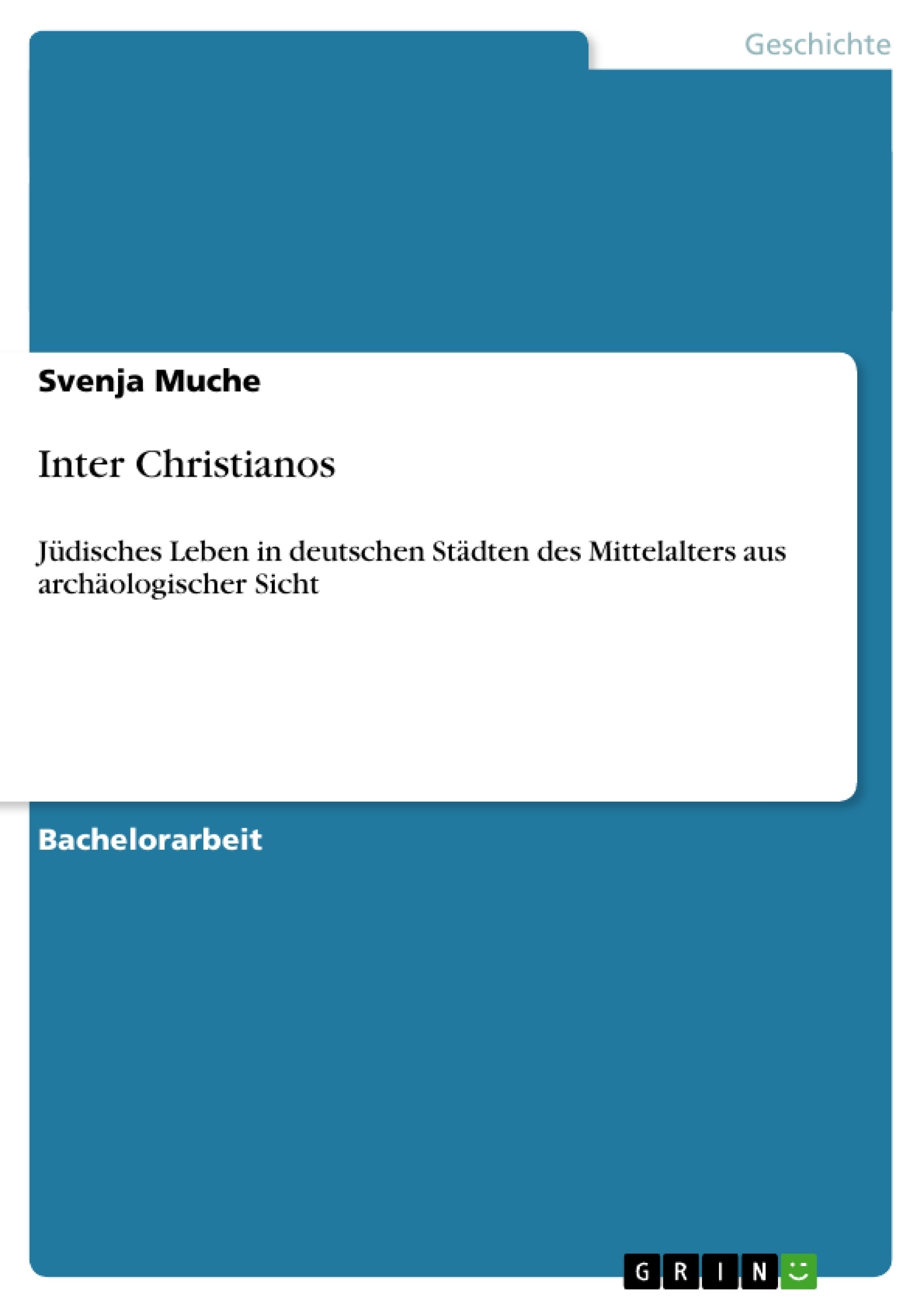In seiner Einleitung zu den Beiträgen des internationalen Symposium in Speyer zu Europas Juden im Mittelalter bemerkt Alfred Haverkamp, dass die Kultur der Juden in Europa während des Mittelalters nicht weniger europäisch sei als jüdisch. Diese Aussage beleuchtet die Tatsache, dass das Judentum einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Kultur Europas hatte und eine Betrachtung der Geschichte Deutschlands ohne dessen Einbeziehung wohl als unvollständig angesehen werden müsste. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung urbaner Siedlungen, denn die Judensiedlung, Judenstraße oder Judengasse prägte häufig in nicht geringem Maße das Stadtbild.
in den letzten Jahrzehnten wurden vermehrt archäologische Untersuchungen innerhalb jüdischer Wohnquartiere vorgenommen, deren Ergebnisse anhand einiger prominenter Beispiele im Folgenden vorgestellt werden sollen. Zunächst soll jedoch die immer wieder gestellte Frage zur Kontinuität jüdischer Besiedlung in deutschen Landen aufgegriffen werden, wobei verstärkt auf Schrifthistorische Quellen zurückgegriffen werden muss. Den Schwerpunkt der Arbeit bilden die Topographie jüdischer Viertel, sowie die für den jüdischen Kult elementaren Einrichtungen. Von Bedeutung werden insbesondere die Fragen sein, welche Beiträge die archäologischen Untersuchungen jüdischer Viertel zu einem umfassenderen Gesamtbild jüdischen Lebens in deutschen Städten des Mittelalters leisten können und inwieweit sich die gewonnen Erkenntnisse zu einer Interpretation des Verhältnisses zwischen Juden und Christen heranziehen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Anfänge und Fragen zur Kontinuität
- 2. Eine Stadt in der Stadt: Topographie jüdischer Siedlungen
- 2.1. Die Synagoge: Haus der Versammlung – Haus des Gebetes – Haus des Lernens
- 2.2. Die Mikwe: Der Juden kaltes Bad
- 2.3. Weitere Einrichtungen: Tanzhaus, Spital, Bäckerei
- 2.4. Der Friedhof: Ort der Ewigkeit
- 2.5. Ver- und Entsorgung
- 3. Chanukkia und Hochzeitsring: Jüdische Sachkultur im archäologischen Befund
- 4. Zum Verhältnis zwischen Juden und Christen im Mittelalter
- 5. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem jüdischen Leben in deutschen Städten des Mittelalters aus archäologischer Sicht. Sie untersucht, welche Beiträge die Archäologie zu einem umfassenderen Gesamtbild jüdischen Lebens leisten kann und inwieweit sich die gewonnenen Erkenntnisse zur Interpretation des Verhältnisses zwischen Juden und Christen heranziehen lassen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Topographie jüdischer Viertel und die für den jüdischen Kult elementaren Einrichtungen wie Synagoge und Mikwe.
- Die Kontinuität jüdischer Besiedlung in deutschen Städten
- Die Topographie und Struktur jüdischer Viertel
- Die Bedeutung von Synagogen und Mikwen als kultische Einrichtungen
- Die archäologischen Quellen zur jüdischen Sachkultur
- Das Verhältnis zwischen Juden und Christen im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Problematik der Erforschung des jüdischen Lebens im Mittelalter anhand archäologischer Quellen. Kapitel 1 widmet sich der Frage nach dem Beginn jüdischer Siedlungstätigkeit auf deutschem Gebiet und der Kontinuität zwischen Spätantike und Mittelalter. Kapitel 2 analysiert die Topographie jüdischer Viertel in verschiedenen Städten, darunter Regensburg, Köln, Speyer, Mainz, Trier und Frankfurt am Main. Es beleuchtet die Lage, die innere Gliederung und die spezifischen Einrichtungen der Viertel.
Kapitel 2.1 untersucht die Synagoge als Haus der Versammlung, des Gebetes und des Lernens, wobei die Baugeschichte der Kölner und Speyerer Synagoge im Detail betrachtet wird. Kapitel 2.2 beleuchtet die Mikwe als rituelles Tauchbad und untersucht die unterschiedlichen Bauformen von Mikwen in Speyer, Worms, Köln, Friedberg und Frankfurt am Main. Kapitel 2.3 gibt einen Überblick über weitere Einrichtungen wie das Tanzhaus, das Spital und die Bäckerei und zeigt anhand von Beispielen aus Regensburg und Frankfurt, wie diese im archäologischen Befund fassbar sind.
Kapitel 2.4 behandelt den Friedhof als Ort der Ewigkeit und beleuchtet die besondere Bedeutung jüdischer Friedhöfe als historische Quellen. Es stellt die Ergebnisse archäologischer Untersuchungen von Friedhöfen in Frankfurt am Main, Trier und Würzburg dar. Kapitel 2.5 widmet sich der Wasserversorgung und Entsorgung in jüdischen Vierteln, wobei die Beispiele Regensburg und Frankfurt am Main im Detail betrachtet werden.
Kapitel 3 analysiert die jüdische Sachkultur im archäologischen Befund, wobei die Chanukkia und der Hochzeitsring als typische jüdische Objekte im Fokus stehen. Kapitel 4 diskutiert das Verhältnis zwischen Juden und Christen im Mittelalter und beleuchtet die Frage, inwieweit die archäologischen Befunde die Annahme einer räumlichen und kulturellen Trennung von Juden und Christen stützen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen jüdisches Leben, Mittelalter, Archäologie, Stadttopographie, Synagogen, Mikwen, Sachkultur, Verhältnis zwischen Juden und Christen, Judensiedlungen, Judengassen, Judenviertel, Ghettos.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Juden für die Kultur des mittelalterlichen Europas?
Jüdische Kultur war ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte, insbesondere bei der Entwicklung urbaner Zentren und des Stadtbildes.
Was sind die wichtigsten archäologischen Befunde in jüdischen Vierteln?
Dazu gehören Synagogen, Mikwen (rituelle Tauchbäder), jüdische Friedhöfe sowie Sachkultur wie Chanukkiah-Leuchter oder Hochzeitsringe.
Was ist eine Mikwe?
Eine Mikwe ist ein rituelles Tauchbad, das für den jüdischen Kult elementar ist. Archäologisch sind sie oft durch ihre tiefe Lage im Grundwasserbereich fassbar.
Wie war das Verhältnis zwischen Juden und Christen räumlich gestaltet?
Die Topographie zeigt oft eine enge Nachbarschaft („Inter Christianos“), wobei jüdische Viertel zwar eigene Zentren bildeten, aber meist nicht isoliert vom christlichen Umfeld lagen.
Welche Städte bieten prominente Beispiele für jüdische Archäologie?
Wichtige Befunde stammen aus Köln, Speyer, Regensburg, Mainz, Frankfurt am Main und Worms.
- Quote paper
- Svenja Muche (Author), 2009, Inter Christianos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143081