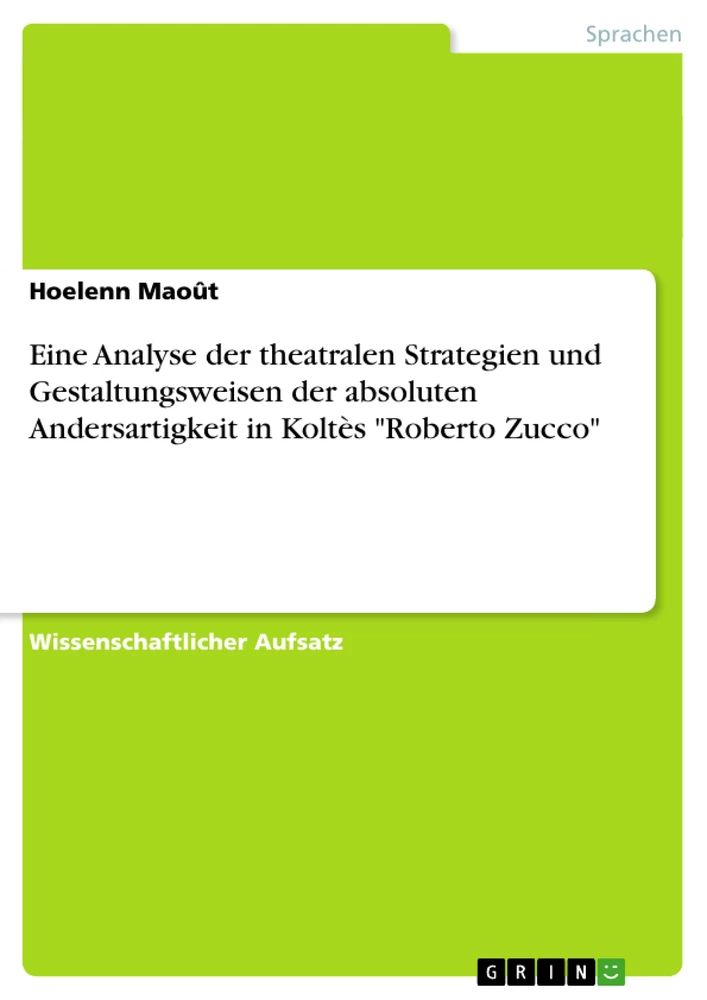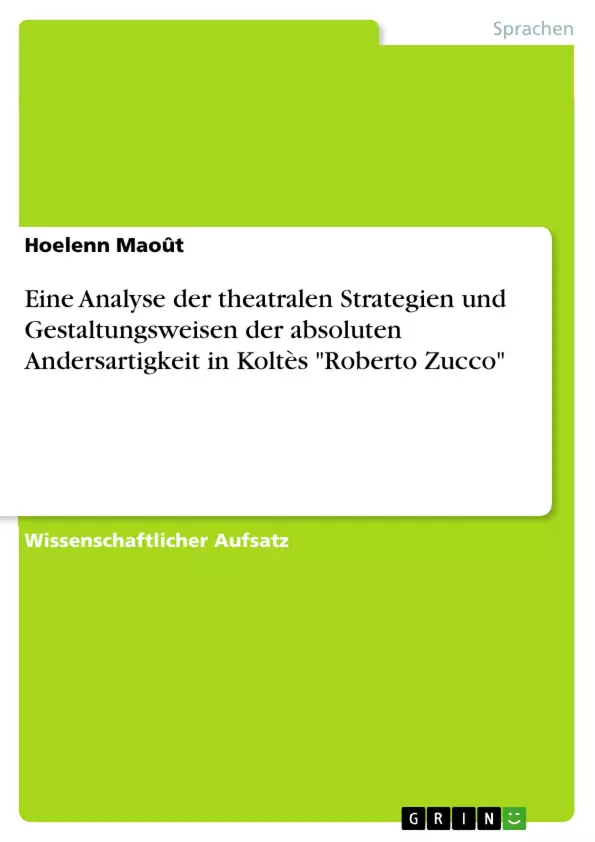Der vorliegende Essay fragt nach den Konfigurationen der absoluten Andersartigkeit in Bernard-Marie Koltès Theaterstück Roberto Zucco aus dem Jahre 1989, welches posthum an der Berliner Schaubühne in einer Inszenierung von Peter Stein seine Premiere feiert und bis heute das meistgespielte Stück aus dem Repertoire des Autors ist.
Grundlage des Stücks ist ein ‚fait divers’, nämlich die Geschichte des italienischen Serienkillers Roberto Succo, der Ende der 1980er Jahren auch im Süden Frankreichs gemordet und vergewaltigt hat. Dieses Faktum dient jedoch nur als Schablone und ist der ausdrücklichste u. a. zahlreichen intertextuellen Verweisen der künstlerischen Perspektivierung. Auf diese Weise wird jedoch die ästhetische Dimension mit einer politischen verklammert, so dass die Interaktion zwischen Text/Theater und Gesellschaft/Geschichte (Julia Kristeva) akzentuiert ist.
Entgegen der skandal tragenden Behauptung Koltès verkläre und glorifiziere mit seinem Zucco die Gewalt des historischen Succo, da ihn der Text weder beurteilt noch verurteilt, handelt es sich im Theaterstück explizit um eine ‚dramatis personae’. Zwar ist diese différance (Jacques Derrida) phonetisch kaum hörbar, sie wird aber an einem einzelnen Graphem lesbar und sichtbar. Aufgrund des historischen Hintergrunds lädt der mythische Held des Textes den Zuschauer nicht zu einer Identifizierung ein, wodurch schon eines der Hauptmerkmale des Textes benannt ist.
Dementsprechend fragt das Stück nicht nach den Motiven der Person, da Koltès nicht versucht sie psychologisch erklärbar oder nachvollziehbar zu machen. Vielmehr mordet der rätselhafte Zucco ‚sans raison’, d. h. im doppelten Sinne des Begriffs: ohne Grund und ohne Verstand, so dass es weder eine sinnhafte, vernünftige Letztbegründung für seine Taten gibt, noch können diese mit Hilfe eines rationalen Ordnungssystems erfasst werden. Er und seine Taten sind ein Geheimnis und infolgedessen ist die mediatisierte Legende Roberto S/Zucco bedeutsam für die Gesellschaft. Als Outlaw ist er nicht nur mit einer allgemeinen Faszinations-Ablehnungsbewegung versehn, interessant für Koltès ist die Figur des Serienkillers, weil sie sich außerhalb der etablierten Ordnungsraster und Konventionen bewegt und insofern als anarchisches Moment etwas absolut Anderes, wie z. B. den Wahnsinn oder den Tod, verkörpert, etwas Unvorstellbares und Undarstellbares...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Realität und Fiktion
- 2. Réécrire le théâtre: Ort, Zeit, Intrige
- 3. Figurenkonstellation: des condamnés à mort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die Konfigurationen der absoluten Andersartigkeit in Bernard-Marie Koltès' Theaterstück „Roberto Zucco“. Er untersucht, wie das Stück die Figur des Serienkillers Roberto Zucco als etwas Absolut Anderes, etwas Unvorstellbares und Undarstellbares darstellt.
- Theatralische Strategien und Gestaltungsweisen der absoluten Andersartigkeit
- Die Interaktion zwischen Text/Theater und Gesellschaft/Geschichte
- Die problematisierten Themen: Tod, Sprache, Liebe, Gewalt und „la productivité du mal“
- Die genealogische Einordnung der Theaterstrukturen in verschiedene theatralische Traditionen
- Der Einfluss von Autoren wie Genet, de Sade, Baudelaire, Rimbaud und Bataille
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Realität und Fiktion
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation des Stücks dar und beleuchtet die Verbindung zwischen der fiktiven Figur des Roberto Zucco und der realen Geschichte des italienischen Serienkillers Roberto Succo. Der Essay diskutiert die ästhetische und politische Dimension des Stücks und die damit verbundene Interaktion zwischen Text/Theater und Gesellschaft/Geschichte.
2. Réécrire le théâtre: Ort, Zeit, Intrige
Dieses Kapitel untersucht die Orte, Zeiten und die Intrige des Stücks. Es analysiert die wechselnden Schauplätze und die Bedeutung der Flucht des Protagonisten aus verschiedenen sozialen und urbanen Umgebungen. Das Kapitel untersucht die Instabilität des Ortes und die Suche nach einem „espace“. Es befasst sich auch mit der Endzeitlichkeit des Stücks und den Verbindungen zu Werken wie „Fin de partie“ von Beckett und „Endspiel“ von Beckett.
3. Figurenkonstellation: des condamnés à mort
Das dritte Kapitel analysiert die Figuren des Stücks, insbesondere Roberto Zucco und das Mädchen Gamine. Es thematisiert die Hybridizität der Figuren, ihre Metamorphose zwischen Tier und Mensch und die damit verbundene Flucht aus den Strukturen der Familie und des Staatsapparates. Das Kapitel befasst sich auch mit Zuccos fragmentierter Identität und seiner Suche nach einem „Anderswo“.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Essays sind: absolute Andersartigkeit, theatralische Strategien, Text/Theater, Gesellschaft/Geschichte, Tod, Sprache, Liebe, Gewalt, „la productivité du mal“, Genet, de Sade, Baudelaire, Rimbaud, Bataille, „non-lieux“, Heterotope, Flucht, Endzeit, Nomadologie, Identität, Ausländerdasein, Fragmentierung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war die reale Vorlage für Koltès "Roberto Zucco"?
Die Figur basiert auf dem italienischen Serienkiller Roberto Succo, der Ende der 1980er Jahre in Frankreich und Italien mordete.
Was bedeutet "absolute Andersartigkeit" in diesem Stück?
Zucco verkörpert das anarchische Moment, den Wahnsinn oder den Tod – etwas, das außerhalb etablierter Ordnungsraster und rationaler Erklärungen steht.
Warum mordet die Figur Roberto Zucco?
Koltès verzichtet auf psychologische Erklärungen; Zucco mordet "sans raison" (ohne Grund und ohne Verstand), was ihn zu einem rätselhaften Geheimnis macht.
Welche Rolle spielen die Schauplätze im Theaterstück?
Die Orte sind instabil (Heterotopien); die Flucht des Protagonisten durch verschiedene soziale Umgebungen symbolisiert seine Fragmentierung.
Welche literarischen Einflüsse werden in der Analyse genannt?
Es werden Einflüsse von Autoren wie Genet, de Sade, Baudelaire und Beckett (Endspiel) untersucht.
- Quote paper
- M.A. Hoelenn Maoût (Author), 2009, Eine Analyse der theatralen Strategien und Gestaltungsweisen der absoluten Andersartigkeit in Koltès "Roberto Zucco", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143148