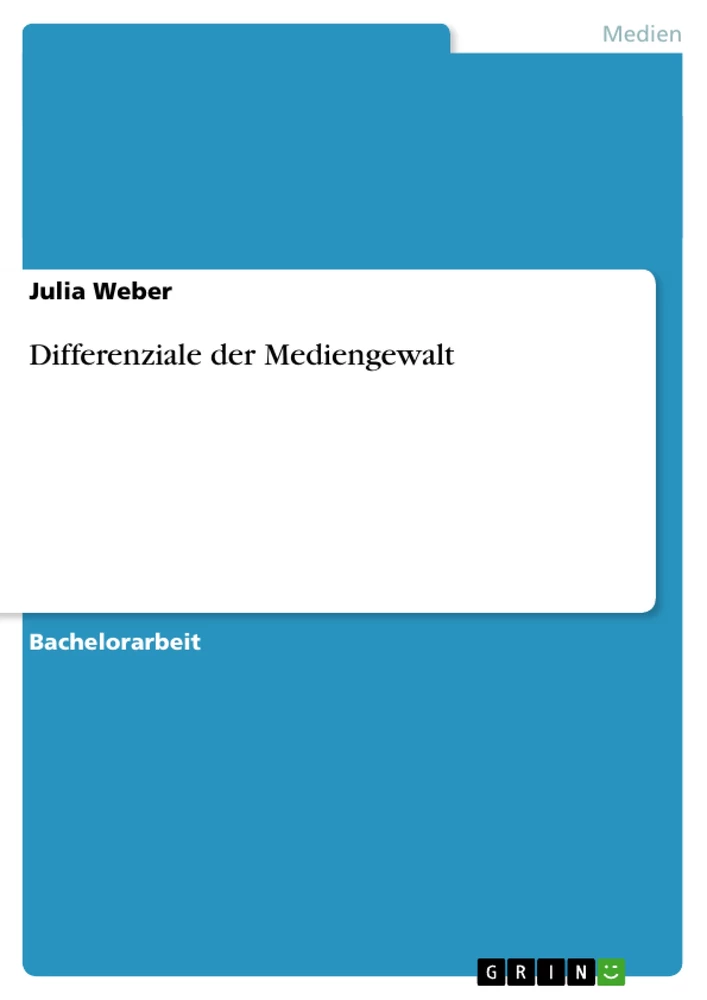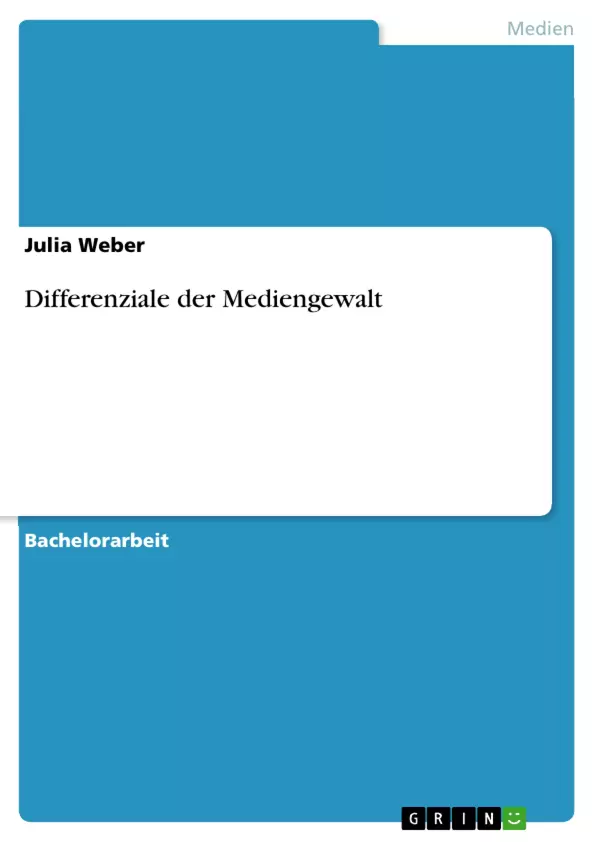Amokläufe von Jugendlichen wie der Fall Winnenden im März des Jahres 2009 lassen immer wieder Stimmen innerhalb der Gesellschaft nach strengeren Gesetzen und einer stärkeren Kontrolle von Gewaltdarstellungen in den Medien laut werden.
In ihren Anfängen ging die Medienwirkungsforschung von einer meist negativen Auswirkung der Medien Radio und Kino auf RezipientInnen aus. Dieser Eindruck wurde durch politische Propaganda und den Erfolg professioneller Werbung während des ersten Weltkriegs noch verstärkt. Gemäß dem Reiz-Reaktions-Modell schienen Medien in der Lage zu sein, Gesellschaften ‚gleichschalten’ zu können. Zur Bestätigung dieser Thesen wurden während der 20er Jahre schließlich die Payne Fund Studies durchgeführt. Carl I. Hovland führte mit seinem Forschungsteam in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts Untersuchungen bezüglich der Wirkungen von Massenmedien auf die persönlichen Einstellungen von RezipientInnen durch. Die Wirkung von Medieninhalten wird den Studien zufolge durch die Wahl der einseitigen vs. der zweiseitigen Argumentation, die Anordnung der Argumente, furchterregender Appelle, der Glaubwürdigkeit der Quelle sowie dem Sleeper-Effect bestimmt und beeinflusst. In seinen Studien knüpfte Jürgen Grimm an die differenziertere Betrachtungsweise der Wirkung von Gewaltdarstellungen in Medien an. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass Unterschiede zwischen der Wirkung ‚Sauberer’ und ‚Schmutziger’ Gewalt bestehen, dass die Dramaturgie eines Films immer auf ein befriedigendes Filmende hin gerichtet sein sollte, sowie, dass die RezipientInnen primär die Perspektive des Opfers, nicht die des Täters einnehmen. Von dieser Annahme ausgehend sind die RezipientInnen fähig zu einer ‚Logik negativen Lernens’, indem sie Folgen, die sich für das Opfer während eines Films ergeben, in ihrem persönlichen Umfeld vermeiden möchten. Dieses Ergebnis entspricht in Teilen der klassischen Katharsis-These von Aristoteles.
Durch die vielen verschiedenen Ansätze der Medienwirkungsforschung ist es schwer, eine endgültig abschließende Theorie zu finden. Die Hauptaufgabe der Medienwirkungsforschung besteht darin, weiterhin, doch differenzierter, nach Ursachen der Gewaltdarstellungen auf RezipientInnen zu suchen. Sie darf sich hierbei nicht den Vorstellungen der Gesellschaft entsprechend verbiegen. Letztere darf neben der medialen Gewalt nicht die ursprünglichen, evt. noch tiefer liegenden Gründe der Gewalt verdrängen oder diese lediglich auf die Medien abwälzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsinteresse
- Rechtlicher Schutz
- Artikel 2 Grundgesetz
- Bundesprüfstelle jugendgefährdender Medien
- Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle
- § 131 Strafgesetzbuch
- Klassische Medienwirkungstheorien
- Kritik an den klassischen Medienwirkungstheorien
- Das General Aggression Model
- Forschungslage
- Die Realität der Gewalt in den Nachrichtenmedien
- Payne-Fund-Studies
- Yale-Studien
- Differenziale der Mediengewalt
- Filmexperimente
- Kampfsportfilm-Experiment
- Savage Street-Experiment
- Die Klasse von 1984-Experiment
- Dreigliedriges Modell der Opferrezeption
- Filmexperimente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Gewaltdarstellungen in den Medien auf RezipientInnen. Sie analysiert verschiedene Theorien und Forschungsansätze zur Mediengewalt und untersucht, inwieweit Medieninhalte tatsächlich zu Aggressionen und Gewalt beitragen können. Der Fokus liegt dabei auf den Differenzialen der Mediengewalt und der Frage, welche Faktoren die Wirkung von Gewaltdarstellungen beeinflussen.
- Klassische Medienwirkungstheorien und ihre Kritik
- Das General Aggression Model als Ansatzpunkt zur Erklärung von Mediengewalt
- Die Payne-Fund-Studies und ihre Bedeutung für die Medienwirkungsforschung
- Die Yale-Studien und die Untersuchung der Wirkung von Medieninhalten auf Einstellungen
- Differenziale der Mediengewalt: Einflussfaktoren und verschiedene Forschungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung des Amoklaufs von Winnenden im Jahr 2009 und seiner Folgen, die zu einer öffentlichen Debatte über die Rolle von Mediengewalt geführt haben. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem beleuchtet, die von der Forderung nach strengeren Gesetzen bis hin zu einem differenzierteren Blick auf die Medienwirkung reichen.
- Forschungsinteresse: Dieses Kapitel definiert das Forschungsinteresse der Arbeit und skizziert die zentrale Frage nach der Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien. Es werden die Ziele der Arbeit und die wichtigsten Forschungsfragen vorgestellt.
- Rechtlicher Schutz: Hier werden verschiedene rechtliche Aspekte des Themas beleuchtet, darunter Artikel 2 des Grundgesetzes, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle und § 131 des Strafgesetzbuchs. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen spielen eine wichtige Rolle für die Diskussion über Mediengewalt und Jugendschutz.
- Klassische Medienwirkungstheorien: In diesem Kapitel werden die wichtigsten klassischen Theorien der Medienwirkung vorgestellt, darunter die Katharsisthese, die Inhibitionsthese, die Habitualisierungsthese und die Rationalisierungsthese. Es wird auch auf die Kritik an diesen Theorien eingegangen und das General Aggression Model als ein neuerer Ansatz vorgestellt.
- Payne-Fund-Studies: Die Payne-Fund-Studies werden als wegweisende Studien der Medienwirkungsforschung betrachtet. Sie haben gezeigt, dass Medieninhalte durchaus Einfluss auf RezipientInnen haben können, aber auch, dass dieser Einfluss nicht immer negativ ist. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse der Payne-Fund-Studies zusammengefasst.
- Yale-Studien: Die Yale-Studien haben sich mit der Wirkung von Medieninhalten auf Einstellungen und Meinungen beschäftigt. Es werden die wichtigsten Forschungsbefunde vorgestellt, die zeigen, dass die Wirkung von Medieninhalten von verschiedenen Faktoren abhängt, z.B. der Glaubwürdigkeit der Quelle, der Art der Argumentation und der Anordnung der Inhalte.
- Differenziale der Mediengewalt: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Wirkungen von Mediengewalt. Es werden verschiedene Forschungsansätze vorgestellt, die zeigen, dass die Wirkung von Gewaltdarstellungen von Faktoren wie der Art der Gewalt, der dramaturgischen Struktur des Films und der Perspektive des Rezipienten abhängt. Es wird auch das dreigliedrige Modell der Opferrezeption vorgestellt, das die psychologische Reaktion des Rezipienten auf die dargestellte Gewalt erklärt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind Mediengewalt, Medienwirkung, Gewaltdarstellung, Rezeption, Medienforschung, Katharsis, General Aggression Model, Payne-Fund-Studies, Yale-Studien, Filmexperimente, Opferrezeption, Jugendschutz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken Gewaltdarstellungen in Medien auf Rezipienten?
Die Forschung untersucht verschiedene Thesen, von der Abstumpfung (Habitualisierung) bis hin zum Abbau von Aggressionen (Katharsis).
Was besagt die Katharsis-These?
Sie geht auf Aristoteles zurück und besagt, dass das Betrachten von fiktionaler Gewalt zu einer inneren Reinigung und zum Abbau eigener Aggressionen führen kann.
Was sind die Payne Fund Studies?
Dies waren wegweisende Studien aus den 1920er Jahren, die erstmals systematisch die Auswirkungen von Kinofilmen auf Kinder und Jugendliche untersuchten.
Was ist der Unterschied zwischen „sauberer“ und „schmutziger“ Gewalt?
„Saubere“ Gewalt zeigt oft keine Konsequenzen für das Opfer, während „schmutzige“ Gewalt das Leid realistisch darstellt und so eher abschreckend wirkt.
Welche Rolle spielt der Jugendschutz bei Mediengewalt?
Institutionen wie die FSM oder USK prüfen Medieninhalte auf Grundlage von Gesetzen wie § 131 StGB, um Kinder vor entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten zu schützen.
- Citar trabajo
- Julia Weber (Autor), 2009, Differenziale der Mediengewalt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143328