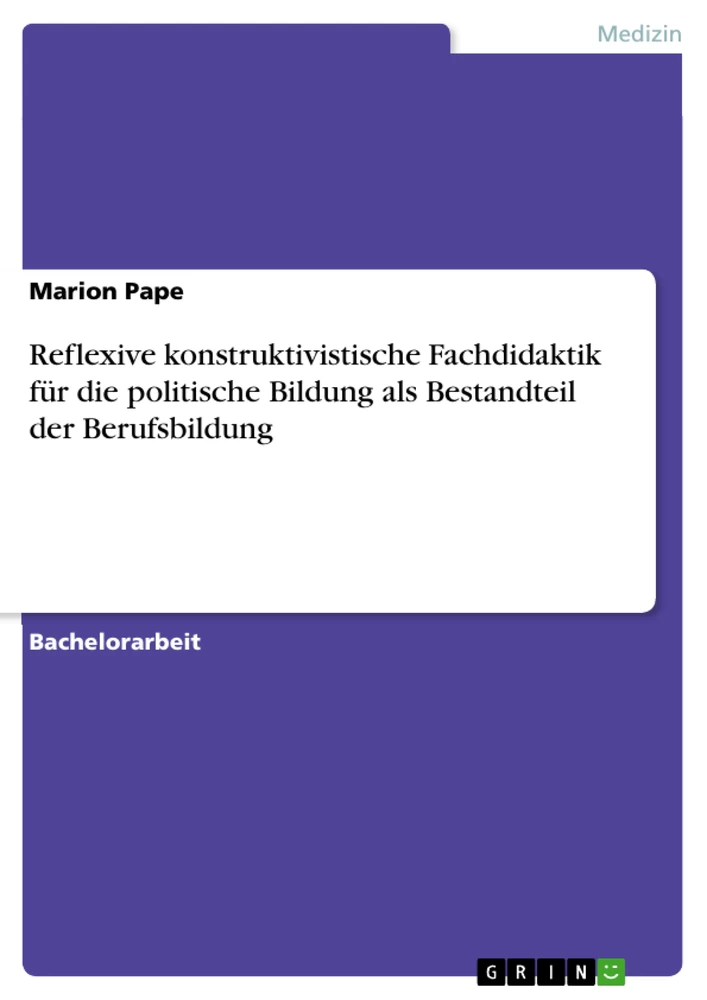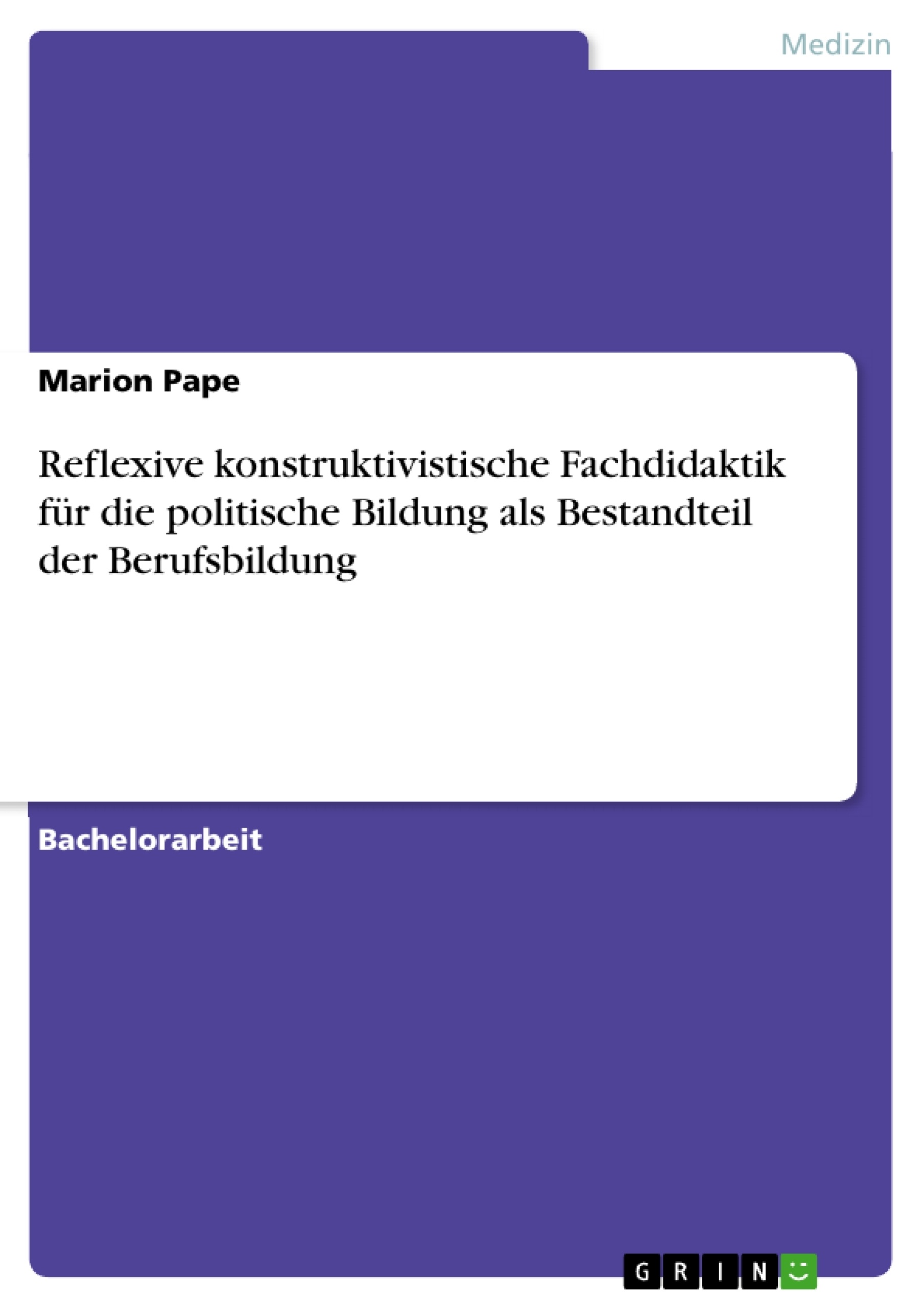Die vorliegende Erarbeitung stellt sich die Frage, wie aus den Grundgedanken des Konstruktivismus und den Zielen politischer Bildung, übertragen auf den Lernprozess eine Fachdidaktik für die politische Bildung in der Berufsbildung gestaltet werden kann.
Wie müsste ein Analyseraster aussehen, um Anwendung und Durchführung zu sichern und systematisch zu evaluieren, denn nicht nur die Lernenden sollten sich letztendlich der Überprüfung stellen müssen. Politische Bildung im Dialog, im Diskurs und in Eigenregie der Lernenden müsste deren Nachhaltigkeit zugute kommen. Darüberhinaus kann sie den Lehrenden die tägliche Arbeit erleichtern. Man könnte sich den Grundgedanken, der dieser Erarbeitung zugrunde liegenden Vorstellung des Erwerbs von politischer Mündigkeit, in Form einer hermeneutischen Spirale vorstellen. Der Lernende tritt an einer bestimmten Stelle, ob durch persönliches Interesse oder durch eine Lehrveranstaltung motiviert, in die Spirale ein. Erwirbt neue Erkenntnisse und Sichtweisen, folgt der Spirale und steigt irgendwo freiwillig, oder begründet mit dem Ende der Veranstaltung, Ausbildung etc. wieder aus. Wird ein Thema oder ein Aspekt in folgenden Lerngeschehen, ob nun in Veranstaltungen oder privaten Diskussionen wieder berührt, betritt der Lernende die Spirale an anderer Stelle wieder, ausgestattet mit der erworbenen Reflexivität, betrachtet er eine neue Situation von anderer Warte, aber unter Bezug auf das bereits vorher Erworbene. So fällt ihm in Folge, aufgrund der Gewinnung persönlicher Ansichten und Erkenntnisse und dem Wissen darüber, bzw. mithilfe der folgenden Reflexion, vielleicht beim Diskutieren mit Menschen mit politischem „Stammtischwissen“ nicht erst das Notwendige ein, wenn die Diskussion bereits beendet ist. Er erkennt Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten und nutzt sie. Nicht zuletzt findet sich hier eines der Ziele politischer Bildung, sich eben reflektiert mit realem politischem Handeln auseinanderzusetzen.
Durch die Verbindung von, der ohnedies dem Anspruch politischer Bildung
entsprechender Subjektorientierung, mit dem Ziel politischer Mündigkeit, ausgewiesen durch die angestrebten Kompetenzen als Ziel beruflicher Bildung, im Hinblick auf Taxonomiestufen zur Planung und Bewertung, mit Fokus auf im Rahmen von beruflicher Bildung möglicher reflexiver Praxis, soll in dieser Erarbeitung eine anwendbare Fachdidaktik für die politische Bildung im Rahmen der Berufsbildung entstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Konstruktivistische Ansätze in der pädagogischen Praxis
- Ermöglichungsdidaktik
- Reflexive Praxis in der Pädagogik
- Politische Bildung
- Berufsbildung
- Perspektiven der politischen Bildung in der pädagogischen Praxis
- Politische Bildung in der Neuzeit
- Hintergründe
- Ziele
- Aktuelle Herausforderungen
- Politikunterricht in der beruflichen Bildung
- Hintergründe
- Ziele
- Institutionelle Bedingungen
- Rahmenrichtlinien und Lehrpläne und deren Verfallsdatum
- Politische Bildung in der Neuzeit
- Reflexive konstruktivistische Fachdidaktik für Inhalte der politischen Bildung
- Allgemeine Grundlage der Erarbeitung
- Ziele
- Besonderheiten
- Kompetenzerwerb der Lernenden im Hinblick auf Messbarkeit und Bewertung
- Herausforderungen der politischen Bildung im Hinblick auf die Berufsbildung
- Reflexivität mehr als ein Schlagwort!
- Schematisierung der Lehrveranstaltung
- Analyseraster
- Ausarbeitung eines Konzepts für den Politikunterricht in der beruflichen Bildung am Beispiel des Unterrichtsthemas ,,Rassismus“
- Interpretierte hypothetische Ausgangslage
- Lehrplan für das Fach Politik / Gesellschaftslehre
- Besonderheiten der Berufsfelder im Hinblick auf die politische Bildung
- Aspekte der Unterrichtsplanung
- Inhaltsauswahl
- Didaktische Analyse anhand des Analyserasters
- Analyseraster des genannten Beispiels zum Thema „Rassismus“ von Lernerseite
- Interpretierte hypothetische Ausgangslage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Fachdidaktik für die politische Bildung in der Berufsbildung, die auf den Prinzipien des Konstruktivismus und der Reflexiven Praxis basiert. Das Ziel ist es, eine didaktische Grundlage für die politische Bildung zu schaffen, die die aktive Beteiligung und den individuellen Lernprozess der Lernenden im Vordergrund stellt und die Nachhaltigkeit der Bildungserfahrungen sicherstellt.
- Konstruktivistische Lerntheorien und ihre Anwendung in der Berufsbildung
- Reflexive Praxis als zentraler Bestandteil der politischen Bildung
- Die Rolle von Kompetenzentwicklung und Mündigkeit in der politischen Bildung
- Entwicklung eines Analyserasters zur Gestaltung und Evaluation von Unterrichtseinheiten
- Die praktische Umsetzung der Fachdidaktik am Beispiel des Themas „Rassismus“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz politischer Bildung in der heutigen Gesellschaft und insbesondere in der Berufsbildung hervorhebt. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert, wobei der Fokus auf konstruktivistischen Ansätzen, der Ermöglichungsdidaktik und der reflexiven Praxis in der Pädagogik liegt. In den folgenden Kapiteln werden die Perspektiven der politischen Bildung in der pädagogischen Praxis beleuchtet, inklusive einer Analyse des Politikunterrichts in der beruflichen Bildung. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung einer reflexiven konstruktivistischen Fachdidaktik für Inhalte der politischen Bildung. Hier werden die allgemeinen Grundlagen, Ziele und Besonderheiten dieser Fachdidaktik erläutert, inklusive einer schematischen Darstellung der Lehrveranstaltung und der Entwicklung eines Analyserasters.
Schlüsselwörter
Konstruktivistische Fachdidaktik, politische Bildung, Berufsbildung, reflexive Praxis, Kompetenzentwicklung, Mündigkeit, Analyseraster, Unterrichtsplanung, Rassismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine reflexive konstruktivistische Fachdidaktik?
Es ist ein Ansatz, der politisches Lernen als aktiven, individuellen Konstruktionsprozess versteht, bei dem die Reflexion des eigenen Handelns im Zentrum steht.
Warum ist politische Bildung in der Berufsbildung wichtig?
Sie soll Auszubildende zur "politischen Mündigkeit" befähigen, damit sie ihre Rechte und Pflichten als Bürger und Arbeitnehmer reflektiert wahrnehmen können.
Was versteht man unter der "hermeneutischen Spirale" des Lernens?
Lernende bringen Vorwissen ein, erwerben neue Perspektiven und kehren mit einem vertieften Verständnis zu Themen zurück, was einen lebenslangen Lernprozess symbolisiert.
Wozu dient das in der Arbeit entwickelte Analyseraster?
Es hilft Lehrenden, Unterrichtseinheiten systematisch zu planen, durchzuführen und hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Kompetenzentwicklung zu evaluieren.
Wie wird das Thema „Rassismus“ didaktisch aufbereitet?
Anhand des Analyserasters wird aufgezeigt, wie Schüler das Thema Rassismus subjektorientiert und im Dialog erarbeiten können.
- Citation du texte
- Marion Pape (Auteur), 2009, Reflexive konstruktivistische Fachdidaktik für die politische Bildung als Bestandteil der Berufsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143388