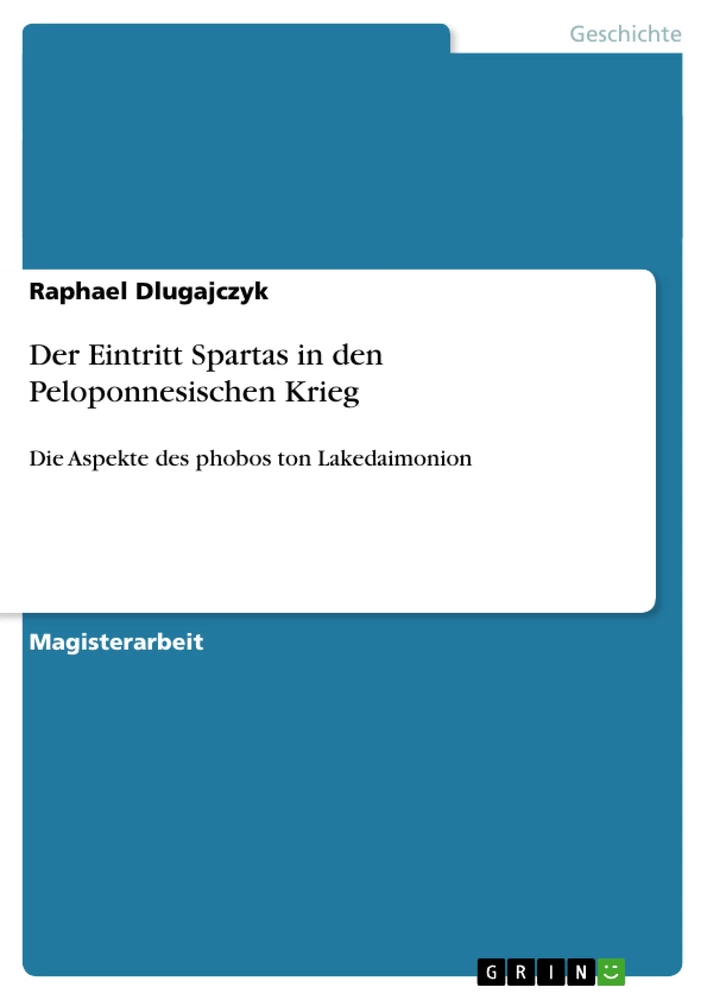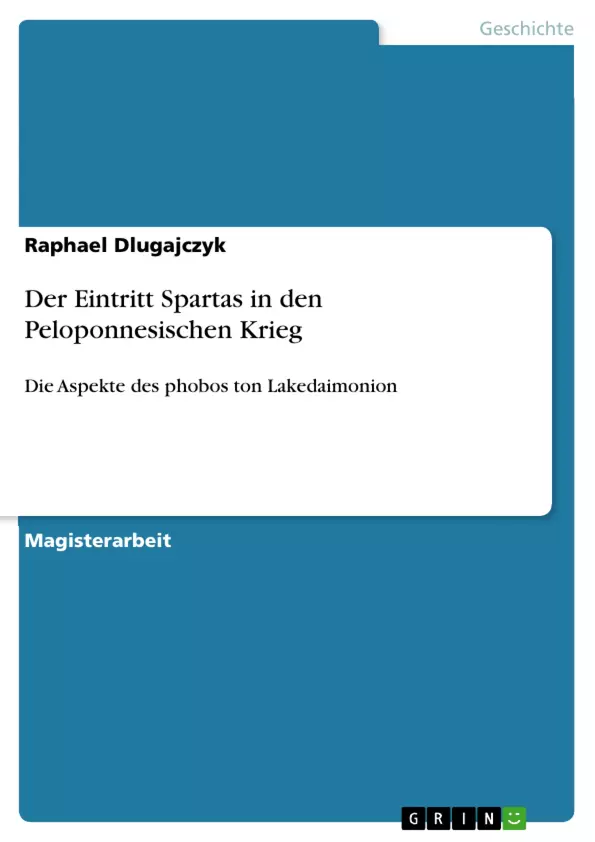Die Arbeit befaßt sich mit einer vieldiskutierten Kernfrage der Alten Geschichte: Wie kam es zum Ausbruch des Peloponnesischen Krieges zwischen den Machtblöcken Athen und Sparta? Im Zentrum der Untersuchung steht die tiefgehende Analyse des ersten Buches des Thukydides, allem voran seine scharfsinnige Unterscheidung zwischen „der wahrsten Ursache“ und den „Anlässen“, die zum Krieg geführt haben. Bisherige Forschungen konzentrierten sich auf die Ermittlung des Kriegsschuldigen, den Thukydides selbst beim genauen Hinsehen gerade nicht bezeichnet. Während die eine Seite die imperiale Machtpolitik der Athener als Kriegsgrund definierte, sah die andere Seite diesen in der aggressiven Kriegspolitik der Spartaner. Die Magisterarbeit zeigt aber, daß die bisherige Forschung nicht das wesentliche erkannt hat – und das liegt am Mangel bei der Auseinandersetzung mit den strukturellen Momenten des Thukydides, insbesondere an einem modernen, aber nicht angemessenen Machtbegriff.
Das Thema ist auf Sparta ausgerichtet. Daher befaßt sich der erste Teil der Arbeit mit der Untersuchung des Charakters und der Triebkräfte der spartanischen Außenpolitik. Es wird deutlich, daß Furcht und Sicherheit als wesentliche strukturelle Faktoren die Politik Spartas bestimmten.
Im Blickfeld des zweiten Kapitels steht sodann das erste Buch des Thukydides. Die Analyse der „Anlässe“ des Krieges zeigt, daß bestimmte feststehende strukturelle Faktoren die Spartaner in den Krieg führten. Im Anschluß folgt eine ausführliche Untersuchung der „wahrsten Ursache“. Erst eine interdisziplinäre Betrachtungsweise (d.h. althistorische, altphilologische, philosophische und politologische) ermöglicht eine widerspruchsfreie Interpretation des Thukydides. Es wird deutlich, daß die bisherigen Forschungen die Kriegsursache auf der „systemischen Analyseebene“ untersuchten. Da sie auf Widersprüche stießen, interpretierten sie diese als eine Schwäche des thukydideischen Werkes. Betrachtet man den Vorgang jedoch auf „subsystemischer Ebene“ ist die Analyse des Historikers stimmig und enthüllt eine erschreckend modern anmutende Tiefe.
Im dritten Kapitel schließlich werden alle strukturellen Faktoren nebeneinadergestellt. Schnell wird dabei deutlich, warum Thukydides den Krieg für „unausweichlich“ hielt, und selbst eine einseitige Schuldzuweisung vermied.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Charakter und die Triebkräfte der spartanischen Außenpolitik
- 1.1. Die geostrategischen Vorraussetzungen
- 1.2. Das Fundament des spartanischen Kosmos: Die Heloten
- a) Status und Funktion der Heloten
- B) Die Helotengefahr und die Helotenfurcht
- 1.3. Die außenpolitische Neuorientierung: Der Peloponnesische Bund
- a) Die Zielsetzung der spartanischen Außenpolitik nach den Messenischen Kriegen
- B) Die Struktur und Funktion des Peloponnesischen Bundes
- y) Weitere außenpolitische Ambitionen und die sog. Kleomenes-Doktrin
- 1.4. Die Außenpolitik des 5. Jahrhunderts: Zwischen Hegemonie, Krise und Dualismus
- a) Der Sonderweg Spartas, die Krisensymptome und die außenpolitischen Folgen
- B) Sparta und die Perserkriege - Die Folgen der Ideologisierung
- y) Die Pentakontaëtie: Stationen des spartanisch-athenischen Dualismus
- 8) Die Spondai von 446/5 und ihre Folgen
- 2. Thukydides und die Aitiologie des Peloponnesischen Krieges
- 2.1. Die αἰτίαι καὶ διαφοραί
- a) Samos und Amprakia
- B) Der Kerkyra Konflikt
- y) Der Poteidaia Konflikt
- 8) Das Megarische Psephisma
- ε) Ägina und das Problem der Autonomie
- 2.2. Die Debatten vor dem Krieg
- a) Die Rede der Korinther
- B) Die Reden von Archidamos und Sthenelaidas
- 2.3. Die ἀληθεστάτη πρόφασις
- a) Zur Interpretation von Thukydides I 23,6
- B) Der,Machtzuwachs Athens' I - Die Ungereimtheiten des realistischen Machtbegriffs (systemische Analyseebene)
- 2.4. Die unterschiedlichen Charaktere der beiden Poleis als Kriegsursache bei Thukydides
- a) Der,Machtzuwachs Athens' II - Der thukydideische Machtbegriff (subsystemische Analyseebene)
- ß) Die Aspekte des athenisch-spartanischen Dualismus
- 2.1. Die αἰτίαι καὶ διαφοραί
- 3. Ergebnisse: Die Aspekte des þóßoç tŵv Aakedaɩµoviwv ..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Eintritt Spartas in den Peloponnesischen Krieg und analysiert die Aspekte des φόβος τῶν Λακεδαιμονίων (Thuk. I 23,6) als entscheidende Triebkraft für den Konflikt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Ursachen des Krieges aus der Sicht Spartas zu beleuchten und die Rolle des spartanischen Machtgefühls im Kontext der athenisch-spartanischen Rivalität zu erforschen.
- Die spartanische Außenpolitik im 5. Jahrhundert v. Chr.
- Die Rolle der Heloten in der spartanischen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Außenpolitik
- Die Entstehung des Peloponnesischen Bundes und seine strategischen Ziele
- Die Aitiologie des Peloponnesischen Krieges nach Thukydides
- Der Einfluss der Machtgefühle auf die Entscheidungen Spartas
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit untersucht die Charakteristika der spartanischen Außenpolitik im 5. Jahrhundert v. Chr. Es beleuchtet die geostrategischen Vorraussetzungen, die Rolle der Heloten im spartanischen Kosmos und die Entstehung des Peloponnesischen Bundes als Instrument der spartanischen Machtpolitik.
Kapitel zwei widmet sich Thukydides' Darstellung der Ursachen des Peloponnesischen Krieges. Es analysiert die verschiedenen Faktoren, die zur Eskalation des Konflikts beitrugen, insbesondere die Rolle der sogenannten αἰτίαι καὶ διαφοραί.
Das dritte Kapitel untersucht die Aspekte des φόβος τῶν Λακεδαιμονίων im Kontext der athenisch-spartanischen Rivalität. Es beleuchtet die Rolle der Furcht vor Athen als entscheidende Triebkraft für Spartas Eintritt in den Krieg und analysiert die verschiedenen Interpretationen von Thukydides' Aussage.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der antiken griechischen Geschichte, insbesondere mit dem Peloponnesischen Krieg, Sparta, Athen, Thukydides, Machtpolitik, Aitiologie, φόβος, Heloten, Peloponnesischer Bund, αἰτίαι καὶ διαφοραί.
Häufig gestellte Fragen
Was war laut Thukydides die "wahrste Ursache" des Peloponnesischen Krieges?
Thukydides sah die Hauptursache im Machtzuwachs Athens und der daraus resultierenden Furcht der Spartaner (Phobos).
Welche Rolle spielten die Heloten für die spartanische Außenpolitik?
Die ständige Gefahr von Helotenaufständen zwang Sparta zu einer auf Sicherheit fokussierten Politik, die oft defensiv und misstrauisch gegenüber äußeren Mächten war.
Was war der Peloponnesische Bund?
Es war ein von Sparta geführtes Bündnissystem, das primär der Sicherung der spartanischen Hegemonie und dem Schutz vor äußeren Bedrohungen diente.
Wie unterscheidet Thukydides zwischen "Anlässen" und "Ursachen"?
Anlässe waren konkrete diplomatische Konflikte (z.B. Kerkyra oder Poteidaia), während die wahre Ursache in der strukturellen Rivalität der Machtblöcke lag.
Warum vermied Thukydides eine einseitige Schuldzuweisung?
Aufgrund seiner tiefgehenden Analyse der strukturellen Faktoren hielt er den Krieg für eine unausweichliche Konsequenz der damaligen Machtkonstellation.
- Citation du texte
- Raphael Dlugajczyk (Auteur), 2006, Der Eintritt Spartas in den Peloponnesischen Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143404