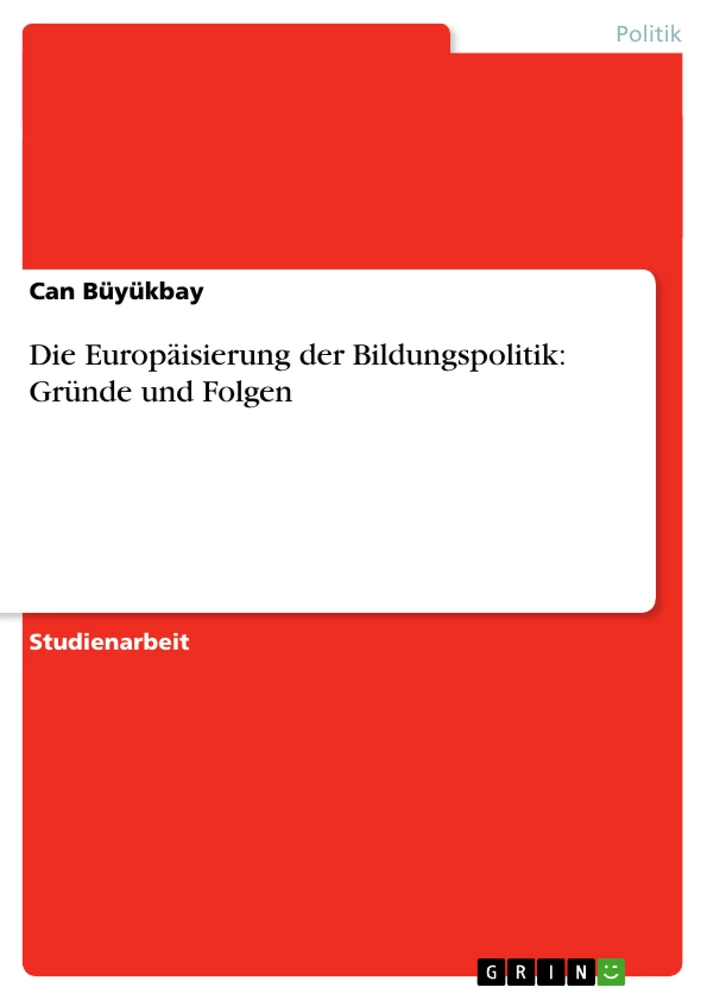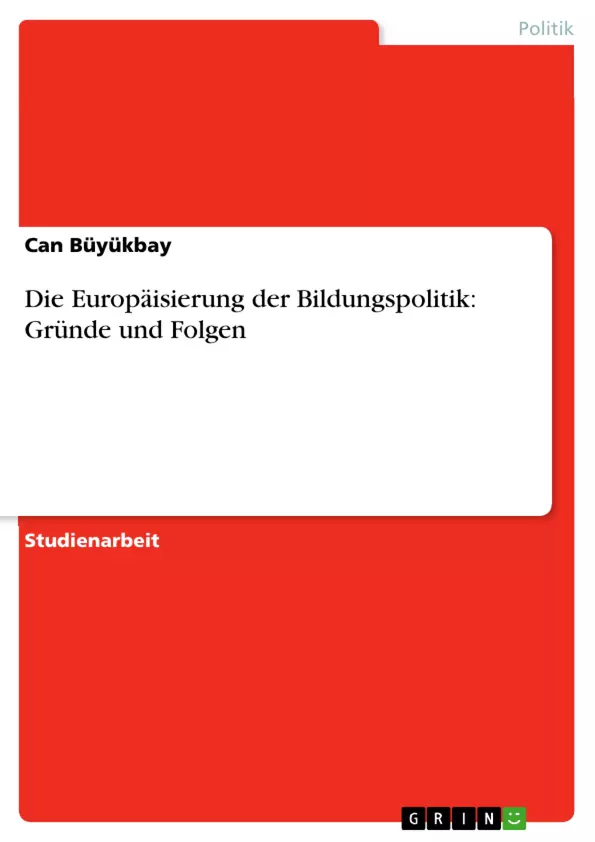Bildung als ein Politikfeld war vom Anfang an sehr eng mit den Nationalstaaten verbunden. Die Internationalisierung der Bildungspolitik ist ein Phänomen, das diese Ausgangsposition der Bildungspolitik stark beeinflusste, indem sie der EU im Bereich Bildungspolitik den Weg ebnete. Die EU ist also in den letzten Jahren zu einem wichtigen Akteur in der Bildungspolitik geworden und kann die Bildungspolitik der Teilnahmeländer stark beeinflussen. Wie kann man den Bedeutungszuwachs der EU in der Bildungspolitik begründen? Dabei ist die Rolle des Bologna Prozesses zu beachten, welches das Ziel hat, bis zum Jahr 2010 einen Europäischen Hochschulraum (European Higher Education Area, EHEA) zu entwickeln. Der Bologna Prozess ist aber nicht ein Prozess, der von der EU initiiert wurde, sondern wurde durch eine zwischenstaatliche Initiative begonnen. In dieser Arbeit wird in Anlehnung an Martens/Wolf (2006) argumentiert, dass der Bologna Prozess initiiert wurde, weil die nationalen Regierungen innenpolitische Reformen durchsetzen wollten. Martens und Wolf (2006) interpretieren den Bologna Prozess in zwei Stufen. Sie betrachten die Ursachen der Europäisierung mit einem akteurszentrierten Ansatz und analysieren die Folgen der Europäisierung der Bildungspolitik mit einem neoinstitutionellen Ansatz. In dieser Arbeit wird in Anlehnung an Martens/Wolf (2006) die These verteidigt, dass die nationalen Regierungen die EU Ebene für ihre Interessen nutzen, um die Gegenspieler im Innern zu beseitigen und somit ihre bildungspolitischen Ziele zu verwirklichen. Martens und Wolf (2006: 146) betonen, dass dies nicht genügend ist, um zu erklären, warum die EU im Bereich Bildungspolitik heute über breite Kompetenzen verfügt. Deswegen verknüpfen sie den akteurszentrierten Institutionalismus mit einer neo-institutionellen Perspektive und betonen die Bedeutung der institutionellen Eigendynamiken der Europäischen Union im Bologna Prozess. Diese zweistufige Erklärung kann eine Antwort dafür geben, so Martens und Wolf, warum die Rolle des nationalen Staates in der Bildungspolitik geschwächt wurde, was die nationalen Regierungen nicht vorhergesehen hatten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORIETEIL
- DER BOLOGNA PROZESS ALS POLITIKNETZWERK
- DIE NEUE STAATSRÄSON
- AKTEURSZENTRIERTER INSTITUTIONALISMUS
- NEOINSTITUTIONALISMUS
- EMPRISCHER TEIL
- DER BOLOGNA PROZESS
- DER BEGRIFF DER EUROPÄISIERUNG
- URSACHEN DER EUROPÄISIERUNG DER BILDUNGSPOLITIK
- FOLGEN DER EUROPÄISIERUNG DER BILDUNGSPOLITIK
- SCHLUSSFOLGERUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Europäisierung der Bildungspolitik anhand des Bologna-Prozesses. Sie analysiert die Gründe für die wachsende Bedeutung der EU in der Bildungspolitik und untersucht die Folgen dieser Entwicklung. Dabei wird argumentiert, dass nationale Regierungen die EU-Ebene nutzen, um innenpolitische Reformen durchzusetzen und ihre bildungspolitischen Ziele zu verwirklichen.
- Der Bologna-Prozess als Politiknetzwerk
- Die Neue Staatsräson und die Rolle der nationalen Regierungen
- Die Folgen der Europäisierung der Bildungspolitik
- Die Bedeutung des akteurszentrierten Institutionalismus und des Neoinstitutionalismus
- Der Einfluss der EU auf die Bildungspolitik der Mitgliedsstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt die zunehmende Bedeutung der EU in der Bildungspolitik. Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der Netzwerkanalyse, dem Neo-Institutionalismus, dem akteurszentrierten Institutionalismus und der „Neuen Staatsräson“. Die Netzwerkanalyse wird verwendet, um den Bologna-Prozess als ein Netzwerk aus verschiedenen Akteuren zu beschreiben. Die Neue Staatsräson erklärt, warum sich nationale Regierungen an die EU-Ebene wenden. Der Neoinstitutionalismus liefert einen analytischen Rahmen für die unbeabsichtigten Folgen der Europäisierung der Bildungspolitik.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt den Bologna-Prozess und den Begriff der Europäisierung. Er untersucht die Ursachen und Folgen der Europäisierung der Bildungspolitik. Schließlich werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Schlussfolgerungen gezogen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Europäisierung, Bildungspolitik, Bologna-Prozess, Politiknetzwerk, Neue Staatsräson, akteurszentrierter Institutionalismus, Neoinstitutionalismus, EU, Nationale Regierungen, Folgen der Europäisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Bologna-Prozesses?
Das Ziel ist die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Hochschulraums (EHEA) mit vergleichbaren Abschlüssen und erhöhter Mobilität für Studierende.
Warum nutzen nationale Regierungen die EU-Ebene für Bildungspolitik?
Regierungen nutzen die EU oft, um innenpolitische Reformen gegen Widerstände im eigenen Land durchzusetzen, indem sie auf europäische Notwendigkeiten verweisen.
Was bedeutet "Europäisierung" der Bildungspolitik?
Es beschreibt den Prozess, bei dem nationale Bildungssysteme zunehmend durch europäische Standards, Kooperationen und politische Zielvorgaben beeinflusst werden.
Welche Rolle spielt der Neoinstitutionalismus in dieser Analyse?
Der Neoinstitutionalismus hilft zu erklären, wie institutionelle Eigendynamiken der EU zu Folgen führen können, die von den Nationalstaaten ursprünglich nicht vorhergesehen wurden.
Ist der Bologna-Prozess eine reine EU-Initiative?
Nein, er begann als zwischenstaatliche Initiative, entwickelte sich aber zu einem komplexen Politiknetzwerk, in dem die EU ein zentraler Akteur wurde.
Welche Folgen hat die Europäisierung für die staatliche Souveränität?
Die Rolle des Nationalstaates in der Bildungspolitik wird geschwächt, da Kompetenzen und Entscheidungsspielräume faktisch auf die europäische Ebene verlagert werden.
- Citar trabajo
- Can Büyükbay (Autor), 2008, Die Europäisierung der Bildungspolitik: Gründe und Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143457