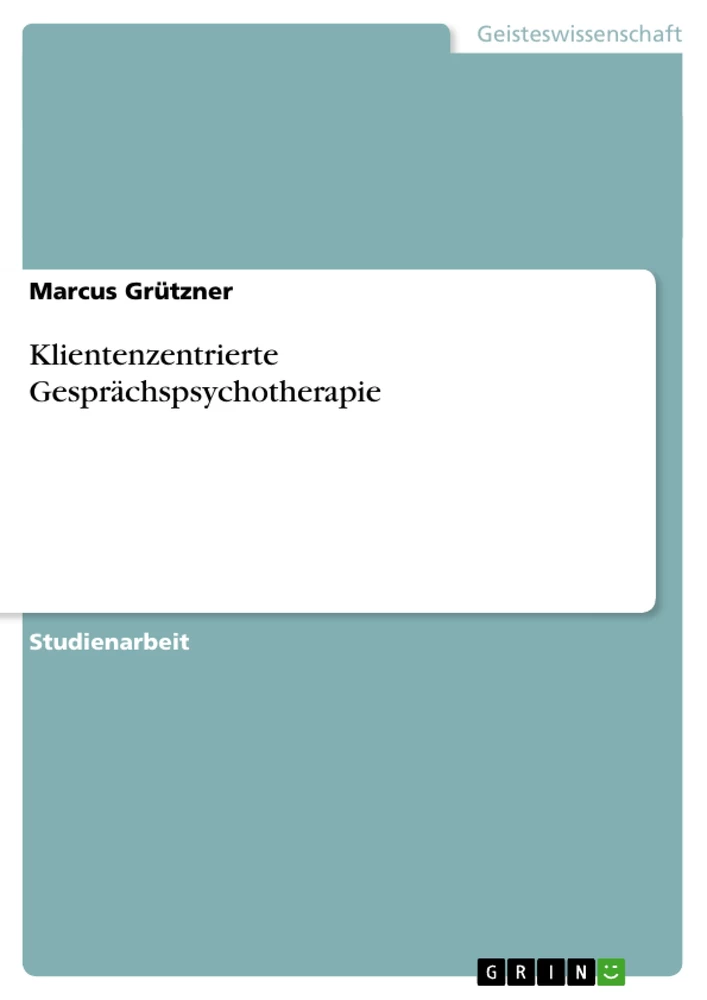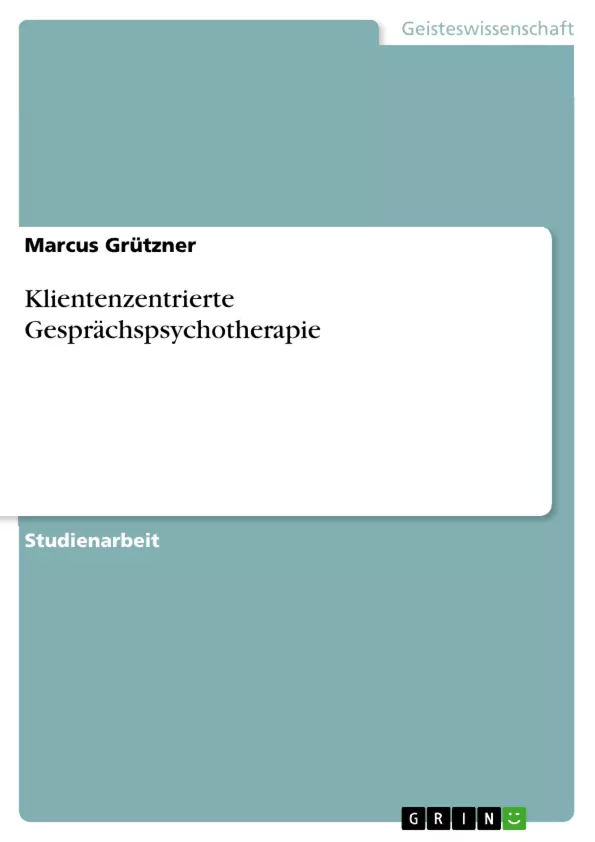Die Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie (Client-centered Therapy) wurde 1942 von dem amerikanischen Psychologen Carl Rogers begründet und theoretisch und praktisch u.a. von Bommert (1976), Pavel (1978) und dem Ehepaar Tausch (1979) weiterentwickelt.1 Das Hauptziel der klienten-zentrierten Therapie, die im deutschsprachigen Raum auch als personenzentrierte Psychotherapie bezeichnet wird, ist „die Förderung des gesunden psychischen Wachstums des Individuums."2 Der Ansatz, der der Humanistischen Psychologie zuzuordnen ist, geht davon aus, dass „allen Menschen das grundlegende Streben der menschlichen Natur nach Selbst-verwirklichung - nach der Verwirklichung des eigenen Potentials - gemeinsam ist"3. Hinzu kommt die Annahme, dass der Mensch von Natur aus gut ist, dieses positive Selbstbild jedoch durch negative Kritiken von au-ßen, z.B. durch fehlerhafte Lernmuster, gestört werden kann. Die Folgen können Angst und ein geringes Selbstwertgefühl sein. „Nach Rogers besteht die Aufgabe des Therapeuten darin, eine therapeutische Umgebung zu schaffen, die es dem Klienten gestattet, die Fähigkeit zur Selbstbewertung neu zu erwerben. Er lernt von neuem zu beurteilen, wie er sich am besten verhält, um die eigene Entwicklung und die Selbstverwirklichung zu fördern. [...] Es ist die grundlegende Strategie des Therapeuten, die Gefühle des Klienten anzuerkennen, anzunehmen und zu klären."4 Im Gegensatz zu an-deren Therapieformen, etwa der Psychoanalyse, in der der Therapeut interpretiert und mögliche Antworten bzw. Anweisungen gibt, ist er in der klientenzentrierten Therapie ‘nur’ ein unterstützender Zuhörer, der die Gefühle und Behauptungen des Klienten reflektiert und sie gelegentlich wiederholt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Menschenbild und die Persönlichkeitstheorie von Rogers
- 3. Therapeutisches Verhalten in der Gesprächspsychotherapie
- 3.1 Echtheit
- 3.2 Positive Wertschätzung
- 3.3 Einfühlendes Verstehen
- 4. Experiencing und Focusing
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erläutert die Charakteristika der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers und verdeutlicht diese anhand von Praxisbeispielen. Der Fokus liegt auf den zentralen therapeutischen Haltungen: Echtheit, positive Wertschätzung und einfühlendes Verstehen. Die Arbeit stützt sich auf die Arbeiten von Sabine Weinberger und bietet einen Einblick in Rogers' Menschenbild und Persönlichkeitstheorie.
- Rogers' Menschenbild und seine Persönlichkeitstheorie
- Die drei Kernhaltungen der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie
- Die Bedeutung der therapeutischen Beziehung
- Praxisbeispiele zur Veranschaulichung der therapeutischen Haltungen
- Das Konzept der Selbstverwirklichung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie (Klientenzentrierte Therapie) vor, die 1942 von Carl Rogers begründet wurde und im deutschsprachigen Raum auch als personenzentrierte Psychotherapie bekannt ist. Sie beschreibt das Hauptziel der Therapie als die Förderung des gesunden psychischen Wachstums des Individuums und betont die Annahme, dass Menschen ein grundlegendes Streben nach Selbstverwirklichung haben. Die Einleitung hebt den Unterschied zu anderen Therapieformen hervor, in denen der Therapeut interpretiert und Anweisungen gibt, im Gegensatz zur klientenzentrierten Therapie, in der der Therapeut als unterstützender Zuhörer fungiert. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Quellen.
2. Das Menschenbild und die Persönlichkeitstheorie von Rogers: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit Rogers' Persönlichkeitstheorie, die er in 19 Thesen darlegte. Es werden zentrale Aspekte wie die Aktualisierungstendenz des Organismus, die Bedeutung des Selbstkonzeptes und die Wahrnehmung der Umwelt im Kontext des individuellen Bezugsrahmens erörtert. Das Kapitel analysiert die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt, die Selbstwahrnehmung des Einzelnen und die Prozesse der psychischen Anpassung und Fehlanpassung. Anhand von Beispielen wird verdeutlicht, wie individuelle Erfahrungen und Bewertungen die Selbstwahrnehmung prägen und das Verhalten beeinflussen. Die 19 Thesen werden in fünf Bereiche eingeteilt, um die Komplexität von Rogers' Ansatz zu strukturieren und zu erläutern. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der therapeutischen Prinzipien, die im folgenden Kapitel behandelt werden.
Schlüsselwörter
Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Personenzentrierte Psychotherapie, Carl Rogers, Selbstverwirklichung, Aktualisierungstendenz, Echtheit, Positive Wertschätzung, Einfühlendes Verstehen, Therapeutische Beziehung, Selbstkonzept, Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf den drei zentralen therapeutischen Haltungen: Echtheit, positive Wertschätzung und einfühlendes Verstehen. Das Dokument erläutert Rogers' Menschenbild und Persönlichkeitstheorie und veranschaulicht die therapeutischen Prinzipien anhand von Praxisbeispielen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Rogers' Menschenbild und Persönlichkeitstheorie (inklusive der 19 Thesen), die drei Kernhaltungen der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie (Echtheit, positive Wertschätzung, einfühlendes Verstehen), die Bedeutung der therapeutischen Beziehung, Praxisbeispiele zur Veranschaulichung der therapeutischen Haltungen, das Konzept der Selbstverwirklichung und die Aktualisierungstendenz.
Wer ist Carl Rogers und welche Rolle spielt er in diesem Kontext?
Carl Rogers ist der Begründer der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie (1942), auch personenzentrierte Psychotherapie genannt. Seine Persönlichkeitstheorie und sein Menschenbild bilden die Grundlage des therapeutischen Ansatzes, der im Dokument ausführlich beschrieben wird.
Was sind die drei Kernhaltungen der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie?
Die drei zentralen therapeutischen Haltungen der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie sind: Echtheit (Authentizität des Therapeuten), positive Wertschätzung (unbedingte Wertschätzung des Klienten) und einfühlendes Verstehen (empathisches Verstehen der Klientenperspektive).
Was ist das Ziel der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie?
Das Hauptziel der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie ist die Förderung des gesunden psychischen Wachstums des Individuums und die Unterstützung der Selbstverwirklichung. Im Gegensatz zu anderen Therapieformen, bei denen der Therapeut interpretiert und Anweisungen gibt, fungiert der Therapeut hier als unterstützender Zuhörer.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel zu Rogers' Menschenbild und Persönlichkeitstheorie, einem Kapitel zu den therapeutischen Haltungen, einem Kapitel zu Experiencing und Focusing (obwohl dieses Kapitel im bereitgestellten Auszug nicht detailliert beschrieben ist) und einem Schlusswort. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Personenzentrierte Psychotherapie, Carl Rogers, Selbstverwirklichung, Aktualisierungstendenz, Echtheit, Positive Wertschätzung, Einfühlendes Verstehen, Therapeutische Beziehung, Selbstkonzept, Persönlichkeitsentwicklung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Dokument selbst nennt Sabine Weinberger als Quelle. Weitere Informationen können über wissenschaftliche Literatur zur klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie und zu Carl Rogers gefunden werden.
- Quote paper
- Marcus Grützner (Author), 1997, Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143458