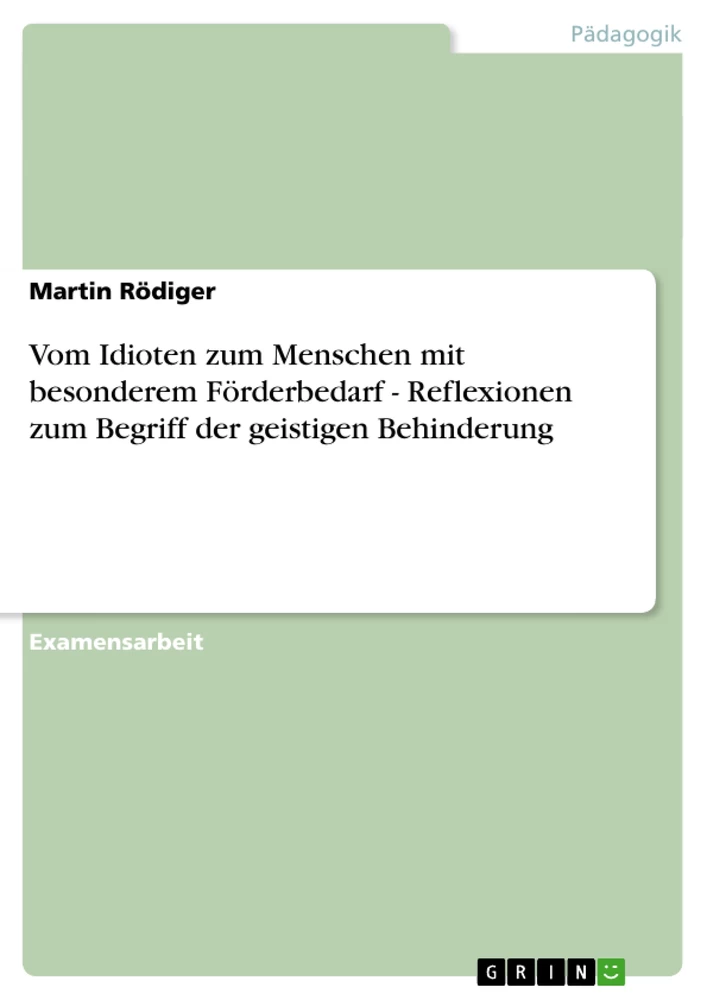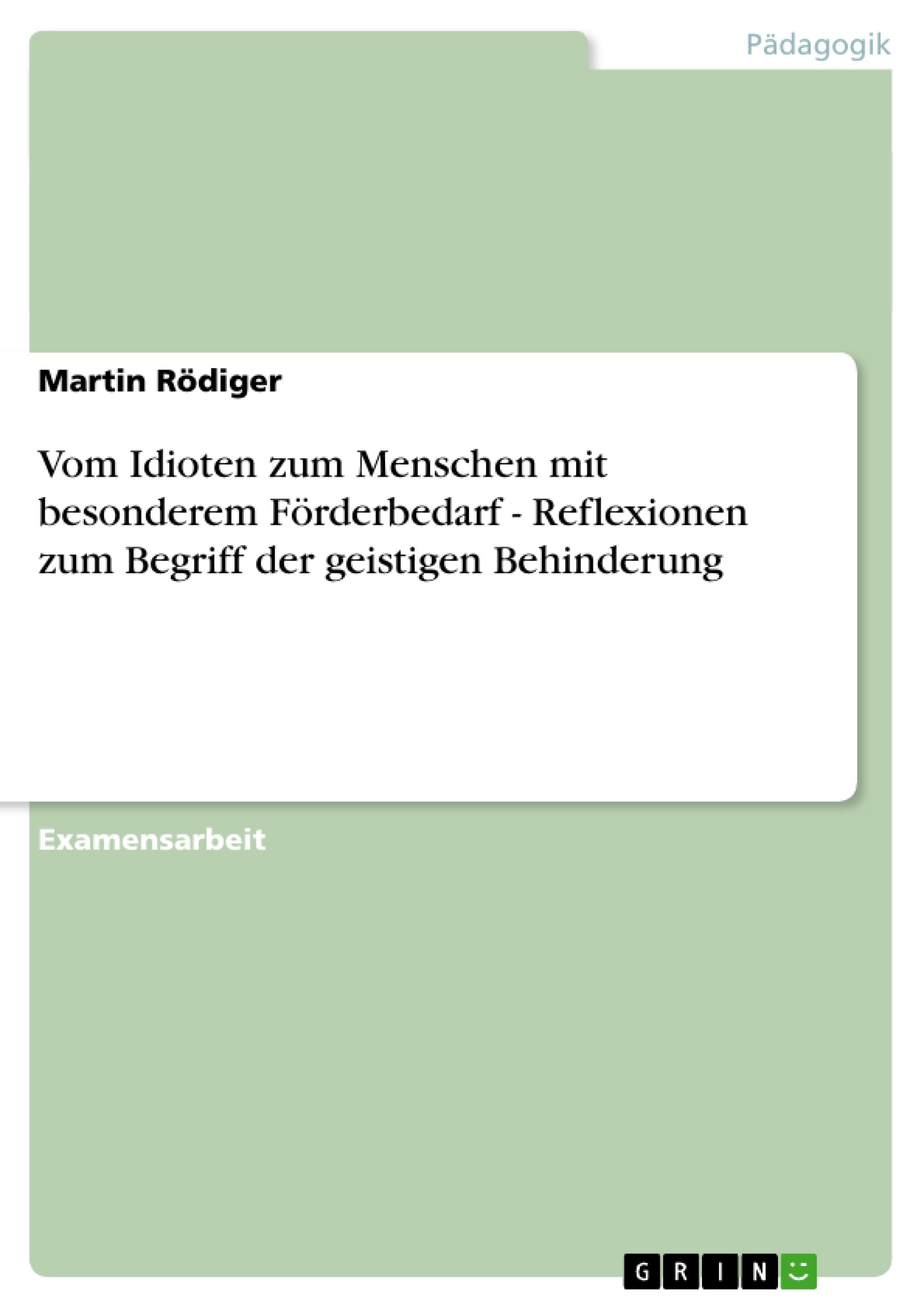Vom „Idioten“ zum „Menschen mit besonderem Förderbedarf“ –
Reflexionen zum Begriff der geistigen Behinderung
Diese Arbeit geht angesichts des verwirrenden Begriffsinventars der Heilpädagogik von der Hypothese aus, dass ›geistige Behinderung‹ ein unbrauchbarer, aber notwendiger Begriff ist (1). Zunächst werden einige grundsätzliche Aspekte von Sprache beleuchtet (2). Auf dieser Grundlage werden die Wörter ›Geist‹, ›Behinderung‹ und ihre Kombination untersucht (3.1). Danach wird in einem kurzen historischen Überblick die Etablierung des Begriffs der ›(geistigen) Behinderung‹ in Alltags- und Fachsprache nachgezeichnet (3.2). Schließlich wird der unterschiedliche Gebrauch des Behinderungsbegriffs in den verschiedenen Wissenschaften nachgewiesen (3.3). Durch die Bestätigung der Hypothese (3.4) besteht die Notwendigkeit, nach alternativen Begriffen zu suchen (4). Da diese Suche erfolglos bleibt und ich trotz der gezeigten Mängel am Begriff der ›geistigen Behinderung‹ festhalten muss, spreche ich mich für eine Terminologie des Vorbehalts aus (5).
Inhaltsverzeichnis
- Geistige Behinderung als konstitutiver Begriff einer heilpädagogischen Fachrichtung
- Die große Sprachverwirrung
- Sorgenkind und/oder Mensch? – Aktuelle Diskussion in der Geistigbehindertenpädagogik
- „Sprachprobleme der Pädagogik“ – Anstöße zur Fragestellung
- Hypothese und Aufbau der Arbeit
- Wesen, Funktion und Macht der Sprache
- Aspekte zu Wurzeln und Gebrauch des Begriffs der geistigen Behinderung
- Geist
- Sprachwissenschaftliche Aspekte
- Behinderung
- Geistige Behinderung
- Historische Aspekte
- Vorläuferbegriffe
- Etablierung des Begriffs der (geistigen) Behinderung
- Interdisziplinäre Aspekte
- Behinderung aus der Sicht der WHO
- Behinderung als individuelle Kategorie
- Behinderung als soziale Kategorie
- Behinderung als rechtliche Kategorie
- Auswertung
- „Geistigbehinderte gibt es nicht!“ – Auf der Suche nach alternativen Begriffen
- Anforderungen an einen möglichen Alternativbegriff
- „Kognitives Anderssein“ oder „besonderer Förderbedarf“?
- Umgang mit dem Dilemma – Eine Terminologie des Vorbehalts
- „Der Sprache Zucht auferlegen“ – Konsequenzen für den eigenen Sprachgebrauch
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik des Begriffs der „geistigen Behinderung“ und untersucht dessen Tauglichkeit als konstitutiver Begriff der heilpädagogischen Fachrichtung. Der Fokus liegt auf der Sprachverwirrung im Zusammenhang mit dem Phänomen „Behinderung“ und dem negativen Bild, das der Begriff „geistige Behinderung“ impliziert. Die Arbeit analysiert die historischen, sprachlichen, interdisziplinären und gesellschaftlichen Aspekte des Begriffs und diskutiert alternative Bezeichnungen.
- Die Problematik des Begriffs der „geistigen Behinderung“
- Die Sprachverwirrung im Zusammenhang mit dem Phänomen „Behinderung“
- Das negative Bild, das der Begriff „geistige Behinderung“ impliziert
- Die Suche nach alternativen Begriffen
- Die Bedeutung der Sprache in der Heilpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Sprachverwirrung im Bereich der Heilpädagogik und stellt die Problematik des Begriffs „geistige Behinderung“ in den Vordergrund. Es wird deutlich, dass die Verwendung des Begriffs zu Diskriminierung und einem negativen Selbstbild der Betroffenen führt.
Kapitel 2 befasst sich mit der Bedeutung der Sprache und deren Einfluss auf unser Denken und Handeln. Die Analyse der Funktion und Macht der Sprache liefert wichtige Erkenntnisse für den Umgang mit Begriffen im Kontext der Behinderung.
Kapitel 3 untersucht die historischen, sprachlichen, interdisziplinären und gesellschaftlichen Aspekte des Begriffs der „geistigen Behinderung“. Es werden verschiedene Perspektiven auf Behinderung beleuchtet, darunter die Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die individuelle, soziale und rechtliche Dimension.
Kapitel 4 widmet sich der Suche nach alternativen Begriffen, die den Menschen mit besonderen Bedürfnissen gerecht werden und Diskriminierung vermeiden. Es werden verschiedene Möglichkeiten und Herausforderungen der Begriffsumsetzung diskutiert.
Kapitel 5 befasst sich mit den Konsequenzen des Sprachgebrauchs und plädiert für eine verantwortungsvolle und nicht-diskriminierende Sprache. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Begriffs der „geistigen Behinderung“ und die Bedeutung einer inklusiven Sprache.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der „geistigen Behinderung“ und den damit verbundenen sprachlichen, historischen, interdisziplinären und gesellschaftlichen Dimensionen. Zentrale Begriffe sind: Sprachverwirrung, Diskriminierung, Inklusion, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Sonderpädagogik, Heilpädagogik, Menschenbild, Selbstbild, Begriffsanalyse, alternative Bezeichnungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird der Begriff "geistige Behinderung" in der Heilpädagogik kritisiert?
Der Begriff wird als unbrauchbar angesehen, da er oft negative Bilder impliziert und zu Diskriminierung führt, ist aber aufgrund fehlender Alternativen oft noch notwendig.
Welche historischen Vorläuferbegriffe gab es für "geistige Behinderung"?
Historisch wurden Begriffe wie „Idiot“ verwendet, die heute als stark abwertend gelten und die Entwicklung hin zu moderneren Bezeichnungen zeigen.
Wie definiert die WHO den Begriff der Behinderung?
Die Arbeit untersucht Behinderung aus verschiedenen interdisziplinären Perspektiven, darunter die Sichtweise der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Gibt es bessere Alternativen zum Begriff "geistige Behinderung"?
Diskutiert werden Begriffe wie „kognitives Anderssein“ oder „besonderer Förderbedarf“, wobei die Suche nach einem perfekten Ersatz schwierig bleibt.
Was versteht der Autor unter einer "Terminologie des Vorbehalts"?
Es ist ein bewusster Umgang mit Sprache, der sich der Mängel der Begriffe bewusst ist und versucht, Diskriminierung durch reflektierten Sprachgebrauch zu vermeiden.
- Citation du texte
- Martin Rödiger (Auteur), 2001, Vom Idioten zum Menschen mit besonderem Förderbedarf - Reflexionen zum Begriff der geistigen Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14350