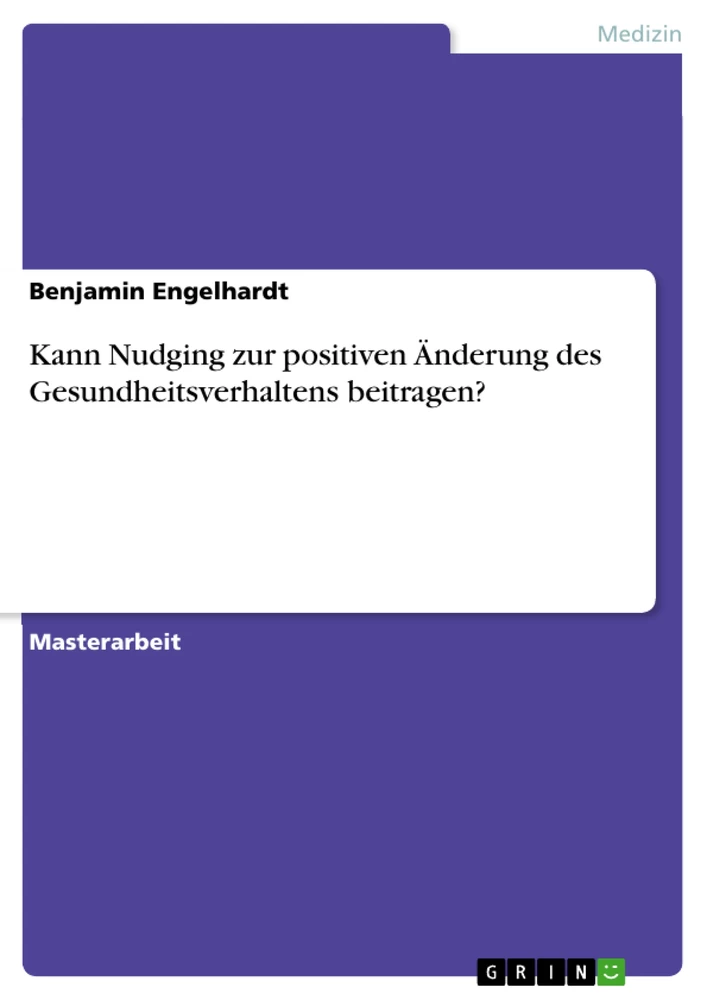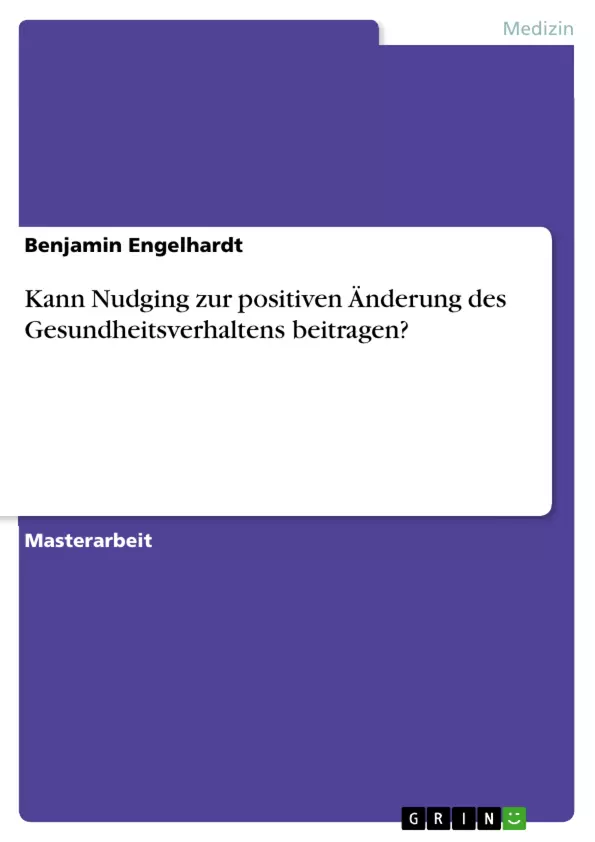Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern Nudging zu einer positiven Änderung des Gesundheitsverhaltens beitragen kann, beziehungsweise sich als wirkungsvolles Instrument sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Ernährungsbereich eignet. Die theoretische Vorarbeit erfolgte mit einer Literaturanalyse. Die empirischen Daten wurden durch Experteninterviews erhoben und anschließend im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Forschungsarbeit zeigt die aktuelle Lage der Nudging-Diskussion und stellt fest, dass Nudging ein sehr attraktives verhaltensökonomisches Instrument ist, sofern es korrekt eingesetzt wird. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich Nudging-Maßnahmen viel stärker an Zielgruppen oder Einzelpersonen orientieren sollten, um erfolgreich zu sein. Die neuen Erkenntnisse aus der Praxis tragen außerdem dazu bei, dass die teilweise sehr theorielastige Diskussion mit Praxisbeispielen ergänzt und so realistischer wird. Das Potenzial von Nudging in der Coronavirus-Pandemie und das Thema Manipulation sind zwei von weiteren wichtigen Themen, die (neue) Aufmerksamkeit verdienen. Die Ergebnisse erlauben, den Titel dieser Arbeit mit „Ja“ zu beantworten.
Verhaltensökonomische Erkenntnisse haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen – nicht zuletzt durch die Arbeiten von Thaler und Sunstein. Anfangs beschränkte sich die Regulierungsdiskussion vor allem auf einige englischsprachige Industrieländer, wie die USA oder Großbritannien. Inzwischen hat sich der Nudging-Ansatz weltweit verbreitet und im privaten wie im öffentlichen Sektor Befürworter gefunden, wie beispielsweise die deutsche Bundesregierung. Das neoklassische Modell des Homo Oeconomicus, also dem durchweg rational entscheidenden Menschen, wird mit neuen empirischen Erkenntnissen aus der Verhaltensökonomie zunehmend infrage gestellt: Der Mensch ist mitnichten nur ein rational handelndes Wesen, das nur nutzenorientiert handelt. Strukturelle Fehler und irrationales menschliches Handeln erfordern die Formulierung detailreicher Modelle, die sich an der „Lebenswirklichkeit“ der Menschen orientieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Methodik
- Grenzen der Studie
- Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand
- Nudging vor und nach Thaler und Sunsteins Veröffentlichung
- Nudging im Allgemeinen
- Nudging und libertärer Paternalismus
- Merkmale und Voraussetzungen für Nudging
- Kritik am (liberitären) Paternalismus in Verbindung mit Nudging
- Nudging im Kontext der Verhaltensökonomie
- Allgemeine Einführung
- Entscheidungsverhalten
- Nudging im Gesundheitsbereich
- Beispiele aus der Nudging-Praxis
- Lösungen zum Erfolg: Beispiele und Maßnahmen
- Die Rolle des Staats
- Die Rolle der Unternehmen
- Die Rolle der Bürger
- Nudging: Freiheit, Manipulation und Recht
- Freiheit und Manipulation
- Rechtliche Aspekte
- Methodik
- Gütekriterien
- Systematische Literaturrecherche
- Das Experteninterview
- Formen und Funktionen von Experteninterviews
- Auswahl der Interviewpartner und deren Einladung
- Erstellung der Leitfäden und Pretest
- Dramaturgie der Experteninterviews und Transkription
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Methodenkritik
- Vorstellung der Ergebnisse
- Kategorie 1: Historie
- Nudging-Erfolge
- Nudging-Entwicklung
- Kategorie 2: Charakteristik von Nudging
- Kategorie 3: Potenzial von Nudging
- Kategorie 4: Nudging-Verhalten
- Menschliches Wesen
- Einlassen auf Nudging
- Positive Veränderungen
- Erforderliche Maßnahmenwiederholung
- Erfolgspotenzial extrinsischer Motivation
- Wirksamkeit
- Verbraucherwissen
- Kategorie 5: Gesellschaftliche Bedeutung
- Ethik
- Ansehen von Nudging
- Manipulation von Nudging
- Nudging-Potenzial in der Corona-Pandemie
- Diskussion
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
- Interpretation und Bewertung
- Theoriebildung und Praktische Implikationen
- Grenzen der Aussagekraft und Konsequenzen für die zukünftige Forschung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert das Potenzial von Nudging als Instrument zur positiven Veränderung des Gesundheitsverhaltens im Bereich von Ernährung und Gesundheit. Die Arbeit strebt an, die Einordnung von Nudging in den Kontext der Verhaltensökonomie zu erläutern, seine Stärken und Grenzen aufzuzeigen und seine Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis zu beleuchten.
- Einordnung und Abgrenzung von Nudging als Instrument der Verhaltensökonomie
- Analyse der Wirksamkeit von Nudging-Maßnahmen im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten
- Bewertung der ethischen Aspekte von Nudging und des Risikos von Manipulation
- Untersuchung der Rolle von Nudging in der aktuellen Coronavirus-Pandemie
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Anwendung von Nudging in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, Zielsetzung, Methodik und Grenzen der Studie erläutert. Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund und dem Forschungsstand zum Thema Nudging. Dabei werden verschiedene Definitionen und Konzepte des Nudging beleuchtet, der libertäre Paternalismus als theoretisches Konzept vorgestellt und die Diskussion um Nudging in der Verhaltensökonomie beleuchtet. Die Rolle des Staates, der Unternehmen und der Bürger im Kontext des Nudging wird ebenfalls analysiert.
Kapitel 3 erläutert die Methodik der Arbeit, wobei der Schwerpunkt auf der Durchführung und Auswertung von Experteninterviews liegt. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Experteninterviews und analysiert diese anhand eines zuvor entwickelten Kategoriensystems. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse interpretativ und kritisch und entwickelt daraus Handlungsempfehlungen für die zukünftige Forschung.
Die Arbeit endet mit einem Fazit und Ausblick, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und weitere Forschungsfelder aufzeigt.
Schlüsselwörter
Verhaltensökonomie, Nudging, libertärer Paternalismus, Gesundheitsverhalten, Ernährung, Manipulation, Corona-Pandemie, Experteninterviews, Qualitative Inhaltsanalyse.
- Citation du texte
- Benjamin Engelhardt (Auteur), 2022, Kann Nudging zur positiven Änderung des Gesundheitsverhaltens beitragen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1435751