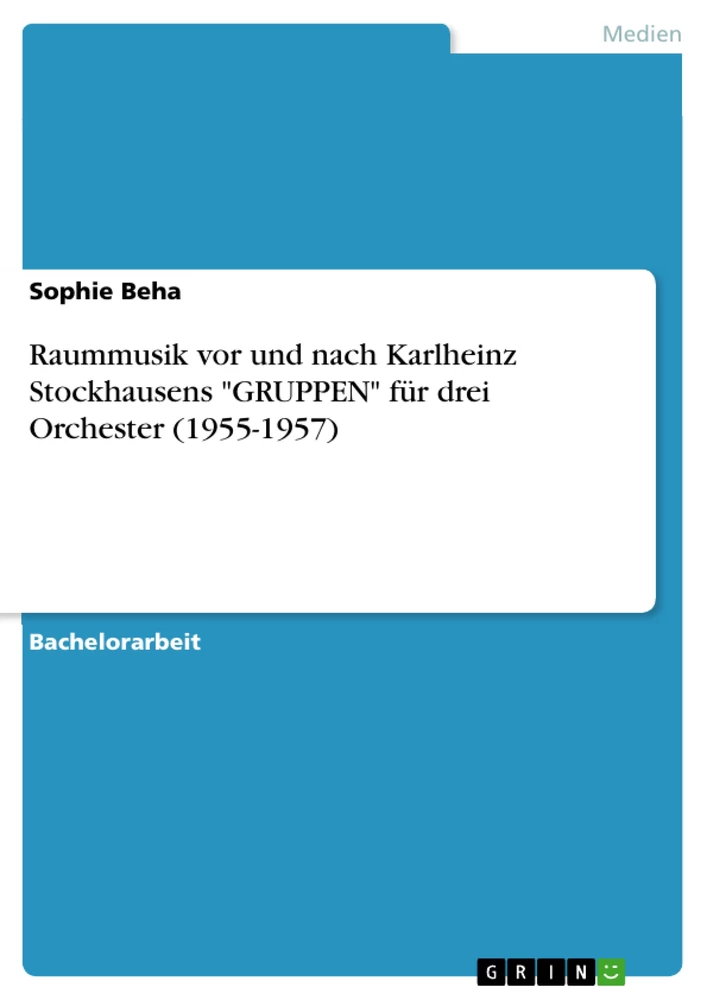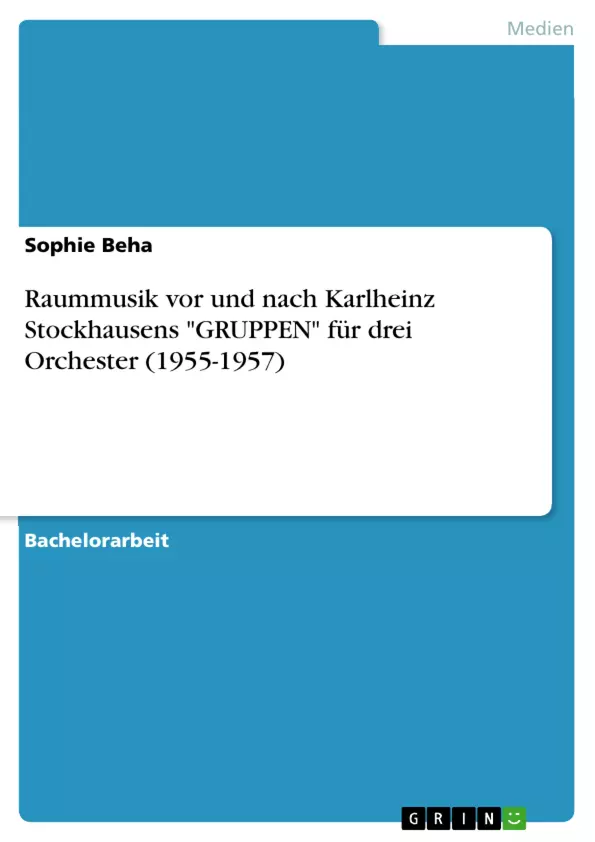Musik gilt als Zeitkunst – ihre Aufführung ist an verrinnende Zeit gebunden. Raum existiert im allgemeinen Verständnis außerhalb von Musik – als realer, physikalischer Ort. Zwischen diesen Parametern sind die Prioritäten klar verteilt: Der Raum ist eine Bedingung für die Entfaltung von musikalisch strukturierter Zeit. Diese Neutralität des Raumes gegenüber der Komposition wurde bisher zweimal aufgehoben2 – mit gravierenden Entwicklungen in der Kompositionstechnik: mit der Mehrchörigkeit der Venezianischen Schule (ca. 1530–1630) und mit serieller und elektronischer Musik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dieses Phänomen von „Musik im Raum“, wie Karlheinz Stockhausen es 1958 genannt hat, bedeutet laut Gisela Nauck „in dreifachem Sinne einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte der musikalischen Moderne.“
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Karlheinz Stockhausen, weil er zu den ersten und bedeutendsten seriellen Raummusik-Komponisten gehört. Sein Stück „GRUPPEN“ für drei Orchester war eine damals bahnbrechende Raummusik-Komposition und ist auch heute noch exemplarisch. Außerdem ist Stockhausens kompositorisches Schaffen, auch über die 1950er Jahre hinaus, ein Beispiel dafür, dass seit jener seriellen Phase der reale Raum als Kompositionselement seine Arbeit kontinuierlich beeinflusste. Serielle Raummusik ist darin keine sporadische, en-vogue-Erscheinung, sondern ein Impuls für spätere Entwicklungen.
Da in der Literatur mehrfach eine Unschärfe bei der Verwendung des Raumbegriffs in musikalischen Zusammenhängen registriert wurde, widmet sich ein Kapitel der Differenzierung dieses Begriffes und versucht, die Zusammenhänge sinnvoll zu definieren. Dem schließt sich ein Überblick über die Entwicklungsphasen von Raummusik in der europäischen Musikgeschichte an – von Venezianischer Mehrchörigkeit im 16. Jahrhundert bis zu serieller Raummusik im 20. Jahrhundert. Sporadische Einbeziehungen von räumlichen, teilweise auch musik-theatralen Effekten bei Beethoven, Berlioz oder Mahler werden nur kurz angerissen. Ebenso wie die räumlich intendierten, synästhetisch-mystischen Entwürfe von kuppelförmigen Musikstätten, weil sich dadurch die bereits angesprochenen Prioritäten von Raum und Zeit nicht grundlegend verändert haben. Die Uraufführung von „GRUPPEN“ 1958 zeigte allerdings, dass dies hier der Fall war: Stockhausen hatte eine qualitative Veränderung der Zeit-Raum-Relation innerhalb der Musik offenbart. „GRUPPEN“ war revolutionär, genauso wie sein Schöpfer.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- WAS UND WO IST RAUM?
- Raummusik - eine Differenzierung
- Musik als Raumkunst
- Raumkompositionen
- Raumprojektionen oder Musik für den (bestimmten) Raum
- ENTWICKLUNG VON RAUMMUSIK IN DER MUSIKGESCHICHTE
- Raummusik
- Venezianische Mehrchörigkeit
- Raumkonzepte und Strategien der Verräumlichung in der sinfonischen Musik
- KARLHEINZ STOCKHAUSENS „GRUPPEN“ FÜR DREI ORCHESTER (1955-1957)
- Einordnung in den zeitgeschichtlichen Kontext: Wunderjahre
- Zur musikgeschichtlichen Situation: Die Anfänge des seriellen Komponierens
- Musik, Raum und Zeit
- Der Komponist Karlheinz Stockhausen
- „GRUPPEN“ für drei Orchester (1955-1957)
- Setting und Überblick
- Aufbau
- Serielle Gestaltung
- Vereinheitlichung von Zeit und Raum
- Serielle Gruppenkriterien im Raum-Zeit-Kontinuum
- Komposition: Die musikalische Handhabung der seriellen Vorgaben
- Instrumentation
- Großformale Anlage
- Raum
- REZEPTION
- Rezeption bei Rezipient*innen
- Rezeption bei Stockhausen
- Werke
- Rezeption von Komponist*innen
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der Entwicklung und Bedeutung von Raummusik im 20. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf Karlheinz Stockhausens Werk „GRUPPEN“ für drei Orchester. Die Arbeit untersucht die Geschichte der Raummusik, ihre Herausforderungen und Möglichkeiten, und die Rolle von Stockhausens Komposition im Kontext dieser Entwicklung.
- Differenzierung des Raumbegriffs in der Musik
- Entwicklung der Raummusik in der Musikgeschichte
- Einordnung von „GRUPPEN“ in den zeitgeschichtlichen Kontext
- Die serielle Kompositionstechnik in „GRUPPEN“
- Die Rezeption von Raummusik und „GRUPPEN“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Raummusik ein, skizziert ihre Bedeutung für die Geschichte der Musik und beleuchtet die Rolle von Karlheinz Stockhausen als einflussreichem Komponisten. Im nächsten Kapitel wird der Begriff „Raum“ in der Musik differenziert und die Entwicklung der Raummusik von der Venezianischen Mehrchörigkeit bis zu den seriellen Kompositionen des 20. Jahrhunderts vorgestellt.
Kapitel 4 behandelt Stockhausens „GRUPPEN“ und seine Einordnung in den Kontext der „Wunderjahre“ der seriellen Musik. Es beleuchtet die Entstehung des Werkes, seine Kompositionsstruktur und die serielle Gestaltung mit ihren Implikationen für Raum und Zeit. Außerdem wird die Instrumentation, die großformale Anlage und die Rolle des Raumes in „GRUPPEN“ untersucht.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Rezeption von „GRUPPEN“ durch Rezipient*innen, den Komponisten selbst und andere Komponist*innen.
Schlüsselwörter
Raummusik, Karlheinz Stockhausen, „GRUPPEN“, serielle Musik, Zeit und Raum, Rezeption, Geschichte der Musik, Mehrchörigkeit, venezianische Schule, Wunderjahre, Kompositionstechnik, Raumkonzept, musikalische Gestaltung.
- Quote paper
- Sophie Beha (Author), 2021, Raummusik vor und nach Karlheinz Stockhausens "GRUPPEN" für drei Orchester (1955-1957), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1435957