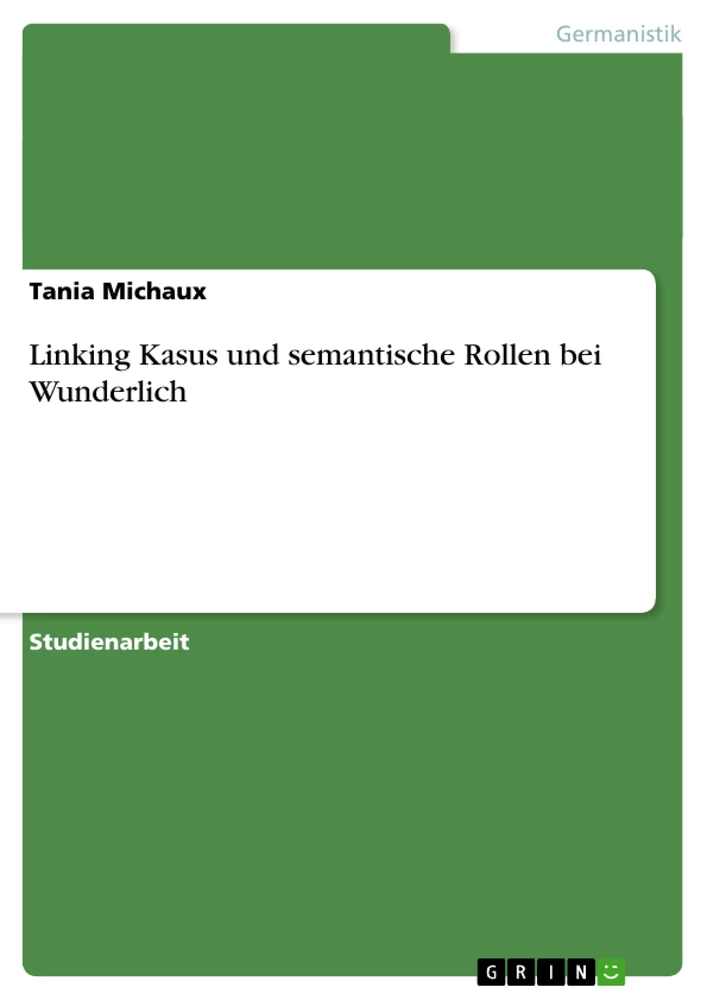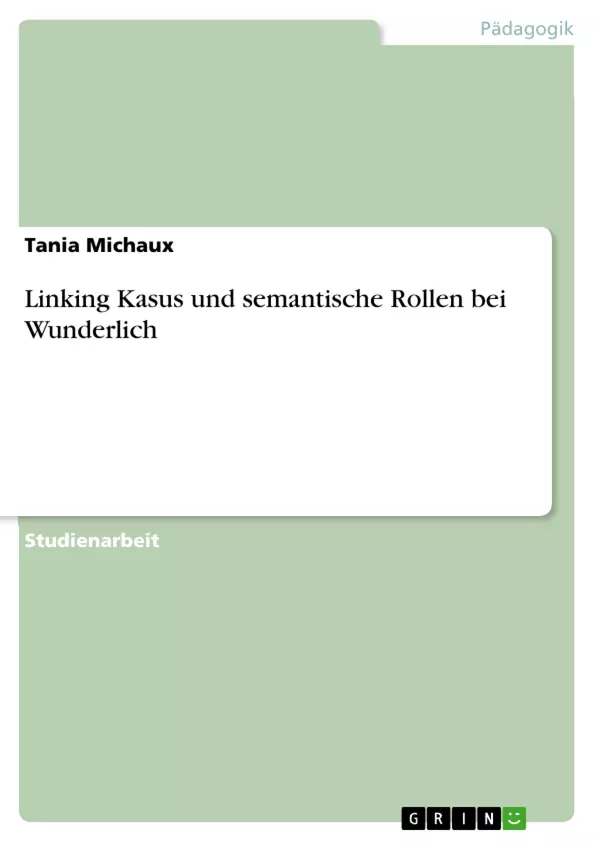Der Begriff Kasus, vom Lateinischen casus, also Fall, hat seinen Ursprung im Griechischen ‚ptotis‘, das Aristoteles zur Bezeichnung der grammatischen Veränderung von Nomen und Verben benutzte. Diese erste Bezeichnung wurde dann von den Stoikern auf die Beugung der Nomina begrenzt.1 Im Deutschen gibt es vier Kasus, nämlich Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. In anderen Sprachen, den sogenannten Ergativsprachen, wie zum Beispiel dem Baskischen gibt es den Ergativ. Dieser markiert in transitiven Sätzen das Subjekt, wobei er in intransitiven Sätzen nicht markiert.
Ziel der verschiedenen grammatischen Ansätze über Kasus ist die syntaktischen, perspektivischen und semantischen Eigenschaften des Kasussystems zu beschreiben und zu erklären. Wunderlichs Ansatz bedient sich der semantischen Dekomposition und dem Linking, also der Kasuszuweisung. Dies wird in der folgenden Arbeit näher beschrieben. Zuerst wird Wunderlichs Theorie wissenschaftsgeschichtlich eingeordnet, schließlich komme ich auf die Zwei-Ebenen-Semantik zu sprechen, dann befasse ich mich mit der λ-Abstraktion und der Theta-Struktur. Anschließsend werde ich die verschiedenen Constraints auflisten und dann auf den Linkingmechanismus zu sprechen kommen. Diesen werde ich anhand von Beispielen erklären und den besonderen Fall des inhärenten Dativs erläutern. Abschließend werde ich mich dann den Vor- und Nachteilen widmen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Wissenschaftsgeschichtliche Einordnung
- 2. Zwei-Ebenen-Semantik
- a. Konzeptuelle Struktur
- b. Semantische Form
- 3. λ-Abstraktion und Thetastruktur
- 4. Constraints
- 5. Kontextuelle Merkmale und Linkingmechanismus
- 6. Linking Kasus am Beispiel von transitiven und intransitiven Verben
- 7. Lexikalischer Dativ
- 8. Diskussion des Ansatzes
- a. Vorteile
- b. Nachteile
- 9. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung, der semantische Dekomposition und Linking kombiniert. Ziel ist es, die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung, die Zwei-Ebenen-Semantik, die λ-Abstraktion, Theta-Struktur, Constraints und den Linkingmechanismus zu beschreiben und zu analysieren.
- Wissenschaftsgeschichtliche Einordnung von Wunderlichs Theorie
- Erklärung der Zwei-Ebenen-Semantik und ihrer Komponenten
- Analyse des Linkingmechanismus bei transitiven und intransitiven Verben
- Beschreibung der Rolle der λ-Abstraktion und Theta-Struktur
- Bewertung der Vor- und Nachteile von Wunderlichs Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt den Begriff "Kasus" ein, seine historische Entwicklung und seine Bedeutung in verschiedenen Sprachen. Sie umreißt den Fokus der Arbeit: die Beschreibung und Erklärung von Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung mittels semantischer Dekomposition und Linking. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise, beginnend mit der wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung bis hin zur Diskussion der Vor- und Nachteile.
1. Wissenschaftsgeschichtliche Einordnung: Dieses Kapitel verortet Wunderlichs Grammatiktheorie im Kontext der semantischen Dekomposition, die in den 1970er Jahren von McCawley eingeführt und von Linguisten wie Jackendoff, Dowty und Bierwisch weiterentwickelt wurde. Es beschreibt die semantische Dekomposition als Zerlegung von Wortbedeutungen in einzelne Komponenten, insbesondere bei Verben, und erwähnt die verschiedenen Repräsentationsebenen in Wunderlichs lexikalischer Dekompositionsgrammatik, die auf Bierwischs Zwei-Ebenen-Semantik basieren.
2. Zwei-Ebenen-Semantik: Dieses Kapitel erläutert Bierwischs Zwei-Ebenen-Semantik, die zwischen konzeptueller Struktur (sprachunabhängig, basierend auf Welt- und Situationswissen) und semantischer Form (sprachgebunden, lexikonbasiert) unterscheidet. Es wird argumentiert, dass kognitive und sprachliche Fähigkeiten getrennt zu betrachten sind. Die konzeptuelle Struktur und die semantische Form werden anhand von Beispielen (z.B. intransitive Verben wie "weinen", transitive Verben wie "leeren", ditransitive Verben wie "geben") detailliert erklärt und ihre Unterschiede herausgestellt.
Schlüsselwörter
Kasus, semantische Rollen, Wunderlich, Zwei-Ebenen-Semantik, konzeptuelle Struktur, semantische Form, λ-Abstraktion, Theta-Struktur, Linking, Constraints, transitiv, intransitiv, lexikalischer Dativ, semantische Dekomposition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung, der semantische Dekomposition und Linking kombiniert. Sie beschreibt und analysiert die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung, die Zwei-Ebenen-Semantik, die λ-Abstraktion, Theta-Struktur, Constraints und den Linkingmechanismus.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die wissenschaftsgeschichtliche Einordnung von Wunderlichs Theorie, die Erklärung der Zwei-Ebenen-Semantik und ihrer Komponenten (konzeptuelle Struktur und semantische Form), die Analyse des Linkingmechanismus bei transitiven und intransitiven Verben, die Beschreibung der Rolle der λ-Abstraktion und Theta-Struktur, und die Bewertung der Vor- und Nachteile von Wunderlichs Ansatz.
Was ist die Zwei-Ebenen-Semantik nach Bierwisch?
Die Zwei-Ebenen-Semantik unterscheidet zwischen konzeptueller Struktur (sprachunabhängig, basierend auf Welt- und Situationswissen) und semantischer Form (sprachgebunden, lexikonbasiert). Die Arbeit argumentiert, dass kognitive und sprachliche Fähigkeiten getrennt zu betrachten sind. Die konzeptuelle Struktur und die semantische Form werden anhand von Beispielen (intransitive, transitive und ditransitive Verben) detailliert erklärt.
Welche Rolle spielen λ-Abstraktion und Theta-Struktur?
Die Arbeit beschreibt die Rolle der λ-Abstraktion und Theta-Struktur im Kontext von Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung. Die genauen Details der Erklärung sind im Text selbst nachzulesen.
Wie wird der Linkingmechanismus bei transitiven und intransitiven Verben analysiert?
Die Arbeit analysiert den Linkingmechanismus, der die semantischen Rollen mit den syntaktischen Kasus verbindet, spezifisch im Kontext transitiver und intransitiver Verben. Die genaue Vorgehensweise und die Ergebnisse sind im Text detailliert dargestellt.
Welche Vor- und Nachteile von Wunderlichs Ansatz werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet die Vor- und Nachteile von Wunderlichs Ansatz zur Kasuszuweisung. Diese Diskussion findet in einem separaten Kapitel statt und beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen des Ansatzes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Wissenschaftsgeschichtliche Einordnung, Zwei-Ebenen-Semantik, λ-Abstraktion und Thetastruktur, Constraints, Kontextuelle Merkmale und Linkingmechanismus, Linking Kasus am Beispiel von transitiven und intransitiven Verben, Lexikalischer Dativ, Diskussion des Ansatzes (Vorteile und Nachteile), Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kasus, semantische Rollen, Wunderlich, Zwei-Ebenen-Semantik, konzeptuelle Struktur, semantische Form, λ-Abstraktion, Theta-Struktur, Linking, Constraints, transitiv, intransitiv, lexikalischer Dativ, semantische Dekomposition.
Wo wird Wunderlichs Theorie wissenschaftsgeschichtlich eingeordnet?
Kapitel 1 ordnet Wunderlichs Grammatiktheorie im Kontext der semantischen Dekomposition ein, die in den 1970er Jahren von McCawley eingeführt und von Linguisten wie Jackendoff, Dowty und Bierwisch weiterentwickelt wurde. Es beschreibt die semantische Dekomposition als Zerlegung von Wortbedeutungen in einzelne Komponenten, insbesondere bei Verben.
- Quote paper
- Tania Michaux (Author), 2009, Linking Kasus und semantische Rollen bei Wunderlich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143650