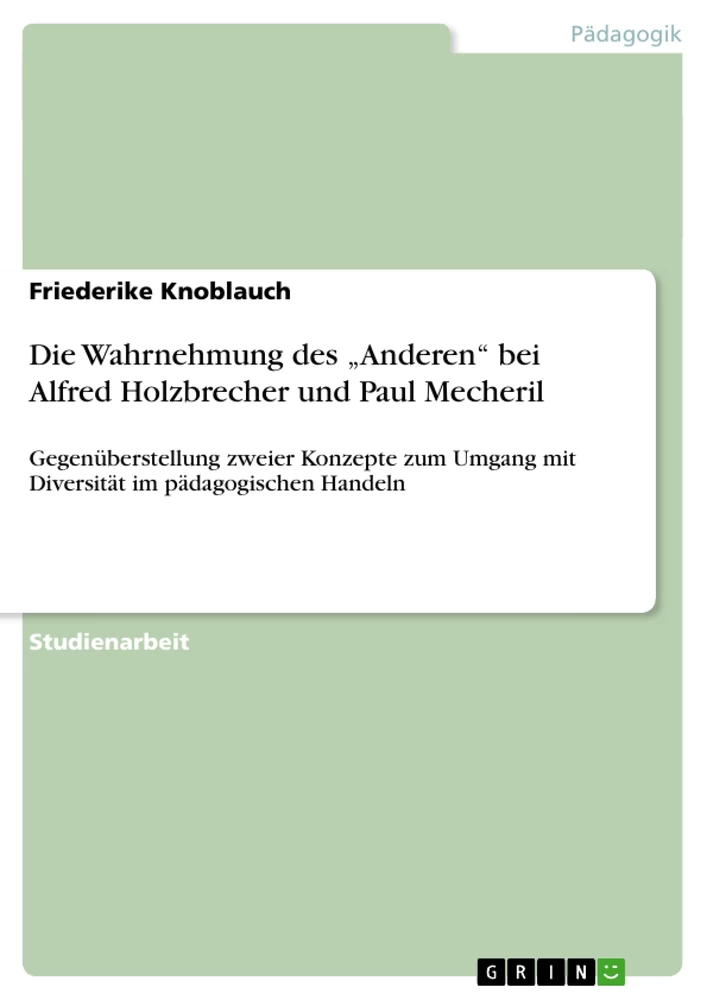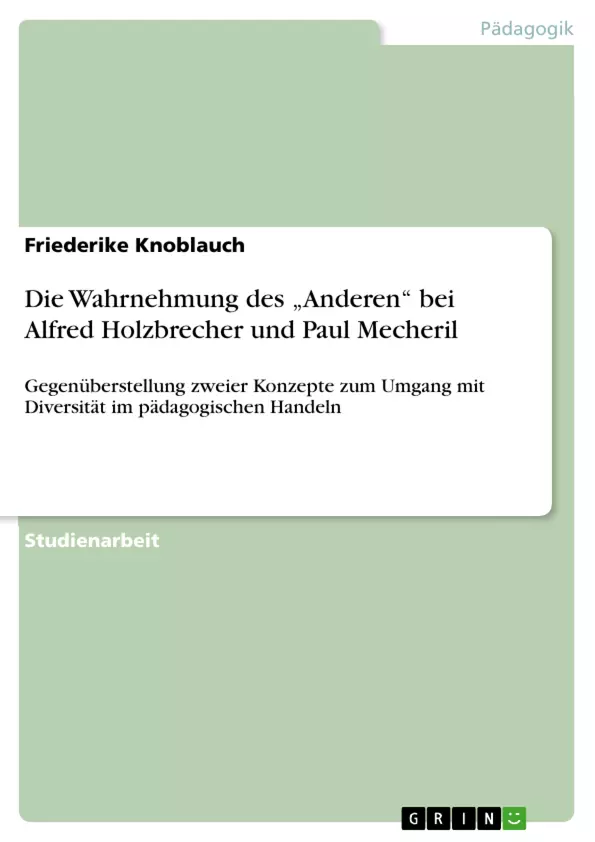Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft. Seit der Wende zum 20. Jahrhundert ist Deutschland eines der wichtigsten Einwanderungsländer in Europa. Hunderttausende von Menschen immigrierten - und immigrieren noch - aufgrund von Aussiedlung, Arbeitsmigration und Flucht.
Das Vorliegen einer heterogenen oder „interkulturellen“ Gesellschaft führt auch in der Pädagogik seit einiger Zeit zur Reflexion über veränderte oder speziell zugeschnittene pädagogische Maßnahmen, um dieser gerecht zu werden. Eine wichtige und grundlegende Frage ist hierbei, wie „Andere“ überhaupt wahrgenommen und definiert werden.
Zwei Autoren, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, sind Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril. In dieser Arbeit werden die Theorien der beiden Pädagogen zur Wahrnehmung des und dem pädagogischen Umgang mit dem Anderen skizziert und gegenübergestellt.
Hierzu wird zunächst die Wahrnehmung des Anderen nach Holzbrecher vorgestellt. Dies beinhaltet seine Erklärung zur Entstehung unserer Wahrnehmung von „Anderem“, Annahmen zu Wahrnehmung und Weltbild sowie Konzepte zum Umgang mit Anderen. Daraufhin wird Mecherils Perspektive auf die Wahrnehmung des Anderen vorgestellt, wobei zunächst auf die Sicht und Behandlung von Anderen in Ausländer- und Interkultureller Pädagogik eingegangen wird. Dann werden grundlegende diskursive Richtungen zur Betrachtung und Behandlung des Anderen vorgestellt und schließlich Mecherils Konzept der „Migrationspädagogik“ skizziert, welches Vorschläge zum pädagogischen Handeln in einer heterogenen Gesellschaft anbietet.
Zum Schluss werden beide Konzepte gegenübergestellt und deren Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Wahrnehmung des Anderen nach Alfred Holzbrecher
- 2.1 Historische Entstehung unserer Wahrnehmung des Anderen
- 2.1.1 Konstruktion des „Anderen“ in der Geschichte der Neuzeit
- 2.1.2 Wahrnehmung des „Anderen“ heute
- 2.2 Wahrnehmung und Weltbild
- 2.3 Modi des Fremderlebens
- 2.4 Das Fremde im Eigenen
- 2.1 Historische Entstehung unserer Wahrnehmung des Anderen
- 3. Paul Mecherils Migrationspädagogik
- 3.1 Der Andere in der Migrationspädagogik
- 3.1.1 Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit
- 3.2 Der natio-ethno-kulturelle Andere: Von der Ausländerpädagogik zur Interkulturellen Pädagogik
- 3.2.1 Ausländerpädagogik
- 3.2.2 Interkulturelle Pädagogik
- 3.3 Der Migrationsandere: Vier diskursive Felder
- 3.4 Die migrationspädagogische Perspektive
- 3.1 Der Andere in der Migrationspädagogik
- 4. Gegenüberstellung der Wahrnehmung des Anderen bei Holzbrecher und Mecheril
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit verfolgt das Ziel, die Theorien von Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril zur Wahrnehmung des „Anderen“ im pädagogischen Kontext zu vergleichen und gegenüberzustellen. Die Arbeit beleuchtet, wie beide Autoren die Entstehung und den Einfluss der Wahrnehmung von Fremdheit auf pädagogisches Handeln erklären.
- Die historische Konstruktion des „Anderen“
- Der Einfluss von Wahrnehmung und Weltbild auf den Umgang mit Diversität
- Vergleichende Analyse der Konzepte von Holzbrecher und Mecheril
- Ausländerpädagogik vs. Interkulturelle Pädagogik
- Migrationspädagogik als Ansatz für heterogene Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wahrnehmung des „Anderen“ in einer Migrationsgesellschaft wie Deutschland ein. Sie stellt die Relevanz des Themas für die Pädagogik heraus und benennt Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril als zentrale Bezugspunkte der Arbeit. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs beider pädagogischer Perspektiven auf die Wahrnehmung und den Umgang mit Diversität.
2. Die Wahrnehmung des Anderen nach Alfred Holzbrecher: Dieses Kapitel präsentiert Holzbrechers Theorie zur Wahrnehmung des „Anderen“. Es untersucht die historische Entwicklung der Wahrnehmung von Fremdheit, beginnend mit der Neuzeit und ihren Ängsten vor dem Unbekannten. Holzbrecher analysiert, wie Kategorisierung und Schematisierung zur Konstruktion des „Anderen“ führten, und beleuchtet die Ambivalenz von Angst und Faszination gegenüber dem Fremden. Beispiele wie die Kolonisierung und die Vorstellung vom „edlen Wilden“ veranschaulichen diese Ambivalenz. Das Kapitel beschreibt weiter, wie die Kopernikanische Wende und die Kantsche Vernunftphilosophie zur Konstruktion eines „Anderen der Vernunft“ führten – dem Irrationalen, Unbewussten und Sinnlichen. Die Erforschung der Natur wird als ein Ausdruck dieser Beziehung zum „Anderen“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Wahrnehmung des Anderen, Diversität, Interkulturelle Pädagogik, Migrationspädagogik, Alfred Holzbrecher, Paul Mecheril, Ausländerpädagogik, Fremdheit, Identität, Heterogenität, Weltbild, Konstruktion des Anderen, Kolonialismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wahrnehmung des Anderen bei Holzbrecher und Mecheril
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht und kontrastiert die Theorien von Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril zur Wahrnehmung des „Anderen“ im pädagogischen Kontext. Sie untersucht, wie beide Autoren die Entstehung und den Einfluss der Wahrnehmung von Fremdheit auf pädagogisches Handeln erklären und analysiert die historische Konstruktion des „Anderen“, den Einfluss von Wahrnehmung und Weltbild auf den Umgang mit Diversität sowie die Konzepte von Ausländerpädagogik und Interkultureller Pädagogik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Konstruktion des „Anderen“, insbesondere in der Neuzeit, den Einfluss von Wahrnehmung und Weltbild auf den Umgang mit Diversität, einen Vergleich der Konzepte von Holzbrecher und Mecheril, die Unterschiede zwischen Ausländerpädagogik und Interkultureller Pädagogik und die Migrationspädagogik als Ansatz für heterogene Gesellschaften. Es werden verschiedene Modi des Fremderlebens und die Ambivalenz von Angst und Faszination gegenüber dem Fremden beleuchtet.
Welche Autoren stehen im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentralen Bezugspunkte der Arbeit sind die Theorien von Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril. Die Arbeit analysiert ihre jeweiligen Perspektiven auf die Wahrnehmung und den Umgang mit Diversität im pädagogischen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zu Holzbrechers Theorie der Wahrnehmung des Anderen (inkl. historischer Entstehung, Wahrnehmung und Weltbild, Modi des Fremderlebens und dem Fremden im Eigenen), ein Kapitel zu Mecherils Migrationspädagogik (inkl. des Anderen in der Migrationspädagogik, Ausländerpädagogik vs. Interkulturelle Pädagogik, und der migrationspädagogischen Perspektive), ein Kapitel zum Vergleich beider Ansätze, und eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Wahrnehmung des „Anderen“ historisch konstruiert wurde und wie diese Wahrnehmung das pädagogische Handeln beeinflusst. Sie vergleicht die Ansätze von Holzbrecher und Mecheril und beleuchtet die Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur Interkulturellen Pädagogik im Kontext der Migrationspädagogik. Die konkreten Ergebnisse des Vergleichs sind im entsprechenden Kapitel der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wahrnehmung des Anderen, Diversität, Interkulturelle Pädagogik, Migrationspädagogik, Alfred Holzbrecher, Paul Mecheril, Ausländerpädagogik, Fremdheit, Identität, Heterogenität, Weltbild, Konstruktion des Anderen, Kolonialismus.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Pädagogik, Sozialwissenschaften und anderer relevanter Disziplinen, die sich mit Fragen der Interkulturellen Pädagogik, Migrationspädagogik und der Wahrnehmung von Diversität auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Friederike Knoblauch (Autor:in), 2009, Die Wahrnehmung des „Anderen“ bei Alfred Holzbrecher und Paul Mecheril, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/143680